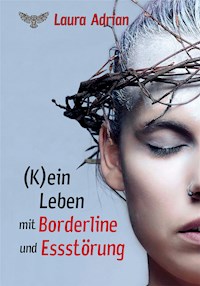
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Merlins Bookshop
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Borderlinebetroffene sind in erster Linie auch „nur“ Menschen. Und ich bin einer von ihnen. Ich habe die Diagnosen Borderline, Magersucht und Bulimie – aber trotzdem kann ich (zumindest heute) behaupten, dass ich gerne lebe und jeden neuen Tag auf dieser Erde zu schätzen weiß. In meinem bisherigen Leben musste ich schon mehr als einen Schicksalsschlag einstecken. Ich lag mehrfach am Boden und war auch einige Male kurz davor aufzugeben, doch trotzdem habe ich mich jedes Mal wieder nach oben gekämpft. Fast 10 Jahre lang war mein Leben die reinste Achterbahnfahrt. Ich habe mich fast zu Tode gehungert, mir den Finger in den Hals gesteckt, die Arme zerschnitten, war unzählige Male in Psychiatrien und wurde von Ärzten bereits als hoffnungsloser Fall abgestempelt. Ununterbrochen ging es mit meiner Psyche auf und ab. Jedes Mal, wenn ich mich aus meinem dunklen Loch heraus gekämpft hatte, stürzte ich kurz darauf erneut in die Tiefe … Doch trotz der vielen Rückschläge und der unzähligen negativen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit machen musste, habe ich es geschafft, mich zurück ins Leben zu kämpfen. Dieses Buch ist meine Geschichte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
(K)ein Leben mit Borderline und Essstörung
Alle Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist rein zufällig. Original Ausgabe erschienen im Juni 2018 bei Merlins Bookshop.
Copyright © Merlins Bookshop
Korrektorat & Lektorat: Klarissa Klein & Merlins Bookshop
Verlag: Merlins Bookshop, Inh. Dietmar Noss, Waldstr. 22, 65626 Birlenbach
Alle Rechte liegen bei Merlins Bookshop, Inh. Dietmar Noss, Waldstr. 22, 65626 Birlenbach
Coverfoto: Peter Zell - https://www.facebook.com/peter.zell.96 Coverbearbeitung: Bernd Held - https://www.facebook.com/bernd.held.10
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Allgemeines über Borderline und Essstörung
1. Was bedeuten die Diagnosen für mich
2. Mein Leben vor der Krankheit
3. Wie alles begann
4. Geprägt
5. Funktionieren statt leben
6. Vergangenheit ist es erst, wenn es vorbei ist
7. Die schlimmste Zeit meines Lebens
8. Meine Freundin, die Magersucht
9. Von der Magersucht in die Bulimie
10. Leben für die Krankheit
11. Winter 2008 – Magersuchtswinter
12. Erste Einsicht? Oder wie tief kann ein Mensch sinken ...
13. Mein erster Klinikaufenthalt
14. Es geht bergauf
15. Leben wie im Knast
16. Das Ziel ist (fast) erreicht
17. Ein falscher Satz verändert alles
18. Meine Liebe zur Klinge
19. Schlimmer geht immer
20. Verlegung auf die geschlossene Station
21. Irgendwann ist alles egal
22. Abgrundtiefer Selbsthass und seine Folgen
23. Ein Lichtblick
24. Flucht nach vorne? Oder doch wieder zurück?
25. Verlegung in die Erwachsenenpsychiatrie
26. Zeit verändert – Verhalten bleiben manchmal gleich
27. Manchmal kommt es anders, als man denkt - gewiss kommt es anders, als man plant
28. Die Zeit Zuhause
29. Einzug in die Wohngruppe
30. Erste Orientierung in der WG
31. Es geht wieder bergab
32. Herzlich willkommen zurück, liebe Bulimie! Ich hätte gut und gerne auf dich verzichten können …
33. Senkrechter Sturzflug
34. Kompletter Einbruch
35. Einweisung in die Psychiatrie
36. Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren
37. Neue (alte) Strukturen
38. Weihnachten in der Psychiatrie
39. Stabilität mit Gewissenskonflikten
40. Wieder zurück in der Wohngruppe
41. Ausbildungsbeginn im September
42. Plötzlicher Einsturz
43. Die unendlichen Tiefen der Vergangenheit
44. Harter Kampf zurück ins Leben
45. Alles scheint gut zu werden
46. Stabil sieht anders aus, aber ab und zu gewinnt man aus einer bescheidenen Situation doch etwas Gutes
47. Zweiter Anlauf – erneute Aufnahme auf der offenen Station
48. Erneute Entlassung
49. Kampf ums Überleben
50. Es bewegt sich etwas in meinem Leben
51. Ab jetzt geht es steil bergauf
52. Senkrechtstart
53. Schritt für Schritt in Richtung Normalität und Selbstständigkeit
54. Trick 99 – Umlenken von Verhaltensweisen
55. Mein Leben heute
56. Schlussworte
Danksagung
Vorwort
Februar 2012
Alle denken, dass ich mit dem Essen gut klarkomme, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. Aber von meinem innerlichen Kampf, den ich bei jeder Mahlzeit tagtäglich gegen das Essen und vor allem gegen mich selbst führe, bekommt niemand etwas mit.
Ich weiß selbst nicht, warum ich an meinem viel zu mageren Körper hänge, der viel zu schwach ist, um ein lebenswertes Leben zu führen. Warum ich mich freue, wenn ich abgenommen habe, und sich meine Rippen und Beckenknochen unter der Haut abzeichnen. Warum ich Angst habe, zuzunehmen und gesund zu werden, obwohl es mein allergrößter Traum ist, ein normales Gewicht zu haben; dass zu essen, worauf ich gerade Lust habe und vor allem auch, so viel ich davon essen möchte. Eine Ausbildung zu machen. Nicht mehr ununterbrochen an Essen, Kalorien und Gewicht denken. Kurz: Ein normales, geregeltes Leben zu führen und nicht ständig eine Achterbahnfahrt der Gefühle und Gedanken erleben zu müssen.
Aber irgendetwas in meinem Gehirn blockiert mich dabei.
Im Grunde genommen sind es ja auch nur irgendwelche Zahlen, die die Waage anzeigt. Stinknormale Zahlen, die mir das Leben zur Hölle machen. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, ohne diese Zahlen zu leben, obwohl ich es gerne möchte.
Ich hasse meinen vernarbten Körper. Es gibt niemanden, den ich mehr hasse als mich selbst. Und doch mag ich keine Narbe missen, denn jeder Schnitt hat seine eigene Geschichte. Er ist wie eine Erinnerung und gleichzeitig der Spiegel zu meiner Seele, die mindestens genauso viele Narben hat.
Kein Mensch, der kein Borderliner ist, kann nachvollziehen, warum sich jemand freiwillig mit einer Rasierklinge oder einem anderen scharfen Gegenstand so tief ins eigene Fleisch schneidet, dass es genäht werden muss.
Genauso wenig wie nur ein Essgestörter verstehen kann, dass man vor einem vollen Kühlschrank verhungert oder sich erst den Magen vollfrisst (von Essen kann da keine Rede mehr sein) und anschließend alles wieder auskotzt. Deshalb will ich mit diesem Buch versuchen, diese Verhaltensweisen verständlicher zu machen.
Mein Ziel ist es, Betroffenen mit meiner Geschichte zu zeigen, dass es Wege aus der Krankheit gibt, bzw. man lernen kann, damit zu leben. Angehörigen und Interessierten möchte ich einen kleinen Einblick in das Denken eines Borderliners und/oder Essgestörten geben. Ich hoffe, dass mir das auf den kommenden Seiten gelingt. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen ein wenig Hoffnung schenken, Mut weiterzukämpfen oder Menschen zum Nachdenken anregen. Was auch immer dieses Buch mit dir macht: Ich wünsche mir, dass es auf positive Weise deinen Alltag bereichert.
Freundliche Grüße
Laura
Allgemeines über Borderline und Essstörung
Borderline
„Borderline“ oder auch „emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs“ genannt, ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität der Stimmung, des Selbstbildes und innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen gekennzeichnet ist. In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Menschen davon betroffen. Meistens sind es Frauen.
Ursachen der Erkrankung können genetische Veranlagungen und/oder Umwelteinflüsse wie sexueller Missbrauch, Gewalt in der Familie oder andere traumatische Erlebnisse sein.
Viele Forscher gehen inzwischen davon aus, dass der Grundbaustein für ein Borderlinesyndrom meist schon im Kindesalter gelegt wird. Die häufigste Ursache hierfür ist ein Trauma in der Kindheit oder Jugend. Aber einen genauen Auslöser, der zu 100 Prozent zu der Diagnose führt, ist noch nicht gefunden, denn es gibt auch Menschen, die ein Trauma erlebt haben und nicht an Borderline erkranken oder umgekehrt, die noch nie ein Trauma durchlebt haben und trotzdem Borderline-Symptome entwickelt haben.
Die endgültige Diagnose kann erst mit Erreichen des 18. Lebensjahres gestellt werden, da erst zu diesem Zeitpunkt die Persönlichkeit vollständig entwickelt und gefestigt ist. Zuvor ist es lediglich ein Verdacht.
Typische Merkmale der Diagnose sind die Art, wie Betroffene ihre Gefühle wahrnehmen (Betroffene nehmen ihre Gefühle um ein Vielfaches stärker wahr als Nicht-Betroffene) und das für Borderline typische „Schwarz-weiß-Denken“. Das heißt, dass Betroffene meist ihre komplette Lebenswelt in zwei Extreme (zum Beispiel gut oder schlecht, ganz oder gar nicht – eben schwarz oder weiß) unterteilen. Die bunten Farben, die zwischen diesen Extremen liegen, sind für sie nur schwer bis gar nicht erkennbar.
Um die Diagnose Borderline zu stellen, müssen mindestens fünf der neun für die Diagnose festgelegten Kriterien über einen längeren Zeitraum auf die Person zutreffen. Diese neun Diagnosekriterien lauten:
1. Starkes Bemühen tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden (Betroffene zeigen starke Verlassensängste und können nur schwer alleine bleiben),
2. Ein Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und der Entwertung gekennzeichnet ist (Unfähigkeit eine Beziehung konstant aufrecht zu erhalten),
3. Identitätsstörung: Ausgeprägte und anhaltende Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung (Betroffene wissen nicht, wer sie sind und haben meist ein sehr negatives, von Selbsthass geprägtes Selbstbild),
4. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen z.B. Geldausgeben, Sexualität, rücksichtsloses Fahren, Substanzmissbrauch, zu viel beziehungsweise zu wenig essen (Betroffene leben ohne Rücksicht auf Verluste und handeln impulsiv – ohne großartig über mögliche Folgen nachzudenken),
5. Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen oder Selbstverletzungsverhalten,
6. Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (Betroffene reagieren äußerst sensibel auf innere und äußere Reize, deshalb ist ihre Stimmung oft unausgeglichen. Eine Kleinigkeit kann eine regelrechte Kette von Gefühlen auslösen),
7. Chronisches Gefühl von Leere,
8. Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die eigene Wut zu kontrollieren,
9. Vorübergehende durch Belastung ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome (Besonders in Stresssituationen haben einige Betroffene das Gefühl, nicht in ihrem eigenen Körper zu sein und dissoziieren).
Unabhängig von diesen Diagnosekriterien können noch weitere Symptome beziehungsweise Krankheitsbilder auftreten. Zum Beispiel lassen sich bei ca. 80 Prozent der von Borderline-Betroffenen, Depressionen feststellen, ca. 14 Prozent leiden an einer Essstörung und nach neuesten Studien gehen Forscher davon aus, dass knapp 50 Prozent ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivitätsstörung haben. Das heißt, sie sind leicht abzulenken, besitzen nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, haben Probleme, sich lange auf eine einzelne Sache zu konzentrieren und einen hohen Bewegungsdrang. Außerdem sind häufig Suchtverhalten und oder Substanzmittelmissbrauch, Ängste, Zwänge, gestörtes Sozialverhalten, Schlafstörungen oder Kontaktarmut beziehungsweise Abbruch sämtlicher Kontakte zu beobachten.
Hinweis: Auch wenn es durch Medien häufig so verbreitet wird: Borderline ist nicht gleichzusetzen mit Selbstverletzung. Zwar verletzen sich viele Betroffene selbst – aber bei Weitem nicht alle. Genauso wenig, wie es bedeutet, dass jeder, der sich selbst verletzt, zwangsläufig die Diagnose Borderline haben muss. Selbstverletzung kann bei vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern oder unter anderem auch in der Pubertät vorkommen. Dementsprechend ist es kein eindeutiges Merkmal der Diagnose!
Magersucht
„Anorexia nervosa“ ist der Fachbegriff für Magersucht. Rund 0,7 Prozent der Deutschen leiden an Magersucht. Der größte Teil der Betroffenen ist weiblich, allerdings erkranken auch immer mehr Männer daran.
Die Erkrankten weisen meist eine Körperschemastörung auf. Sie haben Untergewicht und nehmen sich trotzdem als zu dick wahr. Sie sind sehr leistungsorientiert und haben oft ein niedriges Selbstwertgefühl. Ihre Gedanken kreisen häufig um Ernährung, Gewicht und Körperschema. Ein weiteres Zeichen der Diagnose ist die selbst herbeigeführte Gewichtsabnahme durch Verminderung der Nahrungsaufnahme, Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln oder extremen Sport. Magersüchtige meiden hochkalorische Nahrungsmittel. Die Krankheit hat schwere körperliche Folgen, wie niedrigen Blutdruck, verlangsamten Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Blutarmut, fehlende Elektrolyte im Blut, Hormonstörungen, Unfruchtbarkeit, Osteoporose, Verstopfung oder Nierenversagen, um nur die häufigsten Auswirkungen zu nennen. 15 Prozent der Erkrankten sterben an den Folgen, fast die Hälfte kann geheilt werden und bei dem Rest wird die Krankheit chronisch. Die Rückfallquote ist hoch.
Auslöser können familiäre Probleme, mangelndes Selbstwertgefühl und/oder Selbstbewusstsein, gesellschaftliche und/oder kulturelle Aspekte, wie das heutige Schlankheitsideal, ein Trauma oder genetische Faktoren sein.
Bulimie
An Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht) leiden in Deutschland rund 600.000 Menschen. Ca. 90 Prozent der Betroffenen sind weiblich. Meistens sind sie normalgewichtig. Sie können allerdings auch Unter- oder Übergewicht haben. Das typische Merkmal der Krankheit sind Heißhungerattacken, bei denen Unmengen von Lebensmitteln gegessen werden. Anschließend werden Maßnahmen ergriffen, um die Gewichtszunahme zu vermeiden. Diese können sein: Selbst induziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführ- und/oder Brechmitteln, exzessiver Sport, Hungern oder Diäten. Die Heißhungerattacken können unterschiedlich oft auftauchen. Es kann sein, dass sie mehrmals täglich oder wochenlang gar nicht auftreten. Viele Betroffene litten zuvor an Magersucht. Bulimiker haben meist eine gestörte Selbstwahrnehmung und/oder eine Körperschemastörung. Anders als bei der Magersucht, nehmen sich Betroffene meist nur mit Normalgewicht als zu dick wahr, nicht im Untergewicht.
Auch die Bulimie hat schwere körperliche Folgen. Die Magensäure beim Erbrechen greift den Zahnschmelz an und es kommt zu Karies, Störung des Elektrolyt-Haushaltes (Bsp.: Kaliummangel), Anschwellen und Entzündung der Speicheldrüsen, Entzündung der Speiseröhre, Herzrhythmusstörungen, Nierenversagen, Osteoporose, Magenerweiterung und Magenruptur. Auch hier nenne ich nur die häufigsten Folgen.
Auf lange Sicht können nur gut ein Drittel der Betroffenen langfristig komplett geheilt werden. Bei vielen tritt eine Verbesserung auf, aber bei einigen wird die Krankheit chronisch.
Achtung:Dies sind nur die wichtigsten Fakten zu den Krankheiten. Eine ausführliche Beschreibung würde den Rahmen des Buches sprengen. Weitere, detailliertere Informationen finden Sie in Fachbüchern oder im Internet.
1. Was bedeuten die Diagnosen für mich
Was bedeutet Borderline für mich?
Borderline bedeutet für mich, täglich eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu erleben. Es ist, als würde ich in einem außer Kontrolle geratenem Zug sitzen, bei dem die Notbremse defekt ist. Mit Borderline zu leben, ist wie sterben und trotzdem weiterleben, aufgeben und gleichzeitig weiterkämpfen, ein Leben voller Gegensätze. Meine Gefühle widersprechen sich ständig.
Ich hasse die Menschen, die ich am meisten liebe. Wenn ich jemanden mag, möchte ich mit ihm zusammen sein, aber ich halte seine Nähe häufig nicht lange aus. Ich möchte in den Arm genommen, doch gleichzeitig nicht angefasst werden. Ständig lebe ich mit der Angst, die Menschen zu verlieren, die ich am meisten liebe. Obwohl ich sie über alles mag, verletze ich sie oft grundlos mit meinen Worten, weil ich ihre Nähe nicht ertragen kann. Es gibt sogar Momente, in denen ich sie hasse, doch gleichzeitig könnte ich es nicht aushalten, wenn sie mich alleine lassen würden. Ich habe Angst vor Nähe, aber gleichzeitig mindestens genauso große Angst, verlassen zu werden. Es kann passieren, dass ich in einem Raum voller Menschen stehe und ich mich trotzdem völlig einsam fühle. Also ein komplettes Gefühlschaos!
Des Weiteren kommt hinzu, dass ich als Borderliner alle Gefühle um ein Vielfaches stärker wahrnehme als Nicht-Betroffene. Das heißt, ich bin nicht nur glücklich, sondern überglücklich, nicht nur traurig, sondern direkt zu Tode betrübt. Etwas dazwischen gibt es für mich nicht.
Dank Borderline wird mein Leben nie langweilig. Es gibt immer Action! Nie weiß ich, was mich in den nächsten fünf Minuten erwartet.
Es gibt Tage, da verfluche ich mein Leben, die Diagnose, meine Persönlichkeit und alles, was sich in einem Umkreis von 50 Kilometern um mich herum befindet, wird direkt als „Scheiße“ abgestempelt und verflucht (ohne dass ich es mir vorher überhaupt angeschaut habe). Und es gibt Tage, an denen ich das Leben mit Borderline wirklich genieße. Ich genieße es dann nicht nur glücklich (so wie „normale“ Menschen) zu sein, sondern überglücklich. Ich sehe es nicht als „Strafe“ an, hyperempfindlich auf jegliche Emotionen zu reagieren, sondern als Begabung.
Also kurz zusammengefasst: Leben mit Borderline heißt für mich, auf eine ganz spezielle Art besonders zu sein. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer. So etwas wie Routine oder normaler Alltag ist mit der Diagnose nicht oder nur bedingt möglich.
Auf gewisse Weise bedeutet Borderline auch manchmal für mich, im eigenen Körper gefangen zu sein. Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, innerlich zu explodieren. Ich habe dann so eine wahnsinnige Wut in mir und weiß nicht, wie ich sie wieder loswerden kann. Ich werde unruhig und angespannt und das löst den Druck zur Selbstverletzung in mir aus. Jeder Schnitt in die eigene Haut ist dann wie eine Art Befreiung für mich.
Borderline bedeutet für mich, einen täglichen Kampf zu führen, um ein bisschen Halt im Leben zu finden und mich im Alltag zurechtzufinden.
Borderline bedeutet, ständig an mir zu arbeiten. Ich muss vieles (wieder) erlernen, was für andere Menschen selbstverständlich ist, wie zum Beispiel sich selbst zu lieben und vor allem sich, selbst zu verzeihen. Jeder Tag ist harte Arbeit. Es geht immer auf und ab, nie ist ein Tag wie der andere.
Außerdem heißt es, dass ich selbst im Sommer lange Kleidung tragen muss, wenn ich nicht von allen Leuten angestarrt werden will. Mein gesamter Körper ist übersäht mit tiefen Narben und viele Menschen schreckt dieses Bild ab. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, deshalb reagieren sie oft mit Ablehnung.
Borderline ist eine tägliche Gratwanderung auf einem schmalen Drahtseil. Jeder Windstoß oder jeder Fehltritt kann ein Absturz in die Tiefe bedeuten.
Was bedeuten die Essstörungen für mich?
Magersüchtig zu sein, bedeutet für mich, in den Spiegel zu schauen und mich auch dann noch zu dick zu fühlen, wenn ich bereits starkes Untergewicht habe und eigentlich nur noch aus Haut und Knochen bestehe. Selbst dann sehe ich an meinem abgemagerten Körper noch Fettpolster.
Magersüchtig zu sein, bedeutet, immer noch dünner sein zu wollen. Ich setze mir ein Zielgewicht, und wenn ich es erreicht habe, setze ich mir ein noch niedrigeres Zielgewicht und so weiter. Es ist nie zu wenig, sondern immer zu viel.
Begonnen hat die Magersucht bei mir mit einer harmlosen Diät, doch recht bald wurde diese harmlose Diät zu einer schweren Erkrankung. Eine Krankheit, die mir das Leben zur Hölle machte. Ich hatte die vollkommene Kontrolle über mich und meine Gedanken verloren.
Magersüchtig zu sein, bedeutet jedoch nicht, gar nichts zu essen. Ganz im Gegenteil: Jeder Magersüchtige kann riesige Mengen verzehren. Das heißt, solange es sich um fett- und kalorienarme Rohkost handelt wie zum Beispiel ein Kilo Karotten (300 Kalorien), ein Kilo Tomaten (200 Kalorien) oder einen Salatkopf ohne Dressing (ca. 60 bis 80 Kalorien).
Die Waage ist der Mittelpunkt meines Lebens. Jeden Tag wiege ich mich, manchmal auch mehrmals. Habe ich zugenommen, fühle ich mich schlecht. Habe ich abgenommen, fühle ich mich leicht und gut.
Magersucht zu haben bedeutet für mich mit starken Bauchschmerzen, die vom ständigen Hunger kommen, abends einzuschlafen und morgens aufzuwachen.
Ich erlaube mir, immer weniger zu essen, bis nur noch Salat ohne Dressing übrig war. Ich entwickelte eine gigantische Angst vor Fett und Kalorien. Zeitweise fürchtete ich, dass ich von einem Brötchen oder sonst einer Kleinigkeit, die ich essen würde, sofort drei Kilo mehr auf der Waage hätte.
Doch durch den ständigen Verzicht entstand recht schnell ein fürchterlicher Heißhunger auf genau die Lebensmittel, die ich mir eigentlich verbot. Irgendwann verliere ich die Kontrolle über mich selbst und stopfe alles in mich hinein, was ich mir sonst verwehre. Aber nicht nur ein bisschen, sondern tütenweise, bis ich das Gefühl habe, das mein Magen gleich platzt. Mit einem kugelrunden Bauch, der aussieht wie ein Schwangerschaftsbauch im fünften Monat, wanke ich nach dem Fressanfall zur Toilette und übergebe mich. Ich stecke mir nicht nur den Finger in den Hals, sondern die gesamte Hand, bis nur noch Galle herauskommt. Anschließend fühle ich mich extrem schlecht und ich habe einen fürchterlichen Hass auf mich selbst. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht stark geblieben bin, sondern die Kontrolle über meinen Körper verloren habe.
Zusätzlich bedeutet die Essstörung für mich, Sport bis zur völligen Erschöpfung und darüber hinaus zu treiben. Nur damit ich noch mehr Kalorien als sowieso schon verbrenne.
Selbst wenn man die Kontrolle schon längst verloren hat, glaubt man, sie noch zu haben. Man denkt, dass man jederzeit mit dem Hungern und Erbrechen aufhören kann, wenn man wirklich will, was aber nicht der Fall ist. Man belügt sich selbst.
Eine Essstörung zu haben ist wie Selbstmord auf Raten. Man führt einen erbitterten Kampf gegen den eigenen Körper.
Auf der anderen Seite gibt die Essstörung allerdings auch Sicherheit und Halt.
Alles ist berechenbar und überschaubar.
Ich habe Regeln, an die ich mich halte. Wenn ich sie breche, weiß ich auch, was passiert. Esse ich zu viel, bestraft mich die Waage am nächsten Tag. Halte ich mich jedoch an die Gesetze, erreiche ich meine Ziele. Die reale Welt ist viel komplizierter und sprunghafter. In meiner essgestörten Welt habe ich die Kontrolle über das, was passiert. In der realen Welt ist es fast unmöglich, alles zu kontrollieren.
Magersüchtig zu sein, heißt für mich, dass ich jeden Tag einen Kampf gegen das Essen und vor allem gegen mich selbst führe. Durch das Untergewicht war ich zeitweise sehr schnell erschöpft und dauernd müde. Ich konnte mich nicht konzentrieren und auch ansonsten fehlten mir der Antrieb und die Motivation.
Im Endeffekt bedeutete die Essstörung für mich, eine lange Therapie zu machen.
Mit mühseliger Kleinarbeit muss ich nicht nur das Essen wieder erlernen, sondern auch das Hunger- und Sättigungsgefühl. Mehrere Klinikaufenthalte sind bei einer Essstörung „normal“.
Durch das starke Untergewicht der Magersucht friert man extrem. Selbst im Sommer. Gleichgültig wie warm und dick man sich anzieht oder wie hoch die Außentemperatur ist: Man friert trotzdem weiter. Denn die Kälte kommt von innen heraus.
2. Mein Leben vor der Krankheit
An mein Leben vor der Krankheit kann ich mich nur noch schemenhaft erinnern. Zu lange ist es her, dass mein Leben (halbwegs) „normal“ verlaufen ist und ich nicht ständig das Gefühl hatte, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Mittlerweile erlebe ich bereits seit fast 10 Jahren ein ewiges Auf und Ab. Tagtäglich fahren meine Emotionen Achterbahn und immer, wenn ich das Gefühl habe, dass es „gut“ läuft, ich zufrieden bin und denke, dass es so bleiben kann, kommt irgendein Idiot und macht mir alles wieder kaputt … (Manchmal – oder eigentlich meistens, bin ich selbst dieser Idiot). Wie mein Leben ohne das ständige Gefühlschaos, meinen (größtenteils unbegründeten) Selbsthass, die gefühlten 1000 Probleme und Sorgen und dem restlichen „Wahnsinn“ in meinem Kopf ausgesehen hat, weiß ich nicht mehr. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn ich schon immer „anders“ als alle anderen Menschen auf dieser Welt gewesen wäre. Ich habe mich noch nie „normal“ gefühlt. Seitdem ich denken kann, fühle ich mich wie ein Fremdkörper. Ich bin zwar da, sehe so aus wie alle anderen Menschen auf diesen Planeten, aber bin trotzdem „anders“. Ich passe nicht in das „übliche Menschenbild“. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Was genau mit mir nicht richtig ist, kann ich nicht sagen, aber ich spüre es. Schon im Kindergarten war ich nicht so, wie die restlichen Kinder in meinem Alter und auch heute noch unterscheide ich mich von anderen Menschen. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich gelernt habe, dass „anders sein“ nicht zwangsläufig negativ ist. Manchmal hat es auch Vorteile, nicht so zu sein wie der Rest der Menschheit.
Einfach hatte ich es noch nie im Leben. Schon in der Grundschule wurde ich gemobbt. Ich gehörte nie zu den Menschen, die besonders beliebt waren, 100.000 Freunde hatten, von jedem zur Begrüßung umarmt und/oder geküsst wurden etc. – aber ich hatte immer zwei oder drei engere Freundinnen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die Pausen verbracht und manchmal auch nach der Schule getroffen habe. Doch wenn mich meine Mitschüler mobbten, hatte ich plötzlich keine Freunde mehr. Dann war ich vollkommen auf mich alleine gestellt. Alle standen um mich herum, schauten zu und niemand kam auf die Idee, für mich Partei zu ergreifen. Selbst meine (angeblichen) Freundinnen standen in solchen Situationen nicht mehr zu mir … Und auch die Lehrer schauten gekonnt in die andere Richtung, wenn ich von meinen Mitschülern (mal wieder) beleidigt, beschimpft, gehänselt und/oder gedemütigt wurde. Es interessierte niemanden, wie es mir dabei ging, ob mich die Worte verletzten, ob ich geschlagen, getreten oder sonstiges wurde. Ich glaube, dass bereits zu dieser Zeit mein Wunsch, zu verschwinden, entstand. Ich wollte mich einfach in Luft auflösen, nicht mehr da sein und aus der „Hölle“ namens Leben entfliehen. Ich hatte das Gefühl, das egal, was ich machte, sowieso alles falsch war. Ich fühlte mich zu nichts zu gebrauchen, wertlos, nutzlos und vollkommen fehl am Platz. Ich gehörte nicht dazu und war ein Außenseiter. Tagtäglich wurde mir von meinen Mitschülern aufs Neue das Gefühl vermittelt, dass ich unerwünscht und wertlos wäre. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung und damit meine ich nicht nur die blauen Flecken. Denn Worte können oftmals viel verletzender sein als körperliche Gewalt. Doch egal, was passierte – ob ich geschlagen, getreten, gehänselt, beleidigt oder ausgelacht wurde – ich suchte schon damals - wie auch heute noch) jedes Mal die Schuld bei mir und nie bei anderen. Selbstvertrauen besaß ich nicht und Selbstwertgefühl war ebenfalls ein Fremdwort für mich. Nach der Grundschule wechselte ich auf die Realschule. Anfangs hatte ich die Hoffnung, dass es dort mit dem Mobbing besser werden würde – doch diese Erwartung wurde bereits nach wenigen Wochen zerschlagen. Es verbesserte sich nicht, sondern wurde schlimmer. Wann immer es eine Schlägerei gab – ich war mittendrin.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich einen Stempel mit der Aufschrift „OPFER“ auf die Stirn gestempelt hätte. Ich war so etwas wie ein Antistressball für die gesamten Schüler meiner Altersstufe. Wenn jemand schlechte Laune hatte, frustriert und/oder gestresst war oder einfach mal „Bock“ hatte, seine Aggressionen rauszulassen und jemand anderes niederzumachen, kam er zu mir. Mit mir konnte man es schließlich machen.
Warum ich ständig der Sündenbock für alle und jeden war und gemobbt wurde, weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass ich mich nie gewehrt habe. Ich war ein perfektes Opfer. Nie habe ich zurückgeschlagen oder bin zu einem Lehrer/ einer Lehrerin gerannt und habe irgendjemanden verpetzt. Ich schwieg immerzu.
Selbst zu Hause erzählte ich kaum etwas von dem Mobbing in der Schule. Ich wollte weder meine Eltern noch irgendwelche anderen Personen mit meinen Problemen und Sorgen belasten. Stattdessen versuchte ich, alleine damit fertig zu werden. Ich wollte „stark“ sein und nicht als Feigling dastehen.
Mit der Zeit legte ich mir eine Art Schutzpanzer zu, der Beleidigungen, Schimpfworte und doofe Kommentare einfach abprallen ließ. Niemand sollte mich beziehungsweise meine Gefühle mehr verletzen können. Zusätzlich stürzte ich mich ins Lernen, um mich abzulenken. Jede freie Sekunde verbrachte ich damit, für die Schule zu pauken. Ich wollte Klassenbeste werden und hoffte dadurch (endlich) die Anerkennung von meinen Mitschülern zu bekommen, nach der ich mich sehnte. Ich wollte nicht länger die Rolle der Außenseiterin oder des Sündenbocks in der Klasse spielen, sondern endlich (!!!) dazugehören. Ich wollte auch beliebt sein, anerkannt und akzeptiert werden, Aufmerksamkeit bekommen, viele Freunde haben und jeden Morgen von der gesamten Klasse freudestrahlend begrüßt werden. Ich dachte, dass ich mir durch gute Noten die Anerkennung meiner Mitmenschen „erarbeiten“ könnte, und bildete mir ein, dass wenn ich Klassenbeste wäre, nicht mehr gemobbt werden würde, sondern alle meine Freunde sein wollten. Doch leider war dem nicht so. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, wie sehr ich mich bemühte und wie gut meine Noten waren – ich wurde weiterhin gemobbt, ausgegrenzt und nun sogar noch als Streberin beschimpft. Lediglich zum Hausaufgabenabschreiben war ich gut genug.
Trotzdem tat das meinem Streben nach guten Noten und den besten Klausuren der Klasse keinen Abbruch. Vielleicht ging mein Plan, mir die Anerkennung meiner Mitschüler durch gute Noten zu „erarbeiten“, nicht ganz auf, aber dafür wurde ich nun regelmäßig von den Lehrern und meinen Eltern für meine guten schulischen Leistungen gelobt. Das war für mich auch eine Art von Anerkennung und Bestätigung. Zwar bekam ich das Lob und die Aufmerksamkeit nicht von den Leuten, von denen ich sie gerne gewünscht hätte – aber immerhin wurde ich nun wenigsten von irgendwem beachtet und gelobt!
Ich genoss das Gefühl „auf die Schulter geklopft zu bekommen“, gelobt zu werden und gesagt zu bekommen, dass ich intelligent sei, viel gelernt hätte und (mal wieder) die beste Klausur der Klasse geschrieben hätte. Es tat gut, beachtet zu werden und von den Lehrern mitgeteilt zu bekommen, dass ich eine gute Schülerin sei, super Leistungen erbringe und es Freude mache, mich zu unterrichten. Das gab mir das Gefühl, dass ich doch nicht ganz so doof und unnütz war, wie ich die gesamte Zeit von mir selbst gedacht hatte, sondern auch zu etwas fähig war. Ich war nicht länger ein „niemand“, der die gesamten Schulstunden über still und regungslos in der hintersten Ecke saß, nie beachtet wurde, eigentlich gar nicht auffallen würde, wenn nicht regelmäßig sein Name beim Aufrufen der Klassenliste zur Anwesenheitskontrolle fallen würde – sondern ich war jetzt Klassenbeste! Außerdem war das Lernen für mich wie eine Flucht aus der realen Welt. Wenn ich für die Schule gelernt habe, dann musste ich mich auf den Unterrichtsstoff konzentrieren und hatte somit keine Zeit, mir über mein (beschissenes, sinnloses) Leben Gedanken zu machen. So konnte ich (zumindest für eine Weile) meine Probleme und Sorgen vergessen beziehungsweise verdrängen. Es war für mich, wie wenn ich gedanklich in eine andere, bessere Welt abtauchen würde, in der die einzigen „Probleme“ binomische Formeln, Rechtschreibung, Englischvokabeln etc. waren. Allerdings bargen dieses extreme Streben nach guten Noten und exzessive Lernen auch dunkle Schattenseiten. Schon nach kurzer Zeit fing ich an, mich selbst einem immensen Leistungsdruck auszusetzen. Ich war nur noch mit den Noten Eins und Zwei zufrieden. Bereits die Note Drei war für mich eine schlechte Note und die Note Vier war für mich so schlecht, wie für andere Schüler die Note Sechs. Sobald ich nicht die beste Klausur der Klasse geschrieben hatte oder schlechter als zwei war, fühlte ich mich als absolute Versagerin und begann mich in Gedanken selbst niederzumachen. Ausschließlich, wenn ich die Beste war und/oder für meine gute Leistung gelobt wurde, war ich halbwegs zufrieden mit mir und konnte so etwas wie ein Hauch von Stolz verspüren. Jedoch hielt dieses Gefühl meist nicht lange an … Denn ich war der Auffassung, dass Anerkennung, Lob und gute Leistungen nichts Beständiges waren, sondern ständig neu verdient werden mussten. Ich hatte das Gefühl, mich jeden Tag aufs Neue frisch beweisen zu müssen. Ich konnte, wollte und durfte nicht nachlassen! Ich durfte mir keinen „Ausrutscher“ leisten und eine Klausur in den Sand setzen, denn dann wäre ich wieder – so meine Gedanken – das unscheinbare Mädchen, das in der hintersten Ecke des Klassensaales sitzt und von niemandem (nicht einmal von den Lehrern) beachtet werden würde.
Schon damals hatte ich große Angst zu versagen, Fehler zu machen, Anforderungen nicht standzuhalten und die Vorstellungen anderer nicht erfüllen zu können. Obwohl ich vom Verstand her wusste, dass es keinen „perfekten Menschen“ gibt, der nie Fehler begeht, alles beherrscht und bei jeden beliebt ist – strebte ich trotzdem (bereits zu dieser Zeit schon) nach extremem Perfektionismus. Egal was ich machte: Ich wollte es nicht nur gut, sondern sehr gut – nahezu perfekt - machen. Fehler wollte und durfte (!) ich mir nicht (mehr) erlauben.
Meine Angst ging sogar so weit, dass ich eigene Wünsche und Bedürfnisse zurücksteckte und mich verbog, um es anderen Menschen recht zu machen beziehungsweise keinen Fehler zu begehen.
Wenn mich zum Beispiel jemand um etwas gebeten hatte, konnte ich nur schwer „Nein“ sagen, weil ich Angst hatte, die Person zu verletzen oder ihre Vorstellungen von mir nicht zu erfüllen. Ich hatte panische Angst davor, meine Mitmenschen zu enttäuschen und fürchtete, dass – falls ich doch Mal einen Fehler machte - jeder merken, würde wie dumm und unfähig ich in Wirklichkeit war.
Ich tat alles dafür, dass niemand mitbekam, dass ich gar nicht so „perfekt“ war, wie ich nach außen hin immer tat, sondern das alles nur Schein war und ich eigentlich gar nichts richtig konnte und „schlecht“ war. Wenn ich trotz aller Vorsicht doch einmal einen Fehler machte, war das für mich wie ein Faustschlag ins Gesicht. Ein klitzekleiner Ausrutscher oder ein falsches Wort, worüber sich im Normalfall kein Mensch Gedanken macht, konnte mich komplett aus der Bahn werfen und tagelang im Geiste verfolgen. Außerdem entschuldigte ich mich für jeden Fehltritt – egal wie winzig und unbedeutend er auch war – mehrfach.
Solange ich denken kann, habe ich mich nur dann gut und wertvoll gefühlt, wenn ich in meinem Handeln von anderen, Außenstehenden, bestätigt wurde. Ich konnte weder mich selbst wertschätzen noch anerkennen oder meinen Fähigkeiten vertrauen. Das Einzige, was ich konnte, war mich selbst noch mehr niederzumachen, als es meine Mitschüler es nicht ohnehin schon taten … Meine Einstellung war: „Wenn mich alle niedermachen, dann kann ich mich auch noch weiter niedermachen. Wenn schon am Boden – dann ganz tief am Boden.“ Deshalb waren mir Lob und Anerkennung von außen sehr, sehr wichtig. Sie gaben mir wenigstens ein paar Sekunden lang einen Hauch von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
Mein Essverhalten würde ich zu dem Zeitpunkt (noch) als durchschnittlich bezeichnen. Ich aß das, worauf ich Appetit hatte und davon so viel, wie ich wollte. Egal ob Schokolade, Chips, Nudeln und so weiter, alles aß ich, ohne über Fett und Kalorien nachzudenken. Gewogen hab ich mich so gut wie nie. Mir war mein Gewicht relativ egal. Ich war zwar alles andere als glücklich darüber, dass ich etwas mollig war, aber sah auch nicht ein, etwas daran zu ändern, denn dafür liebte ich das Essen viel zu sehr. Ich konnte mir nicht vorstellen, auf Süßigkeiten, Chips und Co zu verzichten. Außerdem behauptete meine Mutter immer, dass ich nicht dick sei, sondern lediglich viele Muskeln und schwere Knochen hätte. Allerdings war ich nicht doof und wusste sehr wohl, dass mein Körpergewicht nicht ausschließlich aus Knochen und Muskelmasse bestand, sondern auch eine Menge (überschüssiges) Fett zu meinem Gewicht beigetragen hat. Doch das störte mich – wie gesagt – recht wenig. Schließlich war ich nicht so dick, dass ich nicht mehr durch die Tür passte oder durch die Gegend rollte. Ganz im Gegenteil: Ich war während meiner Schulzeit sehr sportlich und aktiv. Mindestens einmal pro Woche ging ich regelmäßig zum Judotraining und Reiten und war auch sonst kein Bewegungsmuffel. Judo machte ich sogar schon seit meinem 5. Lebensjahr und bestritt in regelmäßigen Abständen – sehr erfolgreich – Wettkämpfe. Was eigentlich ziemlich paradox war … Denn Judo ist ein Kampfsport, bei dem man mit seinem Gegner – besonders bei Wettkämpfen – nicht gerade zimperlich umgeht. Also rein theoretisch hätte ich mich gegen die Schläge meiner Klassenkameraden wehren können, was ich jedoch nie tat. Meine Angst, dadurch jemand zu verletzen, oder alles noch viel schlimmer zu machen, war zu groß. Stattdessen litt ich jedes Mal stumm und hoffte, dass die Mobbingattacke schnell vorbei sein würde.
Selbstverletzung war zu dieser Zeit noch kein Thema in meinem Leben. Ich wusste nicht einmal, dass beziehungsweise in welchem Ausmaß es so etwas gibt. Ich kannte nur die sogenannten „Emos“, die sich die oberste Hautschicht aufritzen, weil sie Aufmerksamkeit wollen und es „cool“ finden. Mit Borderline hat das allerdings rein gar nichts zu tun!
3. Wie alles begann
Im Alter von 13 Jahren sollte sich mein Leben für immer verändern.
Heute erinnere ich mich noch genau an den Tag und an jede Einzelheit. Doch direkt nach dem Ereignis hatte ich das Erlebnis mehrere Monate lang verdrängt. Ich wusste zwar, dass etwas Schlimmes passiert war, aber konnte nicht sagen was. In meinen Kopf war die Erinnerung wie in einen dicken, undurchsichtigen Nebel eingehüllt. Sie war da, aber ich konnte nicht darauf zugreifen. Erst nach und nach lichtete sich dieser dichte Nebel und mir wurde bewusst, was geschehen war.
Von diesem Zeitpunkt an war nichts mehr so wie früher. Innerhalb weniger Minuten hatte sich mein Leben komplett verändert. Alles um mich herum schien in sich zusammenzustürzen. Nichts mehr gab mir Halt oder Sicherheit. Es war, als wenn mir jemand – ohne Vorwarnung – den Boden unter den Füßen weggerissen hätte und ich nun in ein endlos tiefes, dunkles Loch stürzen würde.
Mit einem Schlag wurde an diesem (eigentlich schönen) warmen Sommerabend meine Kindheit zerstört. Wenige Sekunden reichten aus, um mich zu einem anderen (gebrochenen?) Menschen zu machen.
Damals hatte ich das Gefühl, dass mir an diesem Tag mein Lachen, meine Fröhlichkeit, meine Hoffnung, mein Glaube an mich und den Rest der Welt … - eigentlich mein gesamtes Leben – unwiderruflich genommen wurde – doch heute weiß ich, dass es nicht so war. Ich hatte das alles nicht „verloren“ und es war auch nie komplett verschwunden, sondern ich hatte durch dieses traumatische Erlebnis lediglich vergessen, wie es sich anfühlte, glücklich zu sein.
Selbst heute noch (fast 10 Jahre danach) verfolgen mich die Bilder von der Tat. Die Erinnerung an das, was passiert ist, der Schmerz, die Wut, die Verzweiflung und der Scham haben sich in meinem Gehirn eingebrannt. Ich werde diesen schrecklichen Tag und alles, was damit verbunden ist, wohl nie vergessen … Aber mit der Zeit habe ich gelernt, mit der Erinnerung zu leben. Ich weiß, was passiert ist, wie es sich angefühlt hat und was dieses Ereignis in mir ausgelöst hat – aber ich weiß auch, dass es Vergangenheit ist, ich es nicht rückgängig machen und erst recht nicht ändern kann. Ich muss es als (negativen) Teil meiner Vergangenheit akzeptieren und lernen mit den Erinnerungen umzugehen. Und das gelingt mir inzwischen relativ gut! Doch leider war das nicht immer so. Zeitweise haben mich die Bilder in meinem Kopf fast umgebracht! Über Jahre hinweg hatte ich heftige Flashbacks, starke Schuldgefühle und jede Nacht schreckliche Albträume. Ich war deshalb sogar mehrmals kurz davor, mein Leben zu beenden …
Mein Leben war für mich nur noch eine einzige Hölle! Egal, was ich machte, die Erinnerung an diesen schrecklichen Tag verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Wie ein Schatten hatte sie sich über mein Leben gelegt und nahm mir jegliche Freude und Lebensmut. Alles um mich herum war dunkel, trostlos und ohne irgendwelche Hoffnung. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt, heute, sagen kann: „Ja, ich lebe (noch)! Und ja, ich lebe sogar inzwischen gerne! Und nein, diese „Monster“ haben mein Leben nicht für immer zerstört!“ Für mich sind diese „Menschen“, die mich an diesem Abend angefasst, ausgezogen und vergewaltigt haben, nämlich gar keine Menschen. Für mich sind es lediglich Monster! Ein Mensch hätte so etwas nicht getan! Denn ein „normaler“ Mensch besitzt Gefühle und Empathie und würde sich nicht an einem wehrlosen Kind vergreifen! Diese drei Männer, die an dem Abend über mich herfielen, hatten das eindeutig nicht! Deshalb sind SIE in meinen Augen einfach nur Monster, die keinerlei (Mit-)Gefühl und/oder menschlichen Verstand besitzen!
Ein Abend, ein Erlebnis – ja, eigentlich ein Moment – hatte ausgereicht, um mein gesamtes Leben nachhaltig zum Negativen zu verändern.
Nach der Vergewaltigung war ich nicht mehr ich selbst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber diese Tat hat einen Teil von meinem Inneren zerstört. Ich war danach nicht mehr ich. Es war, als wenn ich nur noch ein namenloser Schatten meiner selbst gewesen wäre. Ich war da, aber ich fühlte nichts. Ich wusste nicht, ob ich lebe, ob ich tot bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich glücklich oder traurig bin. Alles in mir fühlte sich einfach nur noch kalt, leer und hohl an. Da war nichts mehr in mir, was man hätte „Leben“ nennen können.
Heute kann ich mehr oder weniger offen über das, was ich erlebt habe, reden/schreiben. Aber bis vor ca. 8 Jahren fehlten mir dafür einfach die Worte. Ich schaffte es nicht, dass, was ich gesehen, gefühlt und gedacht hatte, in Worte fassen. Irgendetwas in mir schrie zwar, dass ich darüber reden müsste, um das Erlebte zu verarbeiten – doch sobald ich den Mund öffnete, legte sich eine schwere, enge Eisenkette um meinen Brustkorb und nahm mir die Luft zum Atmen. Ich wollte reden, doch brachte kein Wort über die Lippen.
Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis ich die Kette und somit auch mein Schweigen über diesen Abend durchbrechen und (endlich!) darüber reden konnte.
Ich war an dem besagten Abend alleine unterwegs und SIE waren zu dritt. SIE gingen mit mir auf dieselbe Schule, doch bis zu diesem Abend kannte ich SIE lediglich vom Sehen auf dem Schulhof in den Pausen. Ich war zu diesem Zeitpunkt erst 13 und SIE waren um einiges älter und somit auch stärker als ich.
Nie hätte ich gedacht, dass mir so etwas passieren könnte … Nie hätte ich damit gerechnet, dass ich auf der Damentoilette abgefangen, von drei Männern überrumpelt, ausgezogen und vergewaltigt werden könnte. Nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir so etwas Grausames vorstellen können! Doch genau das passierte mir an diesem Abend …
Ich war gerade auf Toilette gewesen und wollte mir meine Hände waschen, als DIE plötzlich hinter mir standen und mir den Weg zur Tür versperrten.
(Auf das, was genau passiert ist, möchte ich nicht im Detail eingehen, denn meiner Meinung nach ist das kein Thema, das man besonders detailreich beschreiben und ausschmücken muss.)
Allein der Gedanke an das, was damals passiert ist, lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen und alle Haare an meinem Körper zu Berge stehen. Noch immer löst der Gedanke an die Tat Panik und Angstzustände bei mir aus. Obwohl ES schon Jahre her ist, ist die Erinnerung daran noch so frisch, als wäre es erst gestern gewesen. Noch immer spüre ich den heißen Atem, der an meinen Hals dringt, die eiskalten Hände, die mich überall anfassen und den extremen Schmerz. Mit einem Schlag sind alle Erinnerungen, Gedanken und Gefühle von damals wieder präsent. Sofort läuft der „Film“ von der besagten Nacht in Form von Erinnerungsbildern in meinen Kopf ab. Immer wieder und wieder sehe ich die Bilder und durchlebe die Erinnerungen. Ich bin unfähig, den Film auszublenden oder anzuhalten. Es ist wie damals: Ich bin in der Situation gefangen und machtlos, mich zu wehren oder etwas zu verändern. Wie damals lasse ich es einfach über mich ergehen und hoffe und bete, dass es schnell vorbeigeht …
Während SIE über mich herfielen, hatte ich Todesangst. Ich dachte, dass ich gleich sterben würde …
Ich glaube, für einen Außenstehenden ist es kaum begreiflich und/oder nachvollziehbar, was ein Mädchen/eine Frau in solch einer Situation fühlt. Denn das ist unmöglich, in Worte zu fassen.
Man möchte sich gegen SIE wehren, will das ES aufhört, wünscht sich, dass ES endlich vorüber ist, will fliehen, weglaufen, schreien, um sich schlagen – aber das Einzige, was man macht, ist regungslos am Boden liegen, die Augen schließen und beten, dass ES schnell vorbei geht. Oder man schweißgebadet aufwacht und feststellt, dass das alles nur ein schrecklicher Albtraum war … Es ist so gut wie unmöglich, sich als Betroffener in solch einer Situation zu wehren. Man ist wie erstarrt vor Angst und Scham.
SIE sprachen von Liebe. Felsenfest behaupteten SIE, dass ich ES doch auch wollen würde und ES mir genauso Spaß machen würde wie ihnen. Eine Stimme in meinem Kopf sagte mir zwar, dass Liebe nicht wehtun sollte und dass DAS, was DIE mit mir machten, auf gar keinen Fall etwas mit Liebe zu tun hatte, aber diese Stimme war nur sehr, sehr leise und unsicher. Die Worte der Täter und meine Scham waren viel größer und lauter. Sie verdrängten die leise, unsichere Stimme in meinem Kopf. Zwangsläufig ließ ich die Aussagen der Täter zu meiner Wahrheit werden und redete mir ein, dass ich DAS tatsächlich wollen würde und dass alles meine alleinige Schuld war. Zeitweise gingen meine Schuldgefühle sogar so weit, dass ich mich nicht mehr als Opfer, sondern selbst als „Täterin“ fühlte … Ich fühlte mich dafür verantwortlich und glaubte, dass ich es nicht anders verdient hätte.
Außerdem trichterten SIE mir ununterbrochen ein, dass mir sowieso niemand glauben würde, wenn ich mit jemandem DARÜBER reden würde. Alle würden mir die Schuld darangeben, keiner würde mir glauben und ich würde dadurch alles nur noch schlimmer machen. Denn dann müssten SIE mich noch weiter „bestrafen“. Und das glaubte ich ihnen ebenfalls.
Die Worte der Täter waren so schwer und mächtig, dass sie sich in mein Gehirn wie ein Bandwurm hineinfraßen und dort festsetzten. Alle anderen „vernünftigen“ Gedanken, mein Selbstvertrauen und meine Selbstsicherheit, die versuchten, gegen diese mächtigen Worte anzukämpfen, wurden von dem Bandwurm gefressen und somit vernichtet. Ich war wie ein „Sklave“, der alles machte, was SIE sagten und wollten. Mein eigener Wille war verschwunden.
Nachdem SIE dann endlich von mir abgelassen hatten, sich anzogen und aus dem Staub gemacht hatten, lag ich noch gefühlte zwei Stunden regungslos auf dem kalten Boden und starrte ins Leere. In Wirklichkeit dauerte ES zwar nur wenige Minuten, doch mir kam es um ein Vielfaches länger vor. Die Zeit schien für mich in diesem Moment still zu stehen. Ich fühlte mich wie tot, obwohl mein Herz weiterhin schlug … Es fühlte sich an, als wenn DIE irgendetwas in mir mit Gewalt zerstört oder herausgerissen hätten und an dieser Stelle nun ein riesiges Loch klaffen würde. In mir war einfach nur alles leer. Keine Gefühle, kein Nichts waren mehr da. Ich schaffte es nicht einmal mehr, zu weinen. Ich kam mir vor wie ein Haufen Dreck. Ich wurde benutzt, zu Boden geschmissen, durch den Matsch gezogen und anschließend wie unbrauchbarer, wertloser Müll am Boden liegen gelassen … Ich fühlte mich nicht mehr als Mensch.
Allgemein passierte an diesem Abend etwas äußerst Merkwürdiges mit mir und meiner Gefühlswelt. Als SIE über mich herfielen, hatte ich plötzlich das Gefühl, nicht mehr in meinem Körper zu sein. Ich sah das Geschehen wie eine dritte Person von außen. Es kam mir vor, als wenn ich über dem Szenario schweben und alles aus der Vogelperspektive beobachten würde. Ich sah ein verängstigtes Mädchen am Boden liegen und drei Männer, die wie wilde Tiere über sie herfielen. SIE zogen das Mädchen aus und vergewaltigten sie. Das Mädchen weinte und hatte panische Angst.
Ich wusste zwar, dass ich das Mädchen am Boden war, aber es fühlte sich nicht so an.
Heute weiß ich, dass meine Seele an diesem Abend dissoziiert ist. Das heißt, sie hat sich vom Körper abgespalten, um sich vor schlimmeren Verletzungen und Schäden zu schützen. Sie musste das tun, um zu überleben. Inzwischen bin ich meiner Seele für diese Reaktion sehr dankbar, doch an dem Abend fand ich diesen Vorgang einfach nur beängstigend, merkwürdig, sonderlich und verstörend.
Wenn ich diesen schrecklichen Tag in meinem Leben mit vier Sätzen beschreiben müsste, würde ich sagen: An diesem Tag sind drei Monster mit einer Dampfwalze über mein Leben gefahren. SIE haben alles zerstört, was ich mir in dreizehn Jahren mühsam aufgebaut hatte und haben nur noch ein einziges Schlachtfeld zurückgelassen. Meine Seele bekam lebenslänglich und die Täter blieben weiterhin frei und lebten weiter wie zuvor. Mein Leben war nach dem Übergriff nur noch ein einziger Scherbenhaufen.
4. Geprägt
Immer mehr und mehr zog ich mich von meiner Umwelt zurück. Ich konnte die Gesellschaft von anderen Menschen einfach nicht mehr ertragen. In jeder freien Minute suchte ich die Einsamkeit, aber gleichzeitig schien mich dieses ständige Alleinsein nur noch tiefer in meine Traurigkeit zu ziehen.
Ich war einfach mit allem unzufrieden und unglücklich. Meine Gefühlswelt und Gedanken spielten verrückt! Es fühlte sich an, als ob eine vollkommen fremde Macht die Kontrolle in meinem Gehirn übernommen hätte, um mein altes Ich als Geisel an einen Stuhl zu fesseln. Ich war mir selbst auf einmal völlig fremd. Ich konnte oder wollte nicht verstehen, was mit mir los war. Für meine Gedanken und Gefühle gab es keine Worte mehr. Ich schien den Verstand zu verlieren und geisteskrank zu werden!
Die drei Monate nach der Tat, in denen ich mich nicht an das Geschehene erinnern konnte, waren schrecklich für mich. Ich kam mir vor wie in einem falschen Film. Alles um mich herum wirkte merkwürdig fremd. Das Einzige, womit ich mich in dieser Zeit „trösten“ konnte, war Essen. Egal ob aus Frust, Langeweile, Angst, um Anspannung abzubauen, mich aufzuheitern oder um die endlose Leere in mir zu füllen – Essen schien ein Trostpflaster für alles zu sein. Egal bei welcher Gelegenheit, um welche Uhrzeit und ob Hunger oder nicht – ich aß den gesamten Tag, um die Leere in mir (vergeblich) zu füllen. Pausenlos stopfte ich sämtliche Süßigkeiten in mich hinein. Das spiegelte sich natürlicherweise recht schnell in meinem Gewicht wieder. Innerhalb kürzester Zeit nahm ich von 65 Kilo auf 73 Kilo zu. Zwar waren mir das viele Essen und vor allem die Zunahme äußerst unangenehm – besonders, weil mich so gut wie jeder auf mein Gewicht ansprach – aber dennoch schaffte ich es nicht, damit aufzuhören. Es war wie eine Art Sucht für mich. Essen gab mir (zumindest für einen kurzen Augenblick) das Gefühl von Zufriedenheit und lenkte mich von meinen negativen Emotionen ab.
Dann – ziemlich genau drei Monate nach der Tat – kam der Tag, an dem meine Erinnerung zurückkam. Mit wortwörtlich einem Schlag waren plötzlich alle Einzelheiten und jedes noch so kleinste Detail wieder präsent. Ich war an diesem Tag mit dem Reitstall, indem ich bereits seit Längerem ein Pflegepferd hatte, auf einem Hoffest, um dort Ponyreiten veranstalten. Den gesamten Tag über führten wir schon die Pferde und Ponys im Kreis, um so etwas Geld für die Stallkasse dazu zu verdienen. Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles reibungslos und ohne größere Zwischenfälle ab. Alle waren rundum zufrieden und es hätte nicht besser laufen können. Doch gegen Ende der Veranstaltung zog ein Gewitter auf und die Pferde begannen nervös zu werden und zu scheuen.
Eigentlich hätten wir aufgrund des herannahenden Unwetters das Ponyreiten abbrechen und die Pferde verladen sollen, doch solange es noch nicht regnete, wollten wir noch ein paar Runden weiterführen. Schließlich brauchten wir das Geld.
Doch plötzlich ertönte aus dem Nichts heraus ein sehr lauter Donner, der die Stute vor mir in große Angst versetzte. Sie scheute, rannte ein paar Schritte rückwärts und trat nach hinten aus. Dabei erwischte sie mit ihrem Hinterhuf meinen Kopf … Meine Lippe platzte auf und ich sank kurzzeitig zu Boden.
Allerdings war die Platzwunde an der Lippe noch harmlos im Vergleich zu dem, was der Tritt mit meiner Psyche anrichtete. Denn der Tritt „triggerte“ mein Gehirn wieder an und lies die Amnesie in meinem Kopf verschwinden. Die Erinnerung an DIE und DAS, was sie mir angetan hatten, war von einer auf die andere Sekunde wieder komplett da. Und das war alles andere als positiv und angenehm für mich!
Nach dem Tritt kam ich mit einer schweren Gehirnerschütterung und einer tiefen Platzwunde an der Unterlippe ins Krankenhaus, wo ich acht Tage stationär bleiben musste. Diese acht Tage im Krankenhaus kamen mir unendlich lange vor und waren für mich die reinste Qual! Ich hatte extreme Kopfschmerzen und konnte wegen der Platzwunde an der Lippe kaum etwas ohne Schmerzen essen oder trinken – aber was noch viel, viel schlimmer für mich war – war, dass ich diese verdammten Bilder in meinem Kopf nicht mehr loswurde! Sobald ich meine Augen schloss, tauchte die Erinnerung an den Tatabend auf und spielte sich wie ein Endlosfilm vor meinem inneren Auge ab. Zeitweise hatte ich das Gefühl, deshalb fast durchzudrehen!
Auf der einen Seite hätte ich deswegen am liebsten die komplette Zeit im Krankenhaus verschlafen, denn so bekam ich erstens nicht so viel von meiner Umwelt mit und zweitens konnte ich im Schlaf nicht so viel grübeln. Doch so leicht konnte ich mein „Problem“ dann leider doch nicht aus der Welt schaffen. Denn auf der anderen Seite hatte ich wiederum Angst, meine Augen zu zumachen und einzuschlafen. Sobald ich meine Augen schloss, tauchten nämlich die Bilder von DENEN und DEM, was sie mir angetan hatten, wieder auf und ich war erneut in den Erinnerungen gefangen. Und selbst wenn ich es schaffte einzuschlafen, dauerte es meistens keine zehn Minuten, bis ich erneut panisch aufschreckte, weil ich (mal wieder) einen Albtraum hatte … Also egal, was ich machte, ich konnte den quälenden Erinnerungen und den Bildern nicht entkommen. Ich war darin wie gefangen.
Selbstverständlich merkten auch meine Eltern, dass zu diesem Zeitpunkt etwas mit mir gewaltig nicht stimmte. Ich war schließlich nicht mehr Ich selbst. Seit dem Unfall war ich depressiv, lachte kaum noch, wollte nicht mehr reden und zog mich von meiner kompletten Umwelt zurück. Solch eine Verhaltensänderung konnte nicht von einem einzelnen Pferdetritt kommen. Das wussten selbst sie. Deshalb fragten sie mich bereits im Krankenhaus des Öfteren, was mit mir los sei. Jedoch schob ich weiterhin jedes Mal mein merkwürdiges Verhalten erneut auf den Reitunfall beziehungsweise die daraus resultierende Gehirnerschütterung oder leugnete sogar komplett, dass ich mich in meinem Verhalten geändert hatte.
Innerlich hätte ich am liebsten rausgeschrien, was mich bedrückte, was passiert war und wie es mir nun damit ging – doch äußerlich blieb ich weiterhin regungslos und stumm. Zu groß waren die Angst und Scham, selbst als Täterin hingestellt zu werden oder dass mir niemand glaubte. Außerdem hatte ich regelrechte Panik davor, wie DIE reagieren würden, wenn SIE erfahren würden, dass ich über ES gesprochen hatte …
Auch nach dem Krankenhausaufenthalt stabilisierte sich meine Psyche nicht wirklich. Zwar wurde es nicht schlimmer, aber es besserte sich leider auch keinesfalls. Deshalb empfahlen die Ärzte im Krankenhaus meinen Eltern, mit mir zu einem Kinder- und Jugendpsychologen zu gehen.
Anfangs war ich von diesem Vorschlag alles andere als begeistert und hatte überhaupt keine Lust, mit einer „Psychotante“ über meine Probleme zu reden. Schließlich war es mein Leben, meine Probleme und somit auch MEINE Angelegenheit, wie ich damit umging und wie ich mich verhielt. Anderseits hatte ich jedoch auch genauso wenig Lust, darüber zu diskutieren, ob es jetzt nötig sei, dass ich zu einer Psychologin gehe oder nicht. Eigentlich hatte ich nämlich zu gar nichts Lust. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich den gesamten Tag in meinem Zimmer verkrochen, ins Bett gelegt, die Decke über den Kopf gezogen und Löcher in die Luft gestarrt. Doch das ging leider auch nicht. Deshalb erklärte ich mich ohne große Widerworte dazu bereit, mir die Psychologin wenigstens einmal anzuschauen. Was allerdings nicht hieß, dass ich mich gleich mit ihr unterhalten würde!
Im Endeffekt führte die Psychologin den größten Teil der Therapiesitzung Selbstgespräche.
Ich antwortete nur in knappen Sätzen beziehungsweise gar nicht auf ihre Fragen. Aber dennoch diagnostizierte sie Depressionen bei mir. Zwar beteuerte ich ihr mindestens einhundert Mal, dass es mir allen Ernstes gut gehe, und versuchte dabei mein schönstes künstliches Lächeln aufzusetzen, das ich besaß, doch sie schien zu merken, dass ich nur schauspielerte und es mir in Wirklichkeit alles andere als gut ging. Sie besaß die Fähigkeit, hinter meine Fassade zu sehen.
Die kommenden zwei Wochen nach der Krankenhausentlassung blieb ich noch krankgeschrieben, um mich zu Hause noch etwas zu erholen und mein Leben wieder „ordnen“ zu können. Keine Ahnung, was nach dem Unfall in meinem Kopf los war, aber es fühlte sich an, als ob irgendjemand sämtliche Schubladen im Gehirn aus den Fächern gezogen, ausgeleert und quer über den Boden verteilt hätte. Mein Schädel dröhnte, als wenn ein Panzer drübergefahren wäre und ich war zu nichts fähig. Selbst die einfachsten Aufgaben überforderten mich bereits. Für die Schule lernen, lesen oder Ähnliches war mir nicht möglich. Ich besaß null Konzentration und an Motivation mangelte es mir ebenfalls. Ich konnte mich zu nichts aufraffen. Nach zwei Wochen beschlossen meine Eltern, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich sollte ab der nächsten Woche wieder in die Schule gehen und somit in einen normalen Alltag zurückkehren.
In der Schule kam dann jedoch noch ein neues Problem hinzu. Zwar hatte ich nach dem Unfall meine Erinnerung an den Tatabend zurück, doch im Gegenzug dazu hatte ich andere wichtige Erinnerungen verloren. Der gesamte Lernstoff der letzten zwei Schuljahre war weg. Ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern. Das machte mich wahnsinnig! Jeden Tag saß ich verzweifelt im Unterricht und verstand kein Wort davon, was die Lehrer vorne an der Tafel erklärten. Innerhalb weniger Tage wurde ich so von der Klassenbesten zur schlechtesten Schülerin der gesamten Jahrgangsstufe. Und das auch noch in der 9. Klasse, wo ich ein Jahr später, in der 10. Klasse den Realschulabschluss machen sollte! Also in meinem Leben ging bereits zu diesem Zeitpunkt schon so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte.
Aber etwas Gutes hatte der Unfall dann doch: Als meine Erinnerung zurückkam, verschwand noch am selben Tag mein Appetit. Essen ekelte mich plötzlich an.
Zusätzlich gefiel mir das Gefühl, das ich verspürte, wenn ich dem Drang zu essen widerstand. Das gab mir das Gefühl von Stärke und zeigte mir, dass ich wenigstens eine Sache in meinem Leben halbwegs kontrollieren konnte: Nämlich ob ich dem Bedürfnis zu essen nachgab oder meinen Körper hungern lies. So nahm ich innerhalb kürzester Zeit an Gewicht ab.
Was ich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wusste, war, dass das bereits der Anfang meiner Essstörung sein sollte.
5. Funktionieren statt leben
„Funktionieren statt leben“ war das Motto, welches ich nach der Rückkehr der Erinnerung zu meinem täglichen Leitsatz machte.
Ich fühlte mich wie ein programmierter Roboter, der tagtäglich sein Programm abspielte, ohne dabei einen eigenen Willen zu haben. Alles lief irgendwie automatisch und ferngesteuert ab. Positive Emotionen, Lebensfreude oder Ziele im Leben gab es für mich nicht mehr. Ich funktionierte nur noch. Wie ein Schauspieler spielte ich jeden Tag meine „Rolle“. Die Rolle eines glücklichen, zufriedenen Mädchens, das sich mit aller Kraft zurück ins Leben kämpfte. Nach außen hin schien ich nur so von Hoffnung und Kampfgeist zu sprühen, doch innerlich hatte ich die Hoffnung auf ein „normales“ Leben schon längst aufgegeben und wollte eigentlich nur noch aus dem Leben verschwinden. Die eiserne Kette, die sich um meinen Brustkorb gelegt hatte, schien sich immer noch weiter zuzuziehen und mir zunehmend mehr die Luft zum Atmen zu nehmen. Es war, als ob ich in meiner eigenen Traurigkeit ertrinken würde. Daran änderten auch die Antidepressiva, die ich von der Psychologin verordnet bekommen hatte, nichts. Überhaupt fand ich die wöchentlichen Gespräche bei ihr komplett überflüssig. Denn in den 45 Minuten Gesprächstherapie machte ich alles, nur nicht über mich und meine Probleme reden. Doch dazu komme ich später noch.
Um den vergessenen Schulstoff aufzuarbeiten, ging ich die ersten Monate nach dem Unfall vier Mal die Woche nachmittags zur Nachhilfe. Selbstverständlich hätte ich auch einfach eine Klasse zurückgehen und somit den Lernstoff wiederholen und mir damit eine Menge Stress ersparen können, aber dafür war ich zu stolz. Denn wie sieht es denn aus, wenn die ehemals Klassenbeste Schülerin eine Ehrenrunde dreht? Das Schuljahr zu wiederholen stand für mich also völlig außer Frage! Gleichgültig, was meine Eltern und Lehrer mir rieten, ich wollte kämpfen und wenigstens eine Sache in meinem Leben nach Plan abschließen.
Durch meinen enormen Ehrgeiz und das positive Talent, das ich recht schnell lerne, schaffte ich tatsächlich bis zum Endjahreszeugnis das Unmögliche möglich zu machen: Ich wurde ins 10. Schuljahr versetzt! Zwar war mein Zeugnis weiterhin deutlich schlechter als die Jahre zuvor, doch zumindest hatte ich keine 5 mehr im Zeugnis stehen. Und solange ich versetzt wurde, waren mir meine Noten (zumindest weitestgehend) egal.
Nach außen hin schien ich mich wieder zu stabilisieren und langsam aber sicher in meinen Alltag zurückzukehren. Innerlich war das jedoch ganz und gar nicht der Fall. Allerdings hätte ich das nie und nimmer vor irgendwelchen Leuten zugegeben. Denn ich wollte auf keinen Fall, dass sich irgendjemand Sorgen oder Gedanken um mich machte. Ich wollte nicht der Grund sein, wieso andere Menschen nachts vor Sorge nicht schlafen konnten oder sich schlecht fühlten! Es reichte schon, dass ich traurig und unglücklich war. Da mussten nicht auch noch meine Mitmenschen wegen mir bedrückt sein! Außerdem war ich der Ansicht, dass wenn ich ganz viel arbeite und mich ablenke, ich gar keine Zeit mehr hätte, darüber nachzudenken, wie schlecht es mir zurzeit ging. Wenn ich mich den gesamten Tag mit anderen Dingen beschäftigte, würden die Bilder in meinem Kopf gar keine Gelegenheit mehr haben, so oft aufzutauchen. Also ich könnte mich sozusagen selbst therapieren. (Soweit die Theorie … Die Praxis sah dann jedoch trotzdem etwas anders aus.)
Einmal pro Woche ging ich auf Anraten der Ärzte im Krankenhaus meiner Mutter zuliebe zu einer Kinder- und Jugendpsychologin. Allerdings waren die 45-minütigen Therapiesitzungen bei ihr, wie bereits oben kurz beschrieben, in meinen Augen völlige Zeitverschwendung. Denn meistens begann ich schon nach wenigen Minuten, mit meinen Gedanken weit abzudriften und an ihr vorbei zu starren. Hinter ihr befand sich nämlich ein riesiges Regal, in dem unendlich viele Playmobilfiguren standen. Diese betrachtete ich dann die gesamte Stunde über, versuchte sie zu zählen oder lernte aus Langeweile die Reihenfolge der aufgestellten Figuren auswendig.
Ich tat mehr oder weniger alles dafür, um nicht mit ihr reden zu müssen. Obwohl meine Psychologin von ihrer Art sehr freundlich und hartnäckig war, schaffte sie es trotzdem nie, mehr als zwei bis drei zusammenhängende Sätze pro Sitzung aus mir herauszubekommen. Ich wollte mit ihr nicht reden und über DAS wollte ich mit ihr schon zweimal nicht reden! Irgendwann schaffte sie es allerdings doch, mein „Geheimnis“ herauszufinden. Nachdem ich ca. 6 Wochen lediglich das Nötigste und zum Teil sogar noch weniger mit ihr geredet hatte, sprach sie mich offen DARAUF an. Da konnte ich dann nicht mehr schweigen. Doch auch als die Psychologin wusste, was mir passiert war, änderte sich in den kommenden Sitzungen an unserer Kommunikation recht wenig. Sie redete und ich schwieg.
Als meine Eltern von der Tat erfuhren, waren sie erst einmal geschockt und wollten mit mir DARÜBER reden. Allerdings hatte ich keine Lust mit ihnen zu reden, denn ich wollte mit niemand DARÜBER sprechen. Nach einer Weile akzeptierten sie das dann auch und ließen mich mit diesem Thema in Ruhe. Worüber ich ihnen sehr dankbar war! Außerdem glaubten meine Eltern, genauso wie meine Psychologin jahrelang, dass die Vergewaltigung eine einmalige Sache war, die sich nicht wiederholen wird. Zu diesem Zeitpunkt war ES zwar auch bis jetzt nur einmal passiert, aber das sollte (leider) nicht so bleiben.
6. Vergangenheit ist es erst, wenn es vorbei ist
Sowohl meine Eltern als auch meine Psychologin merkten erst sehr spät, dass die Vergewaltigung nicht nur in der Vergangenheit stattgefunden hatte, sondern noch bis in die Gegenwart andauerte. Ungefähr sechs Wochen, nachdem meine Erinnerung zurückgekommen war, wiederholte ES sich nämlich.
Ich war auf dem Nachhauseweg von der Schule und lief gerade durch das kleine Waldstück, das ich bei jedem Schulweg durchqueren musste, als DIE plötzlich hinter mir standen. Ohne Vorwarnung hielten SIE mir den Mund zu und zogen mich in einen kleinen, unscheinbaren Seitenweg.





























