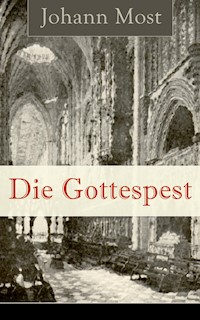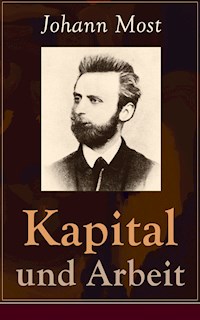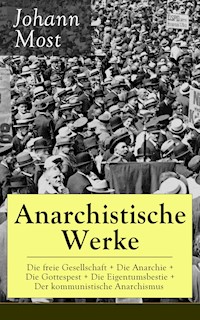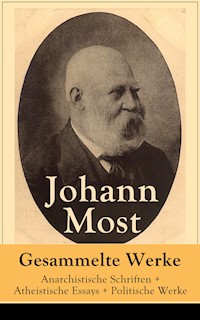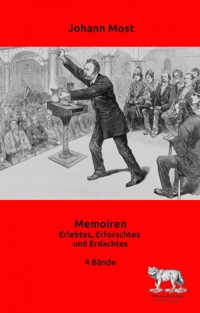
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Johann Most, gelernter Buchbinder wurde als Agitator und Arbeiterführer bekannt. Er wurde als Sozialdemokrat in den Reichstag gewählt, wurde später Kommunist und noch später Anarchist. Er war Herausgeber einiger sozialistischen Zeitungen. Er wurde häufig verurteilt und musste einige Male in das Gefängnis u.a. wegen Hochverrat und Gotteslästerung. Er siedelte nach England über um der Sozialistenvervolgung zu entgehen. Später flüchtete er auch aus England in die USA. Dort wurden seine humorvoll geschriebenen Memoiren in 4 Bänden zuerst veröffentlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Most
Memoiren
Erlebtes, Erforschtes und Erdachtes
1. Band: Aus meiner Jugendzeit
2. Band: Der Wiener Hochverraths-Prozess
3. Band: In Sturm und Drang
4. Band: Die Pariser Commune vor den Berliner Gerichten und die Bastille am Plötzensee
Moorwolf Verlag
Kontakt: [email protected]
Titelbild: Johann Most in New York 1887 im Cooper Institut
Vertrieb: epubli
Made in Germany
© Moorwolf Verlag
ISBN: 978-3-754142-83-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie http://www.dnb.de
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Erster Band
Aus meiner Jugendzeit
Vorwort
Prügel-Pädagogie
Schiefmäuligkeit
Das schauderhafte Weib
Von der Schule in die Lehre
Der Lehrling und sein Meister
Die Wanderschaft und ihre Vorschriften
Die erste Exkursion nach Frankfurt
Die zweite Exkursion nach Bornheim
Auf Wanderschaft in die weite Welt
Der Rauswurf
Wieder auf Schusters Rappen
Wanderschaft in preussischer Machtsphäre
Drang nach Erfüllung einer höheren Mission
Arbeiter-Verein „Eintracht“
Erste Ansprachen und erster Arrest
„Wer übernimmt Sie?“
Demonstration in Wien und Anklage auf Hochverrath
Haft und Nussknacker
Die Kinder meiner damaligen Muse
Zweites Bändchen
Der Wiener Hochverraths-Prozess
Vorwort zum II. Theil.
I Die Anklageschrift.
II Das Verhör.
III. Das Zeugenverhör.
IV Dokumenten-Verlesung.
V. Die Playdoyers.
VI Das Urtheil.
VII Die Konsequenz.
VIII Der Transport
IX Im Zuchthaus.
X Amnestie und Verbannung.
XI Vermischte Nachlese.
Poetischer Anhang
Drittes Bändchen
In Sturm und Drang.
Vorwort zum III. Theil.
Agitations-Reminiscenzen.
Agitation par Force.
Eine Proletarier-Zeitung.
Der „Rothe Thurm".
Eine gestorte Sedanfeier.
Steckbrieflich verfolgt.
Im Landesgefängniss.
Kurse Flitterwochen.
Parlaments- Reminiscenzen.
Parlamentarische Gebräuche
Jungfernrede
Abstimmungsverhalten
Zivilisirte Wildsäue und Arretierung
Die bedeutendste Rede
Wahlkampf
Wahlkampf, Reichstagssitten und Auflösung
Vom Parlamentarismus kurirt
Viertes Bändchen
Die Pariser Commune vor den Berliner Gerichten
Eine Erklärung als Vorwort.
Vorbemerkung
Die Untersuchungshaft
Die Anklage und der Staatsanwalt.
Anklage
Der Gerichtshof und meine Verhandlung.
Vortrag über die Pariser Commune.
Das Plaidoyer des Staatsanwalts.
Vertheidigung.
Des Urtheil.
Die Bastille am Plötzensee.
I Aufzeichnungen an Ort und Stelle.
II Die Aufsichts-Kommission.
III Die Beamten-Konferenz.
IV Der Sechsgroschen-Kuli.
V Auf dem Wege der „Besserung".
VI Dichtung und Wahrheit.
VII Vermischte Erlebnisse.
VIII Die lustige Station.
IX Rück- und Vorblicke.
Vorwort des Herausgebers
Johann (John) Most wurde 1846 in Augsburg geboren. In seiner Kindheit litt er an Knochenfraß im Unterkiefer wodurch er nach einer Operation im Gesicht entstellt war. Schon früh wehrte sich Most gegen die „Prügelpädagogik“, die er zuhause und in der Schule erlebte. Er wurde als 13-Jähriger von der Schule verwiesen, weil er einen Schülerstreik angezettelt hatte. Sein Vater drängte ihn auszuziehen und eine Lehre zu machen. Most, der eigentlich gerne Schauspieler geworden wäre, entschied sich für eine Buchbindelehre. Nach dem Ende der Lehrzeit 1863 zog er als Wandergeselle durch Deutschland, Schweiz bis nach Italien. Ab 1868 zog es ihn nach Österreich, wo er mit der Arbeiterbewegung in Kontakt kam. Er schloss sich dieser an, weil sie seinem Leben den gesuchten Sinn gab. Er wurde wegen Hochverrat angeklagt. In seiner Untersuchungshaft gründete und schrieb die Gefängniszeitung Nussknacker, deren Artikel im Prozess später gegen ihn verwendet wurden. Er wurde zu 5 Jahren „schweren Kerker“ verurteilt. Nach einigen Monaten Haft wurde er 1871 begnadigt. Wegen seiner dann folgenden sozialdemokratischen Agitationsreisen wurde schließlich nach Deutschland ausgewiesen.
Es folgte eine politisch Agitationstätigkeit in Bayern und anschliessend. In Chemnitz wurde er Chefredakteur der Chemnitzer Freien Presse, später als sein Tätigkeitsfeld in Berlin war, wurde er Chefredakteur der Berliner Freie Presse. Er zog für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1874 mit 27 Jahren als jüngster Abgeordneter in den Reichstag. Dort wurde er ein Anhänger des linken radikalen Flügel, der durch Fusion entstandenen Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Einen Teil dieser Zeit musste er allerdings im Gefängnis verbringen. Er schaffte seine Wiederwahl mit Bravour. Wegen einer Rede zur Pariser Kommune wurde er trotz seines Status als Reichstagsabgeordneter zu 19 Monaten Haft verurteilt. Most war aber ohnehin vom „Parlamentarismus kurirt“
1878 emigrierte er wegen der Sozialistenverfolgung nach London und wurde dort vom Kommunistischen Arbeiterverein aufgenommen, und gab dort die Zeitung Freiheit heraus, da wegen dem Sozialistengesetz alle entsprechenden Blätter in Deutschland verboten waren. Es erfolgte eine Hinwendung zum Anarchismus. Ein Artikel, in dem er den Mord an Zar Alexander II. von Russland lobte, brachte ihn für 18 Monate ins Gefängnis.
1882 zog Most in die USA. Er brachte dort weiterhin die Freiheit heraus, war Organisator der ersten großen Kirchenaustrittsbewegung und agitierte für Streikbewegungen. Während einer Agitationsreise starb John Most 1906 in Cincinnati.
Neben Arbeitergedichten und Liedern, von denen einige in seinen Memoiren abgedruckt sind, hat er Schriften wie Die Eigentumsbestie, Der kommunistische Anarchismus, und Revolutionäre Kriegswissenschaft mit Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen geschrieben und veröffentlicht.
Empfohlen sei allen an Johann Most interessierten Lesern auch seine Atheistischen Schriften Die Gottespest und Die Gottlosigkeit, welche der Moorwolf Verlag ebenfalls neu herausgebracht hat (ISBN: 978-3-759820-36-5).
Most beschreibt sein bewegtes und rebellisches Leben in den vier Bänden seiner Memoiren äußerst humorvoll und anschaulich. Der Leser wird nicht nur einen Einblick in das interessante Leben von Johann Most bekommen, sondern auch in die damalige gesellschaftliche Situation.
Der vierte Band seiner Memoiren wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht.
Seine Jahre in England und den USA, sowie seine Wandlung zum Anarchisten, hat er nicht mehr beschrieben.
Die Orthographie wurde unverändert gelassen. Die Kapitelüberschriften des ersten Band, sowie des zweiten Teil vom dritten Band, wurden von mir zwecks besserer Zuordnung eingefügt.
Knut Heinzel
Erster Band
Aus meiner Jugendzeit
NEW YORK
Selbstverlag des Verfassers John Most, 3465 Dritte Ave.
1903
Vorwort
Oft und von vielen Seiten aus wurde schon an mich das Ansinnen gestellt, ich solle meine Memoiren schreiben und veröffentlichen, aber aus mancherlei Gründen vermochte ich mich bisher nicht dazu zu entschliessen.
Meiner bisherigen Ansicht nach kann es allerdings nicht schaden, wenn Leute, die mancherlei Interessantes erlebten, davon Aufzeichnungen machen, die Veröffentlichung derselben sollten sie — so dachte ich — aber Anderen nach ihrem Tode überlassen, welche auch bevollmächtigt werden sollten, etwa nothwendig erscheinende Randglossen daran zu knüpfen.
So weit ein Memoirenschreiber mit seiner eigenen Person in den zu schildernden Vorgängen verwickelt ist, wird es ihm schwer fallen, über die Klippen und Gefahren hinweg zu kommen, die sich einer durchweg objectiven, total realistischen Darstellung der einschlägigen Dinge in den Weg stellen. Ent-weder wird man leicht davor zurückschrecken, gelegentlich einer Selbstkritik neben den Licht- auch die Schatten-Seiten der eigenen Person hervor zu heben, was zu subjectiver Schönfärberei, wenn nicht gar zu prahlerischer Aufschneiderei ausarten kann. Oder man verfällt in das entgegen gesetzte Extrem und befleissigt sich einer über- resp.untertriebenen Bescheidenheit. In beiden Fällen kann kein eigentliches Portrait, sondern nur eine mehr oder weniger verzerrte Karrikatur zum Vorschein kommen. Selbst ein Goethe hat durch seine Autobiographie nichts Anderes geliefert, weshalb er sich denn auch schliesslich bemüssigt fand, dieselbe mit „Wahrheit und Dichtung"- zu betiteln.
Ich für meinen Theil will es nun wenigstens versuchen, in den von mir erlebten und nun zu erzählenden Geschichten meine Person so auftreten zu lassen, wie sie im Spiegel meiner Selbsterkenntniss vor mir steht — ohne Abstrich und ohne Aufputz. In wie weit mir das gelingt — darüber mögen Mit- und Nachlebende urtheilen, die, sei es auf Grund persönlicher Erfahrungen, sei es durch Musterung des einschlägigen literarischen oder anderweitigen Materials, dazu berufen und im Stande sind.
Betreffs der Charakterzeichnung anderer Personen von Interesse, mit denen ein Memoiren-Schreiber im Laufe eines langen öffentlichen Lebens zusammentraf, ist die Aufgabe nicht minder schwierig. So gross da auch die Versuchung sein mag, Diesem oder Jenem gegenüber seinem Privat- oder Parteihass die Zügel schiessen zu lassen, oder so stark das Verlangen ist, Einem im Allgemeinen sympathisch erschienene oder erscheinende Personen hinsichtlich durch dieselben gemachten Fehlern ein Auge zuzudrücken und Beschönigung zu treiben — es darf einer solchen Verlockung nicht Folge geleistet werden. Andernfalls hat das diesbezüglich Geschriebene gar keinen praktischen Werth. Auch in dieser Hinsicht will ich mich daher befleissigen, mich strikt an die Wahrheit zu halten — so weit das eben menschenmöglich ist.
Mehr oder weniger leicht lässt sich mit guter Absicht und festem Willen diese Regel einhalten so weit es sich um Personen handelt, die todt sind oder sich aus dem öffentlichen Leben gänzlich zurückgezogen haben. Anders steht die Sache hinsichtlich Solchen, die noch immer auf dem Welttheater agiren oder gar in jener Sphäre hausen, in der man sich selber bewegt. Das öffentliche Leben bringt es einmal so mit sich, dass oft die intimste Freundschaft, die man heute zu Jemandem hegt, morgen in bitterste Feindschaft — oft Bagatellsachen halber — umschlägt, oder auch das Umgekehrte mag
eintreten. Ja, es mögen diese Extreme wiederholt einander ablösen. Welch' eine Schwierigkeit, unter solchen Umständen ein definitives und gerechtes Urtheil zu fällen ! Immerhin soll es meinerseits auch nach dieser Richtung hin wenigstens am
wohlwollenden Versuch nicht fehlen.
Am leichtesten ist die Sache betreffs der Schilderung von Zuständen und Ereignissen, die ein Erinnerungs- Auf Zeichnerkennen gelernt und erlebt hat, namentlich wenn man sich eines guten Gedächtnisses erfreut, wie ich mir schmeicheln darf, von der Natur mit einem solchen begnadet worden zu sein.
In dem ersten Bändchen meiner Memoiren, das ich zunächst herausgebe, kommen die meisten der obgedachten Bedenken freilich nicht in Betracht; allein ich wollte mit meiner auf vielseitiges Verlangen zu leistenden Erzählerei gar nicht beginnen, ohne zuvor den von mir dabei einzunehmenden Standpunkt klar gelegt zu haben.
Jugendgeschichten, namentlich solche aus dem Proletarier- Leben, sind oft sehr uninteressant und gleichen sich, wie ein Windei dem anderen. Meist bilden sie nur eine Reihe von gleichartigen Gliedern an einer mehr oder weniger langen Elendskette.
Meine Jugendgeschichte stellte nun allerdings auch eine solche Kette vor, nur waren die einzelnen Glieder derselben nichts weniger als egal, sondern äusserst mannigfaltiger Natur, so dass die Leser, wenn sie dieselben zur Besichtigung vorgelegt bekommen, sich schwerlich dabei langweilen werden.
Häufig bewundert man meine „eiserne Constitution" oder, wie sich Manche ausdrücken, meine „Katzennatur", welche mir in meinem späteren Leben über alle erdenklichen Fähr-
lichkeiten, Schicksalsschläge und Strapazen hinweg geholfen hat, ohne dass ich auch nur den ausgezeichneten Humor verloren hätte, der mir, wie es scheint, angeboren wurde.
Wenn man meine Jugendgeschichten gelesen hat, wird man wissen, worin die Ursache davon bestand. Auf Vielen mag des Schicksals Tücke schon in der Kindheit ähnlich herum
hämmern, wie sie es mir gegenüber getrieben hat. Von hundert gehen dabei aber neunundneunzig zum Teufel. Wer aber einmal aus solcher Schmiede, wenn auch nicht unversehrt, wohl aber lebendig hervor gegangen ist, der darf sich auch für hinlänglich gestählt halten, um selbst die schwersten Schläge, die das weitere Leben bringen mag, mit Gleichmuth zu ertragen.
Mit Gruss und Hand !
New York, 1903.
John Most.
Prügel-Pädagogie
Meine Mutter war eine Gouvernante, sehr gebildet und freisinniger Denkungsart. Mein Vater, Sohn armer Leute, versuchte es, nachdem er der Volksschule entwachsen, zu „studiren" wobei er sich auf Stipendien verlassen und im Uebrigen durch sogenanntes Stundengeben einen kärglichen Lebensunterhalt verschaffen musste. Es dauerte aber nicht lange ehe er „auf dem Pfropfen" sass. Da er gut singen, Guitarre- und Zitherspielen konnte, vegetirte er sodann eine Zeitlang als „fahrender Sänger", später ging er zum Theater, hatte aber auch damit kein Glück. Schliesslich kehrte er wieder in die Heimath (Augsburg) zurück und bekam bei erbärmlichem Salair eine Advokaten-Schreiberstelle. Bald darauf lernte er meine Mutter kennen und beide gewannen einander binnen Kurzem so lieb, dass die Folgen davon nicht lange auf sich warten Hessen, was meiner Mutter ihre Stelle kostete. Was nun? Heirathen konnten sie nicht, weil der Gemeinderath, der damals über solche Angelegenheiten zu entscheiden hatte, seine Zustimmung dazu verweigerte, da, wie sich die offiziellen Volks- Vormünder ausdrückten, so ein armseliges Schreiberlein ja doch keine Familie zu ernähren
vermöge. Im „Concubinat" vermochten sie auch nicht zu leben, weil das erst recht strengstens verboten war. Mein Grossvater jedoch, der seinen einzigen Sohn sehr lieb hatte, wusste Rath zu schaffen. Er erbte kurz zuvor ein kleines Häuschen, wodurch seine sonst auch recht windigen Verhältnisse — er war Maurer-Pollier, d. h. Werkmeister — sich etwas besserten. Der engagirte nun pro Forma raeine Mutter als „Dienstmädchen", während sich mein Vater bei ihm gewisserraassen als „Zimmerherr" einquartirte.
Am 5. Februar 1846 kam ich zur Welt — wie man sieht, polizeiwidriger Weise. Zwei Jahre später, also anno 1848, als auch Baiern ein kleines Revolutiönchen erlebte (eigentlich
war es nur ein Bierkrawall in Verbindung mit einer „moralischen" Protestbewegung gegen die Königsmaitresse Lola Montez), dämmerte es im Rathhaus von Augsburg so ein klein wenig und meine Eltern bekamen eine Heirathslizenz. Davon machten sie umso schleuniger Gebrauch, als der Zungenschlag böser Nachbarinnen nachgerade zu täglichen Scandalen Anlass gab. Immerhin feierte diese Sippschaft gerade am
Hochzeitstage noch einen grossen Triumph, und Anlass dazu gab ich. Als Zweijähriger war ich nämlich schon gut auf den Beinen. Ich wollte partout in der Hochzeits-Kutsche zur Trauung mitfahren, was natürlich nicht anging. Während nun meine Grosseltern vom Fenster ans dem Gefährt nachsahen, war ich davon geschlichen und suchte hinter dem Wagen herzulaufen. Das war so recht ein „gefundenes Fressen" für die auf der Lauer liegende Umwohnerschaft, welche in ein schallendes Hohngelächter ausbrach, das nicht eher nachliess, als bis meine Grossmutter mir nachgeeilt war und mich in's Haus zurück gebracht hatte.
Dass ich nicht besonders verhätschelt werden konnte, verstand sich bei dem geringen Einkommen meines Vaters ganz von selbst — Schmalhans war da beständig Küchenmeister. Umso zärtlicher waren hingegen meine Eltern um meine Erziehung besorgt. So sehr und so erfolgreich bemühte sich ganz besonders meine Mutter nach dieser Richtung hin, dass ich bereits im Alter von fünf Jahren zu lesen und etwas Buch-
staben zu kritzeln vermochte, weshalb ich auch schon in diesem Alter in die Volksschule aufgenommen wurde, in der ich jedoch wenig lernte, was mir nicht zuvor schon meine Mutter beigebracht gehabt hätte.
Neu war für mich nur der Religionsunterricht, doch „zog" derselbe nicht, denn was ich davon in der Schule durch einen zelotischen Kaplan zu hören bekam und zu Hause erzählte, das machten sowohl meine Mutter, als auch mein Vater, welche total "gottlos" waren, dermassen lächerlich, dass der ganze Schwindel nur noch einen komischen Eindruck auf mich machte und niemals meinen Schädel inficiren konnte. Einschalten rauss ich hier, dass zwar mein Vater in seinen alten Tagen einen kirchlichen Posten bekleidete — er wurde Verwalter des katholischen Friedhofs — , dass er innerlich
aber ein Ungläubiger blieb bis an sein Lebensende. Seine Anstellung verdankte er auch keinesweges etwaigen Heucheleien religiöser Art, sondern dem Umstände, dass er ein guter Redner war und als solcher in den 6oer Jahren einen antipreussischen Ton ä la „Vaterland"- Sigl, nämlich baierisch- derb, anschlug und in partikularistischen Vereinen wegen seines Agitations - Talentes einen beträchtlichen Einfluss — „Pull" würde man in Amerika sagen — hatte.
Obgleich mir unter solchen Umständen der Katechismus lächerlich vorkam, musste ich denselben später doch auswendig lernen, was ich allerdings nur papageiartig that, weil ich sonst „gottsjämmerlich" von obgedachtem Kaplan verhauen worden wäre, denn der hielt, so lange er im Schulraum verweilte, den Ochsenziemer so fest in Händen, als ob derselbe damit verwachsen wäre.
Ueberhaupt stand damals die Prügel-Pädagogie in vollster Blüthe. Es gab 6 Jahresklassen und 3 Schulmeister, so dass jeder derselben gleichzeitig je zwei Klassen, jede mindestens 150 Knaben bergend, zu „unterrichten" hatte. Einen solchen
Haufen Kinder in Zucht und Ordnung zu halten, war natürlich keine Kleinigkeit — das ging noch über das Schafweiden und Gänsehüten. Deshalb mussten eben alle erdenklichen Züchtigungs-Instrumente einerseits und die Hände, Rücken,
Podexe etc. der Kinder andererseits herhalten. Ein ganz besonderer Haudegen war Derjenige, welcher die Mittelklassen dirigirte und unter dessen Fuchtel auch ich im dritten Jahre meiner Schulzeit stand. Hinter seinem Katheder war eine förmliche Sammlung von Schlagwerkzeugen exhibirt: Ruthen, Riemen, Rohr- und Hasselnussstöcke, Ochsenziemer, zusammengeflochtene Bassgeigensaiten etc. Und so oft er Executionen vornahm, stand er erst eine Weile vor seinem Folterkasten, um zu erwägen, was wohl dem betreffenden „Sünder" gegenüber am „schlagendsten" wirken könnte.
Eine spezielle Marotte, "die er hatte, war die folgende : Als Hausarbeit gab er unter Anderem tagtäglich vier Rechenexempel auf. So bald die Schule begonnen, wurden die mit Namen versehenen Aufgabenhefte eingesammelt. Hernach hatte ein Schulgehülfe die Aufgaben an der grossen Tafel laut zu lösen und anzukreiden. Dann wurden die Hefte beschnüffelt. Wer alle vier Rechnungen correct gemacht hatte, bekam
sein Heft mit guter Note zurück. Die Uebrigen wurden, je nach der Anzahl der mathematischen Fehlgeburten, sortirt und in die vier Winkel der Schule gestellt. Wer nur eine Rechnung unrichtig löste, bekam vier Hiebe auf die Handflächen, für zwei Irrthümer setzte es acht, für drei zwölf und für vier sechszehn Hiebe. Dabei grinste der Prügelmeister ganz vergnügt in sich hinein und rief ein über's andere Mal:
,,Die Bosheit steckt tief in dem Herzen des Knaben, aber die Zuchtruthe treibt sie wieder heraus" — spricht der weise Salomon. — Mich selber traf freilich kein einziger Schlag, denn meine Mutter hatte mir nicht nur bei Zeiten das Einmaleins gehörig beigebracht, sondern revidirte auch täglich meine Schularbeiten, so dass mir nicht so leicht etwas Menschliches oder vielmehr Unmenschliches passiren konnte. Immerhin war es äusserst deprimirend, diese scheusslichen Prügeleien mit ansehen und das Jammergeheul der Opfer derselben vernehmen zu müssen. Diejenigen, welche die meisten ,, Tatzen",
wie man die obgedachte Hiebsorte nannte, bekamen und am öftesten geprügelt wurden, schrien übrigens am wenigsten. Auf ihren Handflächen hatten sich förmliche Hornhäute gebildet ! ! Wie nicht anders zu erwarten war, endete dieser
Schulmeister später im Irfenhause. —
Unter solchen Verhältnissen wurde ich nahezu acht Jahre alt, als ein Ereigniss eintrat, das nicht nur buchstäblich sehr schmerzlich für mich war, sondern auch für mein ganzes späteres Leben ausschlaggebend wirkte. Doch davon soll in dem folgenden Kapitel die Rede sein. Hier sei nur noch das Urtheil reproduzirt, welches damals die Meisten über mich fällten, mit denen ich in Berührung kam. Es lautete: „Dieser Hans ist ein recht netter und gescheidter Junge, aber doch ein bitterbösser Bub' !" — Hinter meiner Lebendigkeit witterte man Bosheit, hinter meinem Hang zu Spässen Ungezogenhe' .
Meine Eltern aber hatten ihre Freude an mir, so wie ich war. Das konnte mir genügen. Uebrigens brachte ich aus der Schule auch alljährlich einen Preis nach Hause.
Schiefmäuligkeit
Ein Witzbold sagte einmal, meine Schüler seien weiter nichts, als die schiefgewickelten Jünger eines schiefmäuligen Propheten. Das war ein billiger Spott. Aber was war die Ur- sache meiner Schiefmäuligkeit ? Lombroso nimmt an, dass ich damit zur Welt gekommen sei und knüpft an diese willkürliche Annahme die Folgerung, dass mein „anarchistisch-verbrecherischer Charakter" mir schon angeboren worden sei, wie man aus meiner Physiognomie ersehen könne. Andere faselten von einem erhaltenen buchstäblichen „Eselsfusstritt" und noch Andere führen mein entstelltes Gesicht auf die Folge eines
Experimentes mit Explosivstoffen zurück. Die Wahrheit ist —hoffentlich fällt darob keine Temperenz-Schwester irgend welchen Geschlechtes in Ohnmacht ! — , dass ich die Bescheerung dem lieben Suff zu verdanken habe.
In der Sylvesternacht von 1853 auf '54 hatte sich im elterlichen Hause eine kreuzfidele Gesellschaft eingefunden. Unter Anderem wurde auch Punsch getrunken. Ich bekam eben- falls ein Gläschen voll davon ab. Das schmeckte entschieden nach mehr. Und weil ich so nichts mehr haben sollte, griff ich zur Selbsthülfe. Ich versteckte mich unter dem Tisch und stibitzte ein Gläschen nebst Inhalt nach dem andern von der Tafel bis ich einduselte. Als man mich entdeckte, brachte man mich in die Schlafstube, wo ich mir — es herrschte in jener Nacht ein bitterer Frost — eine böse sogenannte Erkältung zuzog. Morgens war meine linke Wange ganz furchtbar angeschwollen. Das war der Beginn einer fünfjährigen Krankheit, während deren Verlauf ungefähr zwanzig Heilkünstler aller Sorten, vom Obermedicinalrath bis zum ordinärsten Quacksalber, mich als Versuchs-Kaninchen zu allerhand verunglückten Experimenten verwendeten. Kalte und heisse Umschläge, Leberthran, Kräuterthee, süsse und bittere Medicinen, Pillen, Pulver, Salben etc. etc. wurden verordnet; diverse Zähne wurden gezogen; jeden Augenblick wurde eine andere, aber niemals eine zutreffende Diagnose gestellt; schliesslich rieth man auf „Krebs" ,und erklärte das Uebel für unheilbar.
An drei verschiedenen Stellen bildeten sich von innen heraus garstige Geschwürwunden, welche Jahr ein, Jahr aus ganz entsetzlich eiterten. Obgleich ich beträchtliche Schmerzen auszustehen hatte, war ich nie viel bettlägerig, musste aber häufig, namentlich bei rauher Witterung, das Haus hüten. In Folge dessen wurde ich vom regelmässigen Schulbesuch abgehalten, was mir jedoch schwerlich etwas schadete, indem mir mein Vater die Elementarien ohne Zweifel besser beibrachte, als die schon gekennzeichneten Schulmeister zu thun vermocht hätten.
Während meiner Krankheit brachen aber noch anderweite Unglücksfälle über mein elterliches Haus herein. Im Jahre 1856 wüthete eine Cholera-Epidemie, welcher meine gute Mutter erliegen musste. Auch beide Grosseltern und eine meiner Schwestern wurden von derselben dahingerafft. Mich hingegen, der ich doch in jener Schreckenszeit so gut wie gar keine Pflege genossundden nothwendigsten Bandagenwechsel
selber besorgen musste, verschonte merkwürdiger Weise die Seuche. Wer denkt da nicht an das sprichwörtliche „Unkraut" welches nicht „verdirbt" ? ! —
Etwa nach Verlauf eines Jahres hat mein Vater sein Glück in der Ehe ein zweites Mal versucht und dabei eine ganz scheussliche Niete gezogen. Diese, ein ganz stockkatholisches Rabenaas und sonstiges dummes Luder, biss mir und meiner
Schwester gegenüber die Stiefmutter heraus, dass ich fortan nicht nur körperlich, sondern auch psychisch ganz fürchterlich zu leiden hatte.
Endlich nahte sich hinsichtlich meiner Krankheit ein Erlöser und zwar in der Person eines geschickten und kühnen Operateurs Namens Dr. Agatz. Derselbe erkannte auf den
ersten Blick, dass ich den Knochenfrass an der linken Hälfte des Unterkiefers hatte; auch erklärte er, dass dieses Uebel lediglich von jenen Doktoren verschuldet worden sei, welche mich sammt und sonders total eselhaft behandelt hatten.
Gleichzeitig eröffnete er meinem Vater, dass nur eine Operation auf Leben und Tod allenfalls Rettung bringen könne, während, wenn ein solcher Versuch nicht gemacht würde, ich höchstens noch drei Monate lang am Leben bleiben könne.
Die Operation wurde am 18. März 1859 — ich war inzwischen 13 Jahre alt geworden — unternommen. Dieselbe nahm eine fünf viertelstündige Dauer in Anspruch und erheischte ein fünfmaliges Chloroformiren. Von der linken Schläfe bis in
den Mundwinkel wurde eine Blosslegung des Kiefers bewerkstelligt, ein drei Zoll langes (total zerfressenes) Stück davon heraus genommen, dann der Kieferrest von rechts nach links dermassen verschoben, dass später eine Verknorpelung statt- finden konnte; endlich nähte der Operateur die zerschnittenen Fleischtheüe wieder zusammen. Vier Wochen später lief ich, allerdings mit einem von rechts nach links zerschobenem Ge-
sichte und „schiefmäulig", im Uebrigen aber ganz gesund, umher. Seitdem hat noch nie ein Doktor oder Apotheker von mir irgend einen Hülferuf vernommen.
Das schauderhafte Weib
Ein „Mädchen für Alles" — wer diese Rolle kennt, der spielt sie heutzutage gewiss nicht gerne mehr; besonders wollen die städtischen Evatöchter nicht so leicht etwas davon
wissen; sie haben ganze Büschel ausgeraufter Haare darin gefunden. In Amerika wird diese so hervortretende „Dienstbotennoth" nur noch dadurch gemildert, dass ländlich-sittliche Grünhörner ab und zu in die Netze schwimmen, während speziell in Californien die Chinesen einen mehr als ausreichenden Ersatz bieten.
Ich aber bin weder Chinese, noch weiblichen Geschlechts, noch war ich auch nur ausgewachsen oder sonst bei besonderen Kräften, als mich meine Stiefmutter nach dem Muster eines Thierbändigers durch Hunger und Hiebe zu einem „Mädchen für Alles'" dressirte.
Schon während meiner Krankheit, mehr jedoch als ich gesund geworden war, in der Schulperiode, wie zur Zeit der Ferien, nahm dieses schauderhafte Weib jede wachende Minute, die mir zur Verfügung stand, in Anspruch. Ich musste alle Schuhe und Stiefel wichsen oder schmieren, welche die Familie benützte. Ich hatte Holz zu hacken, Wasser zu tragen, Kleider zu reinigen, Feuer zu machen, Lampen zu putzen, Einkäufe zu machen, zu scheuern, zu waschen, abzustauben, Kinder zu wiegen oder herum zu schleppen u. s. w. u. s. w. Aufgestanden wurde schon um 5 Uhr Morgens; aufgeweckt wurde man durch die „Fabrikler", wie man verächtlich die Spinner und Weber nannte, die in aller Frühe buchstäblich zur Arbeit galoppirten. Deren Tagewerk begann nämlich Morgens um 5 Uhr und währte bis 7 Uhr Abends. Pferde- bahnen oder dergleichen gab es damals noch nicht, und wenn es welche gegeben hätte, so wären sie von diesen Leuten sicherlich doch nicht benützt worden, denn ihr Wochenlohn belief sich höchstens auf 6 Gulden. Die meisten Fabriken befanden sich ausserhalb der Stadt, und da dieselbe zu jener Zeit noch von mittelalterlichen Festungsmauern umgeben war, so mussten Viele grosse Umwege machen, um zu den Thoren zu gelangen, daher der allgemeine Dauerlauf.
Wenn andere Kinder in den Schulpausen oder zur Ferienzeit spielten und sich ihres Lebens erfreuten, musste ich Dienstmädchen spielen. Nur am Sonntag, wo mich meine
Zuchthexe zum Hochamt und zur Predigt in die Kirche schickte, konnte ich mich eine Zeitlang im Freien ergehen, weil ich zwar, um gesehen zu werden, jedesmal vorn durchs
Hauptthor in die Kirche eintrat, aber durch eine Seitenpforte mich alsbald wieder davon schlich. Dieser. Haussclaverei ist es denn auch zuzuschreiben, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich im Schwimmen, Schlittschuhlaufen oder ähnlichen Jugendsports zu ergehen.
Dabei bekam ich niemals genug zu essen, so dass ich gezwungen war, bei Bäckern Brod zu betteln oder auch zu stehlen. War ich renitent, so setzte es Hiebe. Nur durch passiven
Widerstand erzwang ich mir von Zeit zu Zeit etwas mildere Behandlung, nämlich, wenn ich davon lief, sozusagen Strike machte und ganz und gar von Bettelei, sowie Feld- und anderem Kleindiebstahl lebte, während ich mich zur Nachtzeit irgendwo, meist auf irgend einer Bodenkammer, wie ein Hund verkroch. Solch ein erbärmliches Leben hatte ich bis in mein fünfzehntes Jahr hinein zu führen, d. h. bis ich in eine „Lehre" kam, während welcher, wie der Leser noch hören wird, ich wahrlich auch nichts zu lachen hatte.
Mein Vater suchte freilich oft mich zu beschützen, aber er war ja den ganzen Tag nicht zu Hause. Von 8 bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 6 Uhr Nachmittags arbeitete er als
Bureauschreiber der Kreisregierung von Schwaben und Neuburg und von 1 bis 2 Uhr, sowie von 6 bis 8 Uhr Abends gab er Unterrichtsstunden, sonst hätte sein Einkommen nicht gereicht, eine Familie zu ernähren. Immerhin setzte es manchmal ganz gewaltigen Krach. Einmal war mein Vater nahe daran, das weibliche Ungeheuer zu erwürgen, ein anderes Mal stand er im Begriffe, ihm den Schädel einzuschlagen.
So wurde meine früheste Jugendzeit mir gründlich verbittert. Und da ich so wenig der Liebe genoss, so entfaltete sich in meinem Herzen ein unbändiger Hass — damals gegen
den weiblichen Haustyrannen. Und dieses Uebergewicht in der negativen Gefühls-Entwickelung scheint schon da so stark gewesen zu sein, dass es für das ganze spätere Leben massgebend blieb. Denn wo und wenn immer private oder öffentliche Tyrannen vor mir in Erscheinung traten — ich musste sie von ganzer Seele hassen.
Von der Schule in die Lehre
Obwohl mein Besuch der Volksschule, wie gesagt, ein äusserst minimaler war, vermochte ich doch mit 12 Jahren das Aufnahms-Examen für die Real-, resp. Gewerbeschule zu bestehen. Die Herrlichkeit dauerte aber nicht lange, bald kam es zu allerlei Krach zwischen diversen Professoren und mir; denn wozu ich keine Neigung hatte, das liess ich mir auch nicht einpauken oder eindrillen. Mit Lust warf ich
mich über Naturwissenschaft, Geschichte und Mathematik her. Dagegen war mir alles Zeichnen, Malen und dergleichen, sowie das Studium fremder Sprachen ein Gräuel. Das führte zu Strafarbeiten, Karcer und Aerger aller Art, wofür ich mich durch Spottverse und allen eidenklichen Schabernak, den ich den betreffenden Lehrern anthat, zu rächen suchte. Das Ende vom Liede war Relegation wegen Inscenirung einer Niess- Demonstration durch Vertheilung von Schneeberger Schnupftabak und Anzettelung eines Schülerstrikes wider den französischen Professor Baurier^ der über die ganze Klasse eine schwere Strafarbeit verhängt hatte.
Zu Hause brach das Ungewitter indessen erst 14 Tage später über mich herein, denn ich entfernte mich täglich zwei Mal von der Wohnung mit einem Bündel Bücher unter dem
Arme und gab mir den Anschein, als ob gar nichts besonderes vorgefallen wäre. Theils hatte ich Angst vor stiefmütterlichen Hieben, theils dachte ich überhaupt nicht daran,
was nun aus mir werden sollte.
Eines schönen Sonntags Morgens, als ich noch im Bette lag, kam aber der Unglücksrabe in Gestalt eines Klassengenossen daher geflogen. Es war das der Sohn eines Bäcker-
meisters, der allmonatlich die Brodgelder zu collecten pflegte.
Zwischen diesem und der Stiefmutter entspann sich folgender Dialog, den ich, obgleich er in der Küche geführt wurde, leicht belauschen konnte.
„Aber was ist denn los mit dem Hans", sagte der Junge, „sein Vater braucht ja nur zum Rector zu gehen, dann wird Alles wieder gut".
„Was soll los sein ?" antwortete sie ganz verwundert und machte eine Beklommenheitspause, begleitet von einem mir nur zu sehr bekannten pfauchenden Pusten.
„Na, er wurde doch zum Teufel gejagt".
„Wa — as ? Unsinn ! Er geht ja täglich zur Schule".
Er schlug eine helle Lache auf, während es mir nichts weniger als lachhaft zu Muthe war. Dann sagte er: „Aber, Frau M., das gibt's doch gar nicht. Der Hinausschmiss passirte ja schon vor zwei Wochen".
Nun hörte ich, wie das mir verhasste Satansweib bald die Hände zusammenschlug, bald mit der Faust auf den Tisch loshämmerte und dazwischen hinein das Blaue' vom Himmel
herunter fluchte.
Ich fand es rathsam, aufzustehen und mich anzukleiden, und zwar zog ich zur Vorsorge gegenüber allen üblen Eventualitäten drei Paar Unterhosen übereinander an. Doch er-
wies sich diese Massregel für überflüssig. Es flogen diverse Thüren auf und zu. Ich hörte ein grosses Geschrei, das von einer Controverse zwischen meinem Vater und seinem Hausdrachen herrührte, von welcher ich aber nur die letzten Worte, die bei geöffneter Thüre gesprochen wurden, verstehen konnte. „Ich vergreife mich an dem Kerl nicht mehr", brüllte das rasende Weib, „mache jetzt du mit ihm was du willst; aber 'raus muss er aus dem Haus, der Lump, der Hund, der Taugenichts, aus dem im ganzen Leben nichts werden kann "
Raus! — das stimmte eigentlich auch mit meinem eigenen Verlangen überein, obgleich ich keine Ahnung betreffs des Wohin u. s. w. hatte. Ich kniff mir den nöthigen Muth
in die Hinterbacken und betrat das Schlafzimmer meines Vaters, in welchem sich obgedachtes Donnerwetter ausgetobt hatte.
Mein Vater sah leichenblass aus und zitterte am ganzen Leibe. Stumm und ernst musterte er mich einige Minuten lang, die mir jedoch wie kleine Ewigkeiten vorkamen. Ohne weitere Einleitung sagte er dann : „Ich habe dein Bestes gewollt — meine Geduld mit deinen losen Streichen ist erschöpft — ich werde dich deinem Schicksal überlassen".
Pause ! Ich spielte den verstockten Sünder. Dann kam der kathegorische Imperativ : „Du hast zu wählen, welches Geschäft du erlernen willst — drei Tage gebe ich dir Bedenk-
zeit. Dann kommst du in die Lehre, wo man dir deine Mucken sicher austreibt. . .
Ohne weiteres Besinnen — wieso ich auf diese Idee kam, ist mir weder damals, noch später klar geworden — bemerkte ich: „Wie wäre es, wenn ich die Buchbinderei erlernte ?"
„Buchbinder. So, so. Hast du bestimmte Gründe dafür?"
„Nicht besonders starke; aber ich denke, dass das Buchbinden nicht allzuschwer sein kann, wenigstens kam mir das beim Zuschauen so vor....... Uebrigens gehe ich später ja doch zum Theater ! ...."
So tragisch die ganze Scene war und so peinlich sie wohl hauptsächlich meinen Vater berühren mochte — er musste lachen, wurde aber bald wieder ernst und sprach das grosse Wort gelassen aus : „Junge Schauspieler, alte Bettler ! "
Thatsächlich hatte ich schon damals den Bühnenvogel, der auch später nie gänzlich ausflog. Der gab mir die Courage, die Bemerkung hinzuwerfen : „Ja, gewöhnliche Schau-
spieler — die mögen wohl an den Bettelstab gerathen; ich aber werde es zur Berühmtheit bringen. Es steckt so 'was in mir, das muss zum Vorschein kommen "
Mein Vater grinste und deutete nach einem Spiegel.
„Da guck hinein ", sagte er. „Solch' ein armseliges Gestell und ein total entstelltes Gesicht — das will zum Theater gehen — es ist zum Todtlachen."
Ich liess mich aber nicht irre machen, sondern bemerkte trocken: „Später wird sich das Alles noch verwachsen.
„Und legen, " lautete die lakonische Antwort, womit die Zukunfts-Musik umsomehr ein Ende hatte, als das Giftweib auf der Bildfläche erschien und mir ein Paar gezogene Augen zeigte, welche glühende Pfeile auf mich zu schleudern schienen.
Als die Canaille von dem Buchbinder- Piojekte hörte, war sie sofort mit dem Einwurf bei der Hand, dass das wohl hohes Lehrgeld kosten werde, das ich nie und nimmer werth sei.
Man solle mich auf's Land schicken, dort einem Schneider oder Schuster überliefern — das koste gar nichts, u. s. w.
Doch bestand mein Vater auf meinem Berufs-Wahlrecht.
Der Lehrling und sein Meister
In der Gestalt des Buchbindeimeisters Weber wurde bald einer jener „Krauterer " entdeckt, welche zur fraglichen Zeit, weil sie keinen Gesellenlohn zahlen konnten, hauptsächlich durch Lehrbubenschindung „ihr Leben machten ", wie man hierzulande sich auszudrücken pflegt. Diese Lehrzeit beschrieb ich bereits in der Schrift „Acht Jahre hinter Schloss und Riegel". Da dieselbe anno 1886 im Gefängniss geschrieben wurde und aus demselben heraus geschmuggelt werden musste, erschien sie anonym, weshalb ich von mir selber in dritter Person sprach. Ich nehme dem einschlägigen Kapitel, knapp und präcise, wie es gehalten ist, das Folgende :
„Diese Lehrzeit gestaltete sich aber bald zu einer völligen Sclaverei. Obgleich der biedere Lehrmeister sich hundert Gulden Lehrgeld zahlen liess und verlangte, dass der Lehrling sein Bett mitbringe und für seine Wäsche aufkomme, beutete er sein Opfer bis zum letzten Blutstropfen aus. Im Sommer musste einfach von 5 Uhr Morgens bis zum Sonnenuntergang gearbeitet werden und im Winter dehnte sich die Schinderei oft gar bis 10 und 12 Uhr Nachts aus. Ausserden gewerblichen Arbeiten hatte der schwächliche Bursche noch Hausknechts- und Kindsmagds-Dienste zu leisten.
Dass er unter solchen Umständen seinen Beruf nicht Heben lernte, leuchtet wohl ein. Aber er betrachtete auch seine Lehrzeit nur als eine Warteperiode. Und worauf wartete er wohl? Er sehnte sich den Augenblick herbei, wo er ausgewachsen sei und sich die Entstellung seines Gesichtes, wie er sich einredete, verzogen haben werde. Dann wollte er (wie bereits im vorigen Abschnitt angedeutet wurde) die Bretter beschreiten, welche die Welt bedeuten.
Das war eine Idee, für welche er Tag und Nacht schwärmte und von der ihn Niemand abzubringen vermochte, bis es endlich klar zu Tage lag, dass er körperlich theaterun-
fähig sei.
Als Lehrling vermochte er Letzteres noch nicht vorauszusehen; und er bereitete sich mit einer unverwüstlichen Hartnäckigkeit und allen Hindernissen zum Trotte auf seinen
vermeintlichen späteren Beruf vor.
Wenn er fortgeschickt wurde, um fertige Waaren abzuliefern, Rohmaterialien einzukaufen oder auch für die Meisterin Marktgänge zu thun, so pflegte er auf der Strasse - — auswendig oder nach dem Buche — Gedichte oder ganze dramatische Scenen zu deklamiren, was mitunter die Strassen- jugend zu förmlichen Zusammenrottungen veranlasste. Mancher erwachsene Sachkenner aber, der den Knaben recitiren hörte, pflegte da zu sagen : „Schade um den Jungen, dass er
nicht für's Theater ausgebildet werden kann."
Geld hatte der arme Bursche natürlich keines; wenn er also einer Theatervorstellung beiwohnen wollte, welches Verlangen insbesondere an Sonntagen Zu einem unwiderstehlichen sich gestaltete, so musste er zusehen, dass das umsonst
geschehen konnte.
Er schlich sich auf die Bühne oder ins Orchester und wusste für längere Zeit die daselbst dienstthuenden Geister durch allerlei falsche Vorspiegelungen in guter Laune ihm
gegenüber zu erhalten.
Kaum hatte indessen der prosaische Buchbindermeister den Kunstenthusiamus seines Eleven entdeckt und ausgefunden, auf welche Weise der letztere die Musen belauschte, so gab er auch schon dem Theaterdiener und Orchesterfactotum diesbezügliche Winke mit dem Zaunpfahle. Johann wurde zum Tempel hinausgeworfen, so bald man ihn erblickte.
Das konnte ihn jedoch nicht entmuthigen, sondern spornte ihn nur dazu an, seinen Zweck, den feindlichen Gewalten zum Trotz, zu erreichen. Er wählte nun den soge-
nannten Schnürboden, einen Raum, welcher sich oberhalb der Bühne befindet, als seine Privatgallerie aus. Um sicherer dort- hin gelangen zu können, pflegte er sich schon eine Stunde vor Beginn der Vorstellung, wo die Bühne noch ganz dunkel war, einzuschleichen und zu seinem Elysium emporzuklettern.
Sein spätes Nachhausekommen trug ihm fast an jedem Montag Morgens die schönsten Hiebe ein, aber am nächstfolgenden Sonntag waren dieselben längst verschwitzt, und
die Schleichwege der Kunst wurden abermals beschritten.
Kam vollends eine berühmte Grösse, die vielleicht nur in 3 — 4 Vorstellungen, und zwar an Wochentagen, auftrat, nach Augsburg, so war für unseren jungen Theaterschmächtling schon gleich ganz und gar guter Rath theuer. Weder Geld,
noch Zeit, noch Erlaubniss zum Theaterbesuch — , da gab es nur noch Eines, den Reissaus.
So oft ein Theater-Phänomen Gastrollen in Augsburg gab, brannte Johann seinem'Lehrmeister durch und kam erst wieder, wenn die Kunstleistungen genossen waren. Da wurde am Tage Brod gebettelt und Nachts gleich auf dem Schnürboden, wo es warm war, geschlafen. Die obligaten Hiebe für die eine Desertion hinderten niemals eine anderweite, so bald sich nur das kritische Verlockungsobject zeigte.
So enthusiastisch Most in seiner Jugendzeit für's Theater schwärmte, so entschieden verabscheute er schon zu jener Zeit die Kirche und allen Religionskram. Wenn sein Lehr-
meister ein Buch zu binden hatte, dessen Titel errathen liess, dass es die Pfaffen angreife, so nahm Johann gewiss dasselbe in seine Dachkammer und las darin bis spät in die Nacht hinein.
Zu damaliger Zeit existirte aber in Baiern ein Gesetz, wo- nach alle jungen Leute bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre an Sonntagen Nachmittags die sogenannte „Chri-
stenlehre" zu besuchen hatten, widrigenfalls ihnen der Polizei-Arrest offen stand. Diesem letzteren sollte unser Johannes bald entgegengehen.
Es war ihm zu albern geworden, alle sechs Wochen vorschriftsmässig zu beichten, und er blieb daher von der Sündenlosscheuerung fort; auch verleitete er mehrere andere
Burschen seines Alters, ein Gleiches zu thun. Darob gab es am nächsten Sonntag eine wahre Kirchen-Sensation. Als der Pfaffe über die Beichten der Betreffenden keine Quittungen eingereicht bekam, zerrte er die verstockten Sünder bei den
Öhren aus den Bänken und hiess sie bis nach der „Christenlehre" auf's Kirchenpflaster knieen. Hernach schleppte er die Bockbeinigen nach seinem Zimmer, prügelte Einen nach dem Anderen tüchtig durch und zwang sie schliesslich, ihm augenblicklich zu beichten. Most verstand es jedoch, sich dieser geistlichen Nothzucht durch Flucht zu entziehen. Auch nahm er sich vor, künftighin gänzlich von der Christenlehre fern zu bleiben. Die Consequenzen seines diesbezüglichen Handelns bestanden in einer Vorladung zur Polizei.
Am 17. April 1862 klopfte es an der Thüre des Buchbinders. Das übliche „Herein 1 " war von Innen noch nicht ganz verklungen, als von Aussen auch schon im Feldschritt
ein Polizist seinen Einzug bewerkstelligte.
„Ist hier nicht der Lehrling Johann Most?" fragte der Uniformirte, indem er eine Vorladung aus der Tasche zog. Und das verdutzte Gesicht des biederen Meisters hatte noch keine Antwort ahnen lassen, so schnarrte es unter dem kommissalen Schnurrbart auch schon weiter: „Der Lehrling Johann Most soll heute Nachmittag um drei Uhr zum Herrn Aktuar Schmidt kommen." Dann machte dieser Schutzengel noch klar, dass er vier Kreuzer Bestellgeld zu bekommen habe, sackte ein und zog ab.
Die Scene, welche zwischen Meister und Lehrling sich nun abspielte, kann der Leser leicht errathen, insbesondere, wenn er selber einmal verdammt gewesen sein sollte, eine „Lehrzeit" zu bestehen.
Zur bestimmten Stunde wandelte das Bürschchen nach dem Polizeiamt.
Der Polizeiaktuarius, ein echter Mandarin, brannte dein armen Jungen 24 Stunden Polizeiarrest auf, welche er prompt abgesessen hat, und denen ausserdem noch diverse Schopfbeuteleien, Rohrhiebe und Grobheiten seitens des Lehrmeisters hinzugefügt wurden.
„Gebessert" haben diese Prozeduren aber den bösen Johannes keineswegs. Während seines Aufenthaltes im „Bürgerstübchen", wie der Arrest für kleine Vergehen ge-
nannt wurde, gelobte er sich vielmehr, von nun ab niemals mehr eine Kirche zu betreten; und er hat seinen Vorsatz getreulich gehalten, ohne dass das übrigens weitere schlimme
Folgen für ihn gehabt hätte.
Wie gar oft zuvor schon, so kam es am 14. April 1863 zwischen Most und dem Meister zu einer jener Controversen, bei welchen das Ende vom Liede Prügel für den Schwächeren
durch den Stärkeren sind.
Den Ausgangspunkt des Streites bildete ein angebrannter Leimpinsel, welcher den Tyrannen der Werkstatt dermassen in Wuth versetzte, dass er die Leimpfanne dem Jungen, welcher das Malheur verschuldet haben sollte, an den Kopf zu werfen suchte, welches Ziel er indessen glücklicher Weise verfehlte.
„Ich will Gott danken, wenn Du, Galgenstrick, erst einmal aus meinem Hause bist," rief das erzürnte Meisterlein.
„O," entgegnete der so Adressirte phlegmatisch „Sie brauchen mich ja nur freizusprechen. Meine Zeit ist ohnehin schon in sechs Wochen abgelaufen."
„Meinethalben gehst Du lieber heute wie morgen zum Teufel," brüllte der durch solche „Frechheit" noch mehr gereizte Zünftler.
Der Lehrbub aber nahm die Sache sehr wörtlich, wenn er auch in Bezug auf den Teufel glaubte, dass er bei demselben bisher gewesen sei, also ihn nicht erst aufzusuchen
brauche.
Er nahm seine Mütze vom Nagel, huschte zurThüre hinaus, schnürte in der Dachkammer sein Bündel und eilte nach Hause, um seinem Vater die überraschende Mittheilung zu
machen, dass er nun „frei" sei."
Die Wanderschaft und ihre Vorschriften
Als ich raeinen „Lehrbrief" in der Tasche hatte, fühlte ich mich nicht übel als „freier Mann" und aus voller Brust rang es sich durch die Schwadronierritze: „Hinaus in die
Ferne!" Weg von dem Schauplatz stiefmütterlicher Abfütterung und lehrmeisterlicher Stockhiebe — Flucht von einer „Heimath", die ich hasste! Sofort bewarb ich mich
um ein „Arbeitsbuch", ohne welches damals kein , Handwerksbursche" von Ort zu Ort sich bewegen konnte, während es andererseits Vorschriften enthielt, die bei genauerer Besichtigung humorverderbend wirken mussten.
Da dieselben gleichzeitig zur Charakteristik der damaligen Polizeiverhältnisse und der Klassenlage der Arbeiter dienten, lasse ich im Nachstehenden einen Extrakt daraus
folgen:
„Die betrügliche Verfertigung oder Verfälschung eines Arbeitsbuches, wie auch der wissentliche Gebrauch eines solchen gefälschten Arbeitsbuches wird mit Gefängniss von drei Monaten bis ein Jahr bestraft. Auch Handlungen dieser Art, bei welchen sich das obige Merkmal nicht findet, unterliegen polizeilicher Ahndung!! In den Fällen, wo die oben bezeichneten Handlungen in ein schwereres Vergehen oder Verbrechen übergehen, kommen die hierüber im Strafgesetzbuche enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung. — Gesetz vom 11. September 1825, Gesetzblatt vom Jahre 1825, S. 52 f.
* * *
Die Gesellen sind im Allgemeinen verpflichtet, an allen gewöhnlichen Wochentagen ohne Ausnahme der abgewürdigten Feiertage, die festgesetzten Stunden zu arbeiten, dem Meister Achtung zu beweisen und seinen Anordnungen in Bezug auf die aufgetragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten.
Das Feiern der sogenannten blauen Montage und das Arbeiten für eigene Rechnung bleibt den Gesellen durchaus Verboten. Gegen Meister, welche dieses dulden, wird mit
Strafe eingeschritten.
* * *
Die Gesellen können die Arbeit ohne vorgängige Aufkündigung verlassen, wenn sie von dem Meister thätlich misshandelt wurden, derselbe den versprochenen Lohn oder die
sonstigen Gegenleistungen ohne genügenden Grund vorenthält; ferner, wenn sie durch schwere Krankheit zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden; endlich wenn schwere
Krankheit oder der Tod eines der Eltern den Austritt erfordert.
Gegen Handwerksgesellen, welche ausser den in § 28 angeführten Fällen aus dem Dienste gehen, oder nach § 27 entlassen werden, hat neben geeigneter Bestrafung auch eine fortgesetzte Polizeiaufsicht — nach Umständen die Verweisung in die Heimath einzutreten.
Gesellen, welche sich der Arbeit an den dazu bestimmten Tagen entziehen, sind augenblicklich in die Werkstätte zurückzuschaffen und zu bestrafen.
Gegen die Verabredung mehrerer Gesellen zum Austritte aus der Arbeit aus Trotz oder Ungehorsam gegen die Obrigkeit, oder in der Absicht, das Zugestehen einer von ihnen gemachten Forderung zu erzwingen, ist nach Massgabe der bestehenden Strafgesetze unnachsichtlich einzuschreiten.
* * *
1. Jeder Handwerksgeselle, welcher an unerlaubten Gesellen- und andern Verbindungen, Gesellengerichten, Verrufserklärungen und dergleichen Missbräuchen Antheil nimmt, wird nach Massgabe der bestehenden Gesetze und Verordnungen strenge bestraft und nach Abnahme des an die Heimaths-Behörde zu sendenden Arbeitsbuches mit gebundener Reiseroute in seine Heimath gewiesen.
Verordnung vom 14. Januar 1841.
2. Wandernde Handwerksgesellen, welche nicht über vollkommen zureichendes Reisegeld sich ausweisen können, werden zur Rückkehr in die Heimath angehalten.
3. Die Verordnung vom 28. November 1816 Bettler und Landstreicher betr., wird auch auf wandernde Handwerksgesellen angewendet, welche auf dem Bettel oder vagirend betroffen werden, und insbesondere die Heimlieferung solcher Individuen jedesmal verfügt werden.
4. Die während der Wanderschaft wegen Uebertretungen verfügten Strafen sind in das Arbeitsbuch einzutragen.
5. Das Reisen der Handiverks gesellen in die Schweiz ist verboten.
Verordnung vom 2. März 1845.
6. Der allgemeinen Militärkonscription ist jeder Baier unterworfen und zwar in jenem Jahre, in welchem er sein ein und zwanzigstes Lebensjahr zurückgelegt.
Mit dem ersten Januar des darauffolgenden Jahres tritt jeder Konscriptionspflichtige in die Militärpflichtigkeit und hat sich in dem gesetzlichen Termine bei seiner Konscriptionsbehörde zu melden, §§ 5, 6 und 20 des Heers-Ergänzungs-
Gesetzes vom 15. August 1828.
7. Hinsichtlich der Visirung der Arbeitsbücher im Inlande gelten folgende Bestimmungen:
a. Jeder Handwerksgeselle ist verpflichtet beim Antritte der Wanderschaft sein Arbeitsbuch der betreffenden Distriktspolizeibehörde zur Visirung vorzulegen.
Die Distriktspolizeibehörden dürfen den ihnen selbst als ordentlich oder verlässig bekannten oder als solche von zuverlässigen Personen empfohlenen und mit genü-
genden Reisemitteln versehenen Handwerksgesellen beim Antritte der Wanderschaft auf Ansuchen das Visa unmittelbar bis an den Ort, an Welchem sie Arbeitsgele-
genheit erweislich erhalten oder doch wahrscheinlich finden werden, ertheilen.
Bei den zu Fuss Wandernden ist es dem Ermessen der Distriktspolizeibehörden anheimgestellt, die Erholung eines Zwischenvisa an einem von dem Wandernden zu
berührenden Amtssitze vorzuschreiben, falls das vorläufige Reiseziel jedenfalls erst nach vier Tagen erreicht werden kann.
b. Denjenigen Handwerksgesellen, welche beim Antritte der Wanderschaft ein bestimmtes vorläufiges Reiseziel nicht zu bezeichnen vermögen, sondern überhaupt Ar-
beit suchen wollen, darf auf Ansuchen unter geeigneter Berücksichtigung der vorliegenden Aufschlüsse über den Leumund, dann der Reisemittel, des erforderlichen
Reisegepäckes und des ganzen Aeussern des Wandern- den das Visa für zwei bis drei Tagsrouten eitheilt werden.
c. Die Bestimmungen unter Lit. a und b finden gleichmässig Anwendung auf die an einem Orte in Arbeit gestandenen und nunmehr ihre Wanderschaft fortsetzenden Handwerksgesellen.
d. Handwerksgesellen, welche beim Antritte oder bei Fortsetzung der Wanderschaft die unter Lit. a angeführten Voraussetzungen in ihrer Person nicht vereinigen, jedoch aus irgend einem Grunde von der Wanderschaft nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, beziehungsweise zur zwangsweisen Verweisung in ihre Heimath nicht geeigenschaftet sind, wird im Falle des Wanderns zu Fuss das Visa nur für kürzere Distanzen ertheilt, und nach Umständen zur Pflicht gemacht, bei
jeder Distriktspolizeibehörde, deren Sitz sie berühren, das Visa zu erholen.
e. Der reisende Handwerksgeselle ist verpflichtet, von jeder beabsichtigten Aenderung seines Reisezieles oder seiner Reiseroute der nächst gelegenen Distriktspolizeibehörde
Anzeige zu machen. Derselbe ist ferner verpflichtet, jede mehr als einen Tag betragende Unterbrechung seiner Reise vor Erreichung des durch das letzte Visa bezeichneten Reisezieles der nächst gelegenen Distriktspolizeibehörde zur Anzeige zu bringen.
f. Abgesehen von den hier bezeichneten Fällen ist der reisende Handwerksgeselle verpflichtet, bei der Distriktspolizeibehörde desjenigen Ortes, auf welchen sein
letztes Visa lautet, behufs der Erlangung des Visas zur Fortsetzung seiner Reise sich zu melden.
8. Gegen eigenmächtige Abweichungen von der Reiseroute oder auffallende nicht gerechtfertigte Verzögerungen der Reise findet strenge Einschreitung statt.
9. Nach der Verordnung vom 12. Juli 1812 wird jeder wandernde inländische Handwerksgeselle, welcher das ihm blos auf das Inland ausgestellte Arbeitsbuch zum Wandern in das Ausland missbraucht oder das ihm auf bestimmte ausländische Staaten beschränkte Wandern unbefugt auch zum Wandern in andere Länder ausdehnen würde, im ersteren Falle mit sechswöchentlichem, im letzteren mit dreiwöchent-
lichem Arreste bestraft.
Wer über die gestattete Zeit im Auslande bleibt, hat ebenfalls eine sechswöchentliche Arreststrafe zu gewärtigen.
* *
Inhaber erhält hiermit die polizeiliche Bewilligung zum Wandern in den deutschen Bundesstaaten bis Ende Oktober 1867, sowie in den k. k. österreichischen Staaten auf die Dauer von drei Jahren mit dem Auftrage von seinem jeweiligen Aufenthaltsorte halbjährig sichere Nachricht anher gelangen zu lassen.
Zugleich wird derselbe auf das Verbot des Eintritts in fremde Kriegsdienste ohne allerhöchste landesherrliche Genehmigung hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht.
Augsburg den 20. April 1863.
Stadtmagistrat.
Der I. Bürgermeister:
Forndran.
* * *
Ausgestattet mit solcher , .Legitimation" und ausgerüstet mit einer mässig bepackten Tasche, zog ich, begleitet bis zum Thore von meinem Vater, der mich mit 1 5 Gulden Reisegeld versehen hatte, am 21. April 1863 zum Städtle hinaus — hinein in eine feindliche Welt, in der ich nun mein ,, Glück" suchen, leider aber nicht finden sollte.
Ich war ein recht kleines, mageres Kerlchen, das knapp 75 Pfund an Gewicht und keine besonders einladende Visage aufzuweisen hatte. Trotz alledem fühlte ich mich „stolz wie ein Spanier" und wanderte fürbass. Schon der Gedanke, jetzt kein buchstäblicher Prügel--Knabe mehr zu-sein, machte mich jauchzen und singen, und der Himmel hing mir voller Bassgeigen.
Die erste Exkursion nach Frankfurt
Die erste Exkursion führte mich nach Frankfurt am Main, wo ich am 27. April eintraf. Was mich nach dort gezogen hatte, war die damals noch „bestandene" freie Reichsstadt — die „Republik", hinter welcher ich ein wirklich freies Leben witterte, welche Illusion mir bald genug ausgetrieben wurde.
Im Gastzimmer der Buchbinderherberge war auf einer grossen schwarzen Tafel zu lesen, dass bei Ewald Arbeit zu bekommen sei. Während ich den Mann aufsuchte, fühlte ich
arge Herzbeklemmung. Nach dreitägiger Wanderfreiheit (beschränkt durch Polizeiaufsicht) sollte ich wieder ins Herrenjoch. Ich empfand, wenn auch nur ganz dunkel, dass ich mein eigener Sklavenhändler sei, und obendrein mich zu einem Preise werde losschlagen müssen, der nicht meinen Wünschen entsprechen dürfte.
Der fragliche Buchbindermeister musterte mich mit Kennerblick, und nachdem er Einsicht in mein Arbeitsbuch genommen und daraus ersehen hatte, dass ich soeben erst der „Lehre" entrann, gab er mir zu verstehen, dass er es mit mir „probiren" wolle. Betreffs Arbeitszeit, Lohn etc. werde ich alles Nähere aus den Zunft-Vorschriften ersehen, die ich nun einzuholen und dafür mein Arbeitsbuch beim Obermeister zu
hinterlegen hatte. Zuvor aber musste ich zum Stadt-Chirurgen, welcher mich „untersuchte" und durch ein Certificat bestätigte, dass ich „hautrein" sei. Dieser Schein war auf der Polizei abzugeben, wo ganze Rudel von Handwerksburschen
Stunden lang zu warten hatten, bis Einer nach dem Andern abgefertigt wurde. Endlich kam auch ich an die Reihe und ein grosser Stempel wurde in mein Arbeitsbuch geprägt«
Darauf war zu lesen : „Kann in Arbeit treten", womit gesagt sein sollte, dass meine Papiere in Ordnung seien, kein Steckbrief gegen mich vorliege etc.
Das Zunftbuch enthielt ähnliche mittelalterliche Bestimmungen, wie das im letzten Kapitel gekennzeichnete Arbeitsbuch, nur waren dieselben noch unverschämterer Natur. Als Normalarbeitszeit waren 14 Stunden per Tag vorgesehen. Der Minimallohn sollte einen Gulden per Woche nebst Kost und Quartier .betragen, u. s. w.
In der That gingen meine Einkünfte über solche Minimalität nicht hinaus, und die Beköstigung liess an Einfachheit nichts zu wünschen übrig. Ein Leib Kommissbrod aus
der preussischen Kaserne hatte als Frühstück einer ganzen Woche zu dienen, nur wurde täglich eine Tasse schwarzer Kaffee ohne Zucker hinzugefügt. Mittags gab es regelmässig dünne Suppen, billiges Gemüse und ein wenig total ausgekochtes Fleisch; Abends drei Scheibchen Wurst und Pellkartoffeln. Geschlafen wurde in einer Dachkammer voller Wanzen mit einem anderen Gesellen zusammen in einem armseligen Bett, dessen Leintücher höchstens alle sechs Wochen gewechselt wurden. Morgens um halb sechs Uhr kletterte der biedere Zünftler schon die Bodenstiege empor und hämmerte so lange auf die Kammerthüre bis wir aufstanden. Abends um neun Uhr wurde das Haus geschlossen und das Lager bezogen. An ein Ausgehen wäre bei solchem Lohn ohnehin nicht zu denken gewesen. Höchstens langten die paar Kreutzer zum Besuch eines Kaffeehauses am Sonntag, wo man bei geringem Verzehr eine beliebig lange Zeit verweilen und Zeitungen lesen konnte.
Uebrigens war mein Fall keineswegs ein ausnahmsweise schlechter, vielmehr behandelten die Zunftmeister der „freien Stadt" ihre Gesellen durchschnittlich nicht viel besser. Höchstens brachten es die bestqualifizirten derselben auf 2 — 3 Gulden Wochenlohn und Naturalverpflegung. Und, füge ich hier schon im voraus ein, während meiner ganzen fünfjährigen Handwerksburschen-Epoche habe ich in ganz Mitteleuropa — Deutschland, Oesterreich, Schweiz etc. — ähnliche Verhältnisse angetroffen, was sich namentlich Diejenigen merken sollten, welche nie müde werden, von der „guten alten Zeit" Glückseligkeits-Fabeln zu erzählen.
Mein Ausbeuter war aber nicht nur ein solcher pure and simple, sondern er war auch ein unverschämter Cränk, dem nichts recht gemacht werden konnte, weshalb es fast täglich
Radau zwischen ihm und mir setzte. Nach Verlauf von vier Wochen kündigte ich, um in weiteren 14 Tagen mein Bündel zu schnüren. In mein Arbeitsbuch trug der Obeimeister ein : „Stand hier mit gutem Betragen in Arbeit".