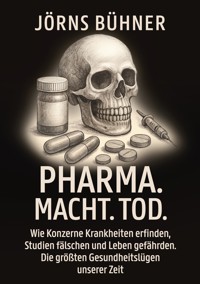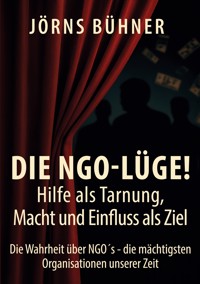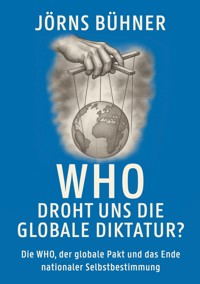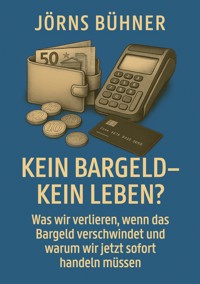
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn das Bargeld verschwindet? Digitale Zahlung klingt bequem, aber der Preis dafür ist unsere Freiheit. Was als Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit der schleichende Umbau unserer Gesellschaft. Wenn Bargeld verschwindet, verschwindet auch ein Stück unserer Selbstbestimmung. Jeder Einkauf wird registriert, jede Zahlung kontrolliert. Ohne Bargeld gibt es kein anonymes Leben mehr, und kein Entkommen aus der totalen Überwachung. In "Kein Bargeld - kein Leben?" zeigt Jörns Bühner mit eindringlichen Worten, wohin der Weg führt, wenn wir die Entwicklung nicht aufhalten: Ein System aus digitaler Kontrolle, sozialer Ausgrenzung und technokratischer Steuerung, ganz legal, ganz bürokratisch, ganz real. Wer nicht mitspielt, verliert Zugang zu grundlegenden Rechten. Kein Bargeld bedeutet: totale Abhängigkeit. Dieses Buch ist ein Weckruf. Es geht nicht um Technikfeindlichkeit, es geht um Selbstbestimmung. Um den Erhalt unserer Demokratie. Um das Recht, unser Leben ohne digitale Fessel zu gestalten. Noch gibt es eine Wahl. Noch ist Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel. Doch wie lange noch? Lesen Sie dieses Buch, bevor es zu spät ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wer bar zahlt, bleibt Mensch. Wer digital zahlt, wird Datensatz.“
Jörns Bühner
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Warum dieses Buch geschrieben werden muss
Bargeld als Symbol und Werkzeug der Freiheit
Teil I – Die Geschichte des Bargelds
Kapitel 1: Von Muscheln zu Münzen: Die Anfänge des Geldes
Tauschhandel, Naturalgeld, frühe Zahlungsmittel
Kapitel 2: Die Geburt der Münze – Lydien und die ersten Geldsysteme
Der Schritt zur standardisierten Währung
2.
Papiergeld – Die chinesische Erfindung, die die Welt veränderte
Song-Dynastie, Marco Polo, europäische Nachahmung
3.
Geld und Macht – Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert das Volk
Geldhoheit und ihre Bedeutung in Monarchien und Nationalstaaten
4.
Das 20. Jahrhundert: Die Blütezeit des Bargelds
Wirtschaftswunder, DM, Dollar, Bargeld als Normalität
Teil II – Der Angriff auf das Bargeld
6.
Die schleichende Einschränkung
Bargeldobergrenzen, Verbot großer Scheine, Manipulation durch Banken
7.
Die wahren Gründe hinter der Bargeldfeindlichkeit
Kontrolle, Überwachung, Enteignung, Verhaltenssteuerung
8.
Die offiziellen Vorwände – Ein kritischer Blick
Geldwäsche, Terrorismus, Steuerhinterziehung – wie stichhaltig sind sie?
9.
Digitalisierung als Trojanisches Pferd
Warum „bequem“ nicht immer gut ist
10.
Das Märchen vom „modernen Bürger“ ohne Bargeld
Wer profitiert wirklich vom digitalen Zahlungszwang?
Teil III – Totalüberwachung und die Gefahr des Sozialkreditsystems
11.
China als Vorbild? Die dunkle Seite der digitalen Kontrolle
Social Credit, Gesichtserkennung, Verhaltenserfassung
12.
CBDC – Die digitale Zentralbankwährung
Was sie ist, was sie kann – und warum sie gefährlich werden kann
13.
Programmierbares Geld – Ein Albtraum in der Praxis
Einschränkungen, Ablaufdaten, zweckgebundenes Geld
14.
Europa und die schleichende Angleichung an autoritäre Systeme
EU-Digitalstrategie, Identitätsmanagement, E-Wallets
Teil IV – Der Mensch im Fadenkreuz
15.
Datenschatten statt Privatsphäre
Wie Zahlungsdaten zu Persönlichkeitsprofilen werden
16.
Verhaltenslenkung durch Geldsysteme
„Wer gutes Verhalten zeigt, darf kaufen“
17.
Könnte es jedem passieren? Ja!
Denkbare Szenarien der Disziplinierung durch Geldzugriff
18.
Der digitale Untertan – Gefahren für Demokratie und Menschenwürde
Teil V – Was wir tun können
19.
Bargeld benutzen – eine stille Form des Widerstands
Warum es wichtig ist, bar zu zahlen – gerade jetzt
20.
Zivilcourage zeigen – Aufklären, diskutieren, vernetzen
Möglichkeiten zur Aufklärung im Alltag
21.
Politisch aktiv werden – der Kampf um das Bargeld ist auch ein Kampf um Rechte
Welche Parteien stehen wofür? Was kann man einfordern?
22.
Technologische Alternativen mit Freiheit im Fokus
o Kryptowährungen, Bar-Crypto-Mix, lokale Tauschsysteme
Vorwort
Warum dieses Buch geschrieben werden muss
Es gibt Momente in der Geschichte, in denen die stillen Veränderungen tiefere Spuren hinterlassen als große Katastrophen. Nicht jeder Umbruch wird von lauten Trommeln oder lodernden Feuern begleitet. Manchmal schleichen sich die tiefgreifendsten Eingriffe in unser Leben durch Nebentüren, durch bürokratische Floskeln, durch scheinbar harmlose Reformen und auch durch Lügen.
Mit diesem so wichtigen Buch möchte ich auf eine dieser sehr gravierenden Veränderungen hinweisen. Es ist eine, die viele bereits spüren, aber nur wenige vollständig wirklich verstehen oder deren Folgen absehen können oder wollen. Das kann jedoch existenziell hochgradig gefährlich sein.
Die langsame, fast unmerkliche Abschaffung des Bargeldes ist mehr als nur eine technische Anpassung an den Zeitgeist. Sie betrifft den innersten Kern des Menschseins – die Möglichkeit, zu handeln, zu tauschen, zu schenken oder zu kaufen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen.
Bargeld steht nicht einfach nur für Münzen oder Scheine. Es steht für Autonomie, für Selbstbestimmung und für Würde. Es erlaubt dem Menschen, sich ohne Beobachtung und Kontrolle zu bewegen, ohne Erklärung zu leben, ohne digitale Abdrücke zu existieren.
In einer Welt, in der immer mehr Prozesse automatisiert werden, in der Datenflüsse schneller reisen als Gedanken, in der Algorithmen das Verhalten deuten und verwalten, gerät der Mensch leicht in eine Rolle, die ihm nicht entspricht.
Er wird nicht als fühlendes, denkendes Wesen betrachtet, sondern als Konsument, als Verhaltensmuster, als wirtschaftliche Einheit.
Mein Buch „Kein Bargeld- kein Leben? entsteht aus eht tiefer Sorge. Aus einem wachen Blick auf Entwicklungen, die bereits Realität sind und aus dem festen Willen, dass eine Gesellschaft auch morgen noch aus freien Menschen bestehen soll – nicht aus verwalteten Subjekten. Es richtet sich an Menschen, die noch selbst denken, die spüren, dass etwas Wesentliches verloren geht, wenn das Bargeld verschwindet. Es ist geschrieben für jene, die erkennen, dass Freiheit nicht laut genommen wird, sondern leise verloren geht.
Aber vor allem an auch all jeen, die noch gar nicht wirklich verstehen könne, warum das Bargeld so elementar wichtig für unser Leben ist. Ein Leben, was noch immer in Freiheit stattfinden kann. Aber wie lange noch?
Möge mein Buch ein kleiner Beitrag sein, damit wir noch rechtzeitig hinschauen. Möge es aufklären, verbinden und zum Handeln anregen.
Und möge es am Ende vor allem eines tun: Wachrütteln und hinweisen darauf, dass Freiheit nicht gegeben ist, sondern gestaltet und erhalten werden will.
Kapitel 1 Von Muscheln zu Münzen – Die Anfänge des Geldes
„Geld ist ein Mittel, das uns erlaubt, Dinge zu besitzen, ohne sie zu verstehen.“
Georg Simmel
Philosophie des Geldes
Wenn der Mensch sich in seiner Geschichte zu etwas immer wieder auf neue Weise verhalten hat, dann zum Wert. Nicht zur Währung, nicht zur Ware, sondern zum Wert an sich. Er hat getauscht, lange bevor er gerechnet hat. Er hat gegeben, ohne Buch zu führen. Er hat empfangen, ohne zu fragen, was es im Vergleich wert war.
Denn in einer Welt, in der Menschen noch nah beieinander lebten, genügte ein Blick, ein Wort oder eine Geste, um zu wissen, was fair war. In solchen Gesellschaften war Geld kein Muss. Vertrauen war die Währung.
Doch mit dem Wachsen der Distanzen, mit dem Ausbreiten von Handel über Flüsse, Berge, Meere und Kontinente hinweg, wurde das Vertrauen zur Ware. Es wurde fassbar, zählbar und auch transportierbar und damit auch manipulierbar. Der Mensch erfand das Geld nicht aus Raffgier. Er erfand es, weil er Ordnung suchte in einer Welt, die größer wurde, komplexer, unübersichtlicher. Und so begann eine Entwicklung, die bis heute unser Leben prägt.
In den frühesten Gesellschaften dienten Naturmaterialien als Zeichen des Werts. Muscheln, vor allem Kaurischnecken, galten in weiten Teilen Afrikas, Asiens und der Südsee über Jahrhunderte hinweg als Zahlungsmittel. Sie waren selten, schwer zu fälschen, leicht zu transportieren und gleichzeitig schön anzusehen – all das machte sie geeignet als Symbol für etwas, das nicht mehr nur an das Objekt selbst gebunden war. Die Muschel war nicht mehr nur Muschel – sie war Wert.
Später waren es Vieh, Salz, Teeziegel, Bernstein, Getreide – alles, was als knapp und begehrt galt. Menschen trugen mit sich, was sie hatten, und wenn sie tauschten, ging damit nicht nur Besitz über, sondern auch ein Stück Geschichte, ein Stück Leben.
Diese frühen Tauschformen waren eingebettet in soziale Strukturen, in Riten, in Abhängigkeiten und Ehre. Es war ein Tausch zwischen Menschen – nicht zwischen Nummern.
Die ersten Metallmünzen, wie wir sie heute kennen, tauchten im 7. Jahrhundert vor Christus auf – im antiken Lydien, im heutigen Westen der Türkei. Der lydische König Alyattes und später sein Sohn Kroisos ließen kleine Stücke einer natürlichen Gold-Silber-Legierung, dem sogenannten Elektron, mit Zeichen versehen und in Umlauf bringen. Diese Münzen waren auch eine Botschaft. Sie sagten: Hier herrscht Ordnung. Hier herrscht eine Macht, die den Wert garantiert. Mit der Münze begann die Verbindung von Geld und Staat.
Es war ein epochaler Wandel. Von nun an lag der Wert nicht mehr in der Substanz allein, sondern im Symbol. Die Prägung auf dem Metall bedeutete Sicherheit – oder zumindest das Versprechen davon. Wer diese Münzen in Händen hielt, glaubte an das, was sie darstellten. Der Tausch wurde dadurch schneller, effizienter und einheitlicher. Aber er wurde auch mehr und mehr entmenschlichter.
Die Griechen übernahmen das lydische Modell, verfeinerten es, gaben dem Geld neue Formen, neue Bilder, neue Bedeutungen. Geld wurde Ausdruck von Kultur, von Identität. Die Römer perfektionierten das System, führten eine Vielzahl von Münzen ein, strukturierten ihren Staat mit Hilfe einer Währung, die von Britannien bis Ägypten anerkannt war.
Die Münze wurde so zur Stütze des Imperiums. Und damit wurde auch klar: Geld bedeutet Macht. Wer das Geld prägt, formt das Reich. Wer den Wert bestimmt, beherrscht das Denken.
Doch nicht nur Reiche wuchsen durch das Geld. Auch Korruption, Erpressung, Bestechung, Kriege – all das fand im Geld einen nützlichen Helfer. Was als Ordnung begann, diente bald auch dem Gegenteil. Münzen wurden entwertet, mit unedlen Metallen gestreckt, gefälscht, gestohlen.
Der Wert wurde zur Illusion und der Schein zur Wirklichkeit.
Trotz allem behielt Geld für den einfachen Menschen eine gewisse Beständigkeit. Eine Münze in der Hand bedeutete Sicherheit. Man konnte sie aufbewahren, sie weitergeben, sie verstecken. Niemand fragte nach dem Namen des Besitzers, niemand führte Buch.
Die Münze war stumm, aber sie sprach dennoch eine klare Sprache: Du hast etwas, das zählt. Du brauchst niemanden, der dich genehmigt.
Diese uralte Freiheit des Besitzes, diese stille Form der Würde, begleitete den Menschen über viele Jahrhunderte. Und sie wurde später vom Papiergeld weitergetragen – in neuer Form, aber mit ähnlicher Bedeutung.
Doch noch in der Zeit der ersten Münzen begann ein gefährlicher Gedanke sich zu entwickeln. Denn mit der Institution des Geldes kam auch die Idee, dass man den Menschen über das Geld formen könne. Wenn der Staat Geld ausgab, konnte er auch entscheiden, wie viel davon im Umlauf war.
Wenn der Herrscher prägte, konnte er auch entwerten. Und wenn der Handel über Grenzen ging, konnte man ihn lenken – mit Zöllen, mit Regeln, mit Geldpolitik. So wurde das Geld zum Werkzeug. Und wer es kontrollierte, kontrollierte nicht nur den Markt, sondern auch das Verhalten.
Diese Geschichte – die Geschichte vom Geld als menschlicher Erfindung und politischem Instrument – zieht sich bis in unsere Zeit. Sie beginnt nicht mit Banken. Sie beginnt mit Menschen, die Werte tauschten.
Und sie zeigt: Das, was heute bedroht ist, wurde einst mit großer Klarheit erkannt – dass unser Geld, richtig verstanden, ein Werkzeug der Freiheit sein kann. Aber falsch verwendet, ist es ein Mittel der Unterwerfung.
Quellen und weiterführende Literatur zu Kapitel 1:
Simmel, Georg
:
Philosophie des Geldes
, Suhrkamp, 2003 (Erstveröffentlichung 1900)
Graeber, David
:
Schulden. Die ersten 5000 Jahre
, Klett-Cotta, 2012
Garraty, John A.
:
A Short History of Financial Euphoria
, Penguin Books, 1993
Wray, L. Randall
:
Understanding Modern Money
, Edward Elgar Publishing, 1998
Seaford, Richard
:
Money and the Early Greek Mind
, Cambridge University Press, 2004
Maurer, Bill
:
How Would You Like to Pay? How Technology is Changing the Future of Money
, Duke University Press, 2015
Kapitel 2 Die Geburt der Münze – Lydien, Griechen, Römer und das Geld als Werkzeug der Macht
„Das Geld gleicht dem Meerwasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man.“
Arthur Schopenhauer