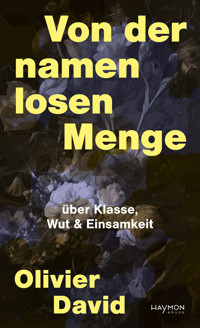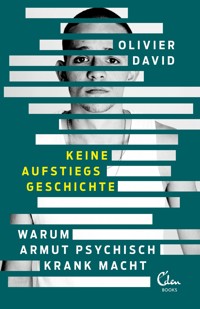
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Journalist und Autor Olivier David ist in Hamburg aufgewachsen – bei einer alleinerziehenden, überforderten, psychisch instabilen Mutter. Sie gibt sich Mühe, möchte ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen und schickt sie auf eine Waldorfschule. Doch die Familie ist arm, die Möglichkeiten sind begrenzt. Mit neun Jahren erfährt der Autor, dass sein Vater dealt. Zunächst scheint es so, als ob Olivier einen ähnlichen Weg einschlagen wird: Er scheitert am Fachabitur, kifft und trinkt täglich. Gerade als er es schafft, für seine Ziele zu kämpfen, holt ihn seine Familiengeschichte ein: Depressionen und Panikattacken zwingen ihn zur Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit. Olivier David erzählt aufrüttelnd davon, wie sich Armut und psychische Erkrankungen bedingen und von Generation zu Generation weitergetragen werden. »Keine Aufstiegsgeschichte« ist nicht nur ein persönliches Memoir, sondern auch ein hochaktuelles Buch darüber, wie toxisch das Aufwachsen und Leben in Armut für die Psyche wirklich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FürLucie
… von all diesem »Nie Aufgegebe«bin ich ganz ausgelaugt.
Mach One, Nicht von dieser Welt
Reden wir vielleicht deshalb die ganze Zeit über Aufstieg, weil er in der Realität immer seltener anzutreffen ist?
Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft
Eden Books
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © 2022 Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edenbooks.de | www.edel.com
1. Auflage 2022
Lektorat: Ulrike Ostermeyer, Berlin
Korrektorat: Rotkel. Die Textwerkstatt
Covergestaltung: zero-media.net, München
E-Pub-Konvertierung: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
ISBN 978-3-95910-361-9
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Der Abdruck des Zitats aus Oliver Nachtwey: Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. © Suhrkamp Verlag Berlin 2016 zu Beginn des Buches erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlages.
Der Abdruck des Songzitats zu Beginn des Buches erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Mach One und seines Managements.
Inhalt
Prolog
Aus den Angeln gehoben
Die wilden Siebziger
Schneckenhaus
Scheitern als Lebensweg
Grand-mère
Eskalation
Draußen vor der Tür
Ein Kind im Körper eines Mannes
Wenn nicht jetzt, Wan Tan?
Chinesisches Hinterland
Raus in die Welt
High vom Leben
Klassenfeind
Bretter, die die Welt bedeuten
Bretter, die kein Geld bedeuten
Allein
Lagerkoller
Grand-mère, letzter Akt
Tourist im eigenen Leben
Epilog
Diese Geschichte gibt die Erinnerungen des Autors wieder, die mit denen der erwähnten Personen möglicherweise nicht immer identisch sind.
Triggerwarnung
Im Kapitel »Schneckenhaus« werden Vorfälle sexueller und körperlicher Gewalt geschildert, in den Kapiteln »Eskalation« sowie »High vom Leben« kommt es ebenfalls zu Szenen körperlicher Gewalt. Wenn die Auseinandersetzung mit diesen Themen persönliche Folgen für dich haben könnte, dann lies die Stellen nicht oder zumindest nicht allein.
Prolog
Juni 2019. Mit ein paar anderen Fahrgästen steige ich von der Fähre, die mich zu meiner Freundin bringt. Wieder auf festem Boden, gehe ich die stählerne Brücke vom Ponton hoch, biege nach rechts ab, wechsle die Straßenseite und gehe den Weg am Deich entlang. Seit Stunden lodert der Hass in mir. Ich bin zittrig, aber voller Energie, als mich plötzlich eine Erkenntnis trifft: Diese Wut in mir hat System! Mit Lucies Stimme im Ohr, die mir von Belästigungen durch Mitschüler und Bekannte erzählt, stelle ich mir vor, wie die Typen sie damals in die Zange nahmen, einer von vorn, der andere von hinten, während sie zu perplex von dem abrupten Übergriff war, um sich zu wehren. Nur liegt dieser Vorfall schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Darf ich mich angesichts solcher Schilderungen, gerade wenn sie meiner Freundin passiert sind, ohnmächtig fühlen? Ja klar. Darf ich wütend sein auf diese erbärmlichen Würstchen, wenn sie mir erzählt, was genau passiert ist, welche Sprüche gefallen sind? Unbedingt. Aber warum jetzt, im Sommer 2019, als nicht nur diese Ereignisse lange vergangen sind, sondern auch zwischen ihren Schilderungen und meiner Wut bereits Monate liegen? Plötzlich begreife ich, dass mein Gehirn sich den Nährstoff für die Wut immer dann aus einem Reservoir an Erlebnissen, Erzählungen und Vorstellungen holt, wenn der Adrenalinpegel fällt und es gerade keinen aktuellen Anlass gibt.
So ist es auch jetzt am Deich. Ich stelle mir vor, wie meine Freundin von den Typen belästigt wurde. Ich male mir aus, dass wir diese Typen durch Zufall treffen und ich sie angreife, mich durch ihre Gesichter pflüge und auf ihre zu Boden fallenden Körper eintrete. In mir lodert der Hass, und es ist genug für alle da. In dem Film, der sich in meinem Kopf abspielt, starrt Lucie mich schockiert an, denn sie hat diese Seite an mir noch nicht kennengelernt. Doch ihr Blick ist mir egal, denn es geht schon lange nicht mehr darum, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Es geht um mein Gefühl der Ohnmacht, das sich so unerträglich demütigend anfühlt, dass ich es abschütteln muss. Bei dieser Vorstellung fährt ein grimmiger Schauer durch mich hindurch. Diese alte Freundin, die Wut, von der ich weiß, dass sie mir nicht guttut, auch wenn sich jede Begegnung mit ihr so vertraut anfühlt. Ich begreife, dass sie es ist, die mich deckelt, mich kleinhält. Anstatt mich zu fragen, wer ich sein möchte, habe ich mich dem immer gleichen Kampf in meinem Gedankengefängnis gestellt. Ich gegen die Macker, die meine Freundin angegrapscht haben. Ich gegen den Typen, der mich auf der Straße dumm angemacht hat. Ich gegen meine Mutter, ich gegen die Lehrer:innen an meiner Schule. Ich gegen die Welt.
Als ich mit achtzehn erfuhr, dass meine Mutter in ihrer Kindheit und Jugend von ihrem Vater jahrelang misshandelt worden war, gab mir ein Gedanke Trost: Immer wieder stellte ich mir vor, ihr Vater wäre nicht schon vor Jahrzehnten gestorben, sondern läge wegen irgendetwas im Krankenhaus; ich stellte mir vor, wie ich sein Zimmer betrete, an seinem Bett stehen bleibe, im Hosenbund die Waffe, so wie man das aus Gangsterfilmen kennt, nach der ich mit einer fließenden Bewegung greife und ihm, ohne zu zögern, ins Gesicht schieße. Das Letzte, was ich sehe, bevor da, wo gerade noch sein Mund war, eine große fleischige Wunde klafft, ist sein verdutzter Gesichtsausdruck. Er ist tot, bevor er überhaupt reagieren kann. Bumm. Rache. So einfach könnte es sein. Keine Worte, kein Triumph, einfach nur Rache. Eine Kompensation der Ohnmacht, dass dieser Mensch so viel Leid über unsere Familie gebracht hat, ohne dass meiner Mutter und ihrer Schwester je Gerechtigkeit widerfahren wäre. Realität werden meine Gewaltfantasien allerdings so gut wie nie, zum Glück. In meinen frühen Zwanzigern prügelte ich mich einige Male, weitaus häufiger aber stillte ich meinen Durst nach Adrenalin mit YouTube-Videos von Streetfights, Wald- und Wiesenkämpfen von Hooligans oder Videos aus Kriegsgebieten. Ob in der echten Welt oder in irgendwelchen Filmen, immer bin ich auf der Suche nach meiner Wut in der Welt. Jedes Mal, wenn sie mir in Form einer Faust entgegenschlägt oder ich beim Gucken von Videos das vertraute Kribbeln des Adrenalins in meinen Venen spüre, ist dieses Gefühl eine Bestätigung meiner Existenz.
Diesen Kampf kann ich nur verlieren, das begreife ich jetzt, in diesem Moment, am Deich. Klar, in meinem Kopf bin ich der Sieger. In meinem Kopf liegen die beiden Typen, die meine Freundin sexuell belästigt haben, vor mir auf dem Boden. Mein Hass ist stärker als meine Gegner, meine Wut glüht so weiß wie erhitztes Eisen, bevor es geschmiedet wird. Gegen diese Wut kommt keiner an. Zu verstehen, dass ich schon verloren habe, sobald ich auch nur gedanklich in den Ring steige, lässt den Boden unter meinen Füßen wanken. So muss sich ein wildes Tier fühlen, das nur die Gitterstäbe und Mauern seines Käfigs im Zoo kennt und das dann plötzlich freigelassen wird. Das wilde Tier bin ich, und die Gitter bestehen nur in meinem Kopf. Anstatt pure Freude über den Erkenntnisgewinn zu empfinden, macht sich in mir eine Mischung aus Angst und Unverständnis breit. Vor meinem inneren Auge zeigt sich der Inhalt dieses riesigen Päckchens, das so oft die Kontrolle über mein Handeln, meine Gedanken und mein Selbstbild übernimmt. Nun kann ich es sehen, begreife, woher es kommt – aber kann ich es im nächsten Schritt auch loslassen? Was macht man mit einem Geschenk, das man sich nie gewünscht hat, das man von Kindesbeinen an, von Umzug zu Umzug, von Beziehung zu Beziehung, von Job zu Job mit sich herumträgt, unschlüssig, wofür es gut sein könnte? Es in seine Einzelteile aufdröseln denke ich. Hinterfragen, warum es immer wieder herauskommen will, versuchen, es aufzulösen, um damit Platz für etwas Neues zu schaffen. Das denke ich jetzt, und während ich das denke, gesellt sich zu der Angst und dem Unverständnis plötzlich auch ein Gefühl der Erleichterung. Der Wunsch, mich von alledem zu befreien, macht sich in mir breit. Endlich beginne ich zu begreifen, was mit mir los ist. Endlich verstehe ich, wovon ich gesteuert werde, endlich empfinde ich den Mut und die Kraft, mich meinen Dämonen zu stellen und das zu machen, wovor ich mich jahrelang gedrückt habe: eine Therapie. Und sie ist bitter nötig.
In den kommenden Wochen und Monaten werde ich schrittweise begreifen, wie viel größer meine Probleme sind, als ich es in dem Augenblick am Deich zu verstehen geglaubt habe. Und dass sie alle auf die eine oder andere Weise mit den Verhältnissen zu tun haben, in die ich hineingeboren wurde. Mit diesem Buch möchte ich ein Verständnis dafür schaffen, wie toxisch das Aufwachsen und Leben in Armut sein können. Mit der Verknüpfung von psychischer Erkrankung und Armut in Form einer biografischen Erzählung soll dieses Buch dabei helfen, das individuell erscheinende Elend vieler Menschen in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu begreifen. Erst wenn Menschen sich in Geschichten wie dieser wiedererkennen, kann aus Einzelschicksalen ein kollektives Bewusstsein wachsen – ein Bewusstsein, ohne das es keine Chance auf Veränderung gibt.
Aus den Angeln gehoben
An einem tristen Herbstnachmittag irgendwann Mitte der 1990er-Jahre veränderte sich unsere Welt zu Hause von Grund auf. Draußen war es schon dunkel, und meine Mutter telefonierte in ihrem Zimmer, das eigentlich unser Wohnzimmer war, aber wegen der schlechten Stimmung schliefen mein Vater und sie bereits seit über einem Jahr getrennt. Meine Schwester und ich lebten in dieser Zeit in den mikroskopisch kleinen Freiräumen zwischen Zornesfalten, Versuchen eines normalen Alltags und apokalyptischen Streits unserer Eltern. Bloß nicht im falschen Moment die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das war unser Sport, nur war meine Schwester darin um einiges besser als ich.
Die Tür zum Wohnzimmer stand halb offen, meine Schwester lehnte leicht gebückt am linken Türrahmen, ich, auf Knien, darunter. Wir lauschten. »Ja«, sagte unsere Mutter in den Hörer, »im Badezimmer ist auch alles gepackt, die Zahnbürste und seine Sachen habe ich schon rausgelegt.« Meine Schwester lugte zu mir nach unten, ich schielte zu ihr hoch. Glaubte sie das, was ich glaubte? Wie auf Kommando schoss ich ins Badezimmer, meine Schwester hinterher, um zu überprüfen, ob ich recht behalten sollte und wir umziehen würden. Ich machte das Licht an, doch auf der Waschmaschine neben der Tür stand bloß Papas Kulturbeutel. War sie noch nicht dazu gekommen, unsere Sachen zu packen? In der Küche lag ein Stapel Handtücher bereit, und es herrschte eine seltsame Aufregung. Würden wir umziehen? Und wenn ja, wohin? Als unsere Mutter wenig später den Hörer auflegte und nach uns rief, hatte sie keine guten Nachrichten. Wir würden nicht umziehen, sie und Papa hätten sich getrennt, und das bedeutete, dass Papa jetzt ausziehen müsste.
»Aber wo geht Papa dann hin?«, fragte ich.
»Das muss Papa jetzt selber gucken, das kann ich euch nicht sagen«, antwortete unsere Mutter. Unser Vater schlief noch ein oder zwei Nächte in seinem roten Renault-Kastenwagen, der vor der Tür parkte, ehe er vorübergehend bei Fifi unterkam, einem Franzosen, der seinen Lebensunterhalt als Straßenclown verdiente.
Es dauerte nicht lange, da machte die Neuigkeit auch in der Schule die Runde. »Deine Eltern haben sich getrennt«, raunte Dennis mir auf dem Pausenhof meiner Schule verschwörerisch zu. Als ich widersprach, rannte er davon und rief: »Ich werd es allen erzählen.«Ich lief hinterher, mit einem Stein im Bauch und Furcht im Gesicht, bereit, mein Geheimnis zu verteidigen.
Meine Schwester und ich gingen auf eine Waldorfschule, obwohl meine Mutter sich das Schulgeld dafür nicht leisten konnte. Damit die Waldorfschule kein reines Elitenprojekt blieb, wurden pro Klasse immer eine Handvoll Kinder aus ärmeren Familien zugelassen, deren Eltern monatlich nur einen geringen zweistelligen Beitrag für den Schulverein zahlen mussten. Nach der Trennung lebte unsere Mutter von Sozialhilfe, aber natürlich wollte sie, dass wir eine schöne Kindheit hatten, wozu auch eine passende Schule gehörte, die uns förderte und die nötige Bildung vermittelte. Wir sollten bessere Chancen haben als sie. Sie glaubte an das Konzept der Waldorfschule, die es sich zur Aufgabe macht, jedes Kind ganzheitlich zu sehen, das heißt mit seinen Stärken und Schwächen, und dementsprechend auf eine individuelle Förderung setzt. Schwächen und Mängel, die gab es bei uns allemal. Die Probleme meiner Schwester – sie hatte als Frühchen unter anderem mit einer unterentwickelten Lunge zu kämpfen – stachen weniger ins Auge, aber auch sie hatte ihr Päckchen zu tragen. Ich hatte mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen, mit zu viel Energie und Aggression. Nach den Pausen wollte ich nicht in den Unterricht zurück, und im Klassenraum fand ich alles spannend, nur nicht das, was vorn an der Tafel geschah.
Nachdem mein Vater ausgezogen war, schien unsere Welt wie aus den Angeln gehoben, und es war völlig unklar, ob sie je wieder ins Gleichgewicht kommen würde. Der plötzliche Tod meines Klassenlehrers, der während einer Wanderung in den Alpen einen Herzinfarkt erlitten hatte, machte es noch schlimmer. Ich war acht Jahre und ein paar Monate alt und hatte mich nicht länger im Griff. In fast jeder Pause kloppte ich mich mit irgendwem, meist war der Grund vergessen, bevor die letzte Träne getrocknet war. Auch wenn ich nicht der einzige Raufbold der Klasse war, sorgte mein auffälliges Verhalten für Befremden. Ich wurde zum laut polternden Außenseiter, der ständig für Aufregung sorgte.
Es war ein kalter Wintertag nach den Frühjahrsferien in der zweiten Klasse. Kaum hatte die alte Kuhglocke geklingelt, das Signal, dass die große Pause vorbei war, ging es um die Wurst. Wie zur Hölle sollte ich heil zurück in den Klassenraum kommen? Von meiner Schwester konnte ich keine Hilfe erwarten, sie ging in die fünfte Klasse und verbrachte ihre Pausen in einem anderen Teil des Pausenhofs. Wenn ich mich mit älteren Schülern anlegte, was immer mal wieder vorkam, konnte ich mich sonst auf ihre Hilfe und ihr Verhandlungsgeschick verlassen, doch an diesem Tag war ich auf mich allein gestellt. Auf dem mit Rinde bedeckten einzigen Weg zurück ins Schulgebäude wurde ich von meinen Mitschüler:innen erwartet. Mich rechts zwischen den kahlen Bäumen und Büschen am Zaun entlang vorbeizudrücken, war keine Option, sie würden mich kommen sehen. Wo war die kleine Außenseiterbande, als deren Anführer ich mich sah, wenn man sie brauchte? Mitja mit dem weizenblonden Pilzkopf, der mit Holzschuhen und Lederrucksack zur Einschulung erschienen war, Benni, der Lulatsch, und Sven, dessen Vater gestorben war. Wenn’s darauf ankam, stand ich allein da, so war es schon immer gewesen. Meine Freunde sind feige, aber ich werd mich wehr’n.1 Ich musste da jetzt durch. Ich ging los, doch schon nach wenigen Metern wurde ich von der Seite angerempelt. Ich hörte sie lachen, die Jungs aus meiner Klasse. Egal, weiter. Zu meiner Linken war die Mauer, rechts hatte ich zwei, drei Meter, bei einer Attacke bliebe kaum Platz, um auszuweichen. Vor und hinter mir gingen ahnungslose Schüler:innen aus anderen Klassen vom Schulhof in Richtung Schulgebäude, die nicht sahen, für welchen Krieg sie gerade als Statist:innen herhielten. So gut es ging, versuchte ich, mich zwischen ihnen zu verstecken, aber ich hatte keine Chance. »Na, du Feigling«, rief Laura mir zu, im Gesicht ein dämonisches Grinsen. Lauras Freundin Clara ging das nicht weit genug. Ein Batzen Spucke verließ ihren vor Wut verzerrten Mund und traf mich im Gesicht. Mir blieb keine Zeit, die Rotze wegzuwischen. Ich spuckte zurück, schubste sie weg, da kamen von links auch schon Tim und Robin. Ich begann zu rennen.
»Wenn sie dich in einer Sandkiste verfolgen, Olivier, weißt du, was du dann machst? Wenn du merkst, dass du nicht schnell genug bist und sie dich gleich eingeholt haben, dann gibst du noch mal alles, und dann musst du dich, so schnell du kannst, fallen lassen und zu einem Päckchen zusammenrollen.« Das Wort Päckchen klang aus dem Mund meines Vaters wie ›Päkschen‹. Er machte es mir vor, während er erklärte, wie ich mich seiner Meinung nach zu verhalten hatte. Er ging vor mir auf die Knie und schlang die Arme schützend um seinen Kopf. »Weißt du, was dann passiert, mon fils?« Er guckte zu mir hoch, ich schüttelte den Kopf. Mein Vater rappelte sich wieder auf. »Wenn du es richtig anstellst, dann stolpern sie über dich, und du stehst schnell wieder auf und kannst sie treten.« Er machte es mir vor.
Und was ist, wenn weit und breit keine Sandkiste zur Verfügung steht, in die ich mich fallen lassen kann, ohne mich zu verletzen, Papa? Das hätte ich ihm in dem Moment gern zugerufen, während ich über den asphaltierten Schulhof ins Schulinnere flüchtete. Da er mich aber nicht hören konnte, und weil mein Gesicht noch von Claras Spucke glänzte, hielt ich den Mund und lief. Im Schulgebäude angekommen, drängelte ich mich durch, bis ich in der Jungstoilette ankam. Ich nahm mir Papier aus dem Spender, verdrückte mich in eine der Kabinen und wischte mir das brennende Gemisch aus Rotze und Tränen aus dem Gesicht.
Montag, 24. Juni 2019
11.20 Uhr
Alles ergibt plötzlich einen Sinn, schoss es mir unwillkürlich durch den Kopf, als mir die Therapeutin meine vorläufige Diagnose mitteilte. »Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung«, steht auf einem Zettel, den ich fortan zu anderen Therapeut:innen tragen darf, mit dem Ziel, dass sie mich als Patienten annehmen. Die extreme Geräuschempfindlichkeit, die binnen Sekunden hochkochende Wut, wenn Leute sich auf der Straße anpöbeln, die geringe Belastbarkeit, das Verlangen nach Ruhe, das Gefühl, dass selbst alltägliche Dinge schnell aus dem Ruder geraten, die Überzeugung, dass schöne Dinge nur an mir vorüberfliegen, aber nie haltmachen: Ja, all das würde plötzlich Sinn ergeben.
Der Blick der Therapeutin verriet Mitgefühl. Brauche ich nicht, habe ja keinen Krebs, denke ich. Nett ist sie trotzdem. Natürlich sei die Diagnose nur vorläufig und unter Vorbehalt, aber die Krankenkasse verlange eine Einordnung, erklärte sie mit sonorer Stimme. Wenn das stimmt, was da auf dem Zettel vor meiner Nase steht, schleppe ich dieses Fass nun schon seit annähernd dreißig Jahren mit mir herum: Mit ihm bin ich durch meine Schulzeit gestolpert, habe in Dutzenden Jobs gearbeitet, meine Schauspielschule gemeistert und mehrere Beziehungen geführt. Mein bisheriges Leben trägt nun den Stempel Posttraumatische Belastungsstörung. Eines ist klar: Wenn ich tatsächlich psychische Probleme habe, liegt der Grund dafür in meiner Kindheit. Aber Moment mal, ist PTBS nicht diese Soldatenkrankheit? Ich schaue nach und mache bei rund der Hälfte der gegoogelten Risikofaktoren vor meinem inneren Auge einen Haken.
Fehlende emotionale Unterstützung seitens der Eltern:
Aufwachsen in Armut:
Aufwachsen bei einem alleinerziehenden Elternteil:
Kriminalität, Dissozialität oder psychische Störungen eines Elternteils:
Fehlende familiäre Harmonie:
Ich muss unweigerlich an den vergangenen Freitag denken. Lucie und ich waren verabredet. Pünktlich klingelte ich an der Tür ihrer WG, doch sie machte nicht auf. Geduldig versuchte ich es noch zwei- oder dreimal, dann rief ich auf ihrem Handy an. Sie nahm nicht ab. Ich schaute durch die Fensterscheibe ihres Zimmers, nichts. Langsam ergriff mich die Panik. Ich lief um den Häuserblock herum, um im Innenhof nachzusehen, ob man von dort in die Küche schauen kann. Da glaubte ich bereits abwechselnd, dass sie umgekippt war oder dass jemand sie entführt haben könnte. Von solchen Fällen hört man ja immer wieder. An das Küchenfenster im Hof kam ich nicht heran, es lag zu hoch. Ich hatte es tiefer in Erinnerung. Das kleine Badfenster stand offen, aber trotz meiner Rufe blieb Lucie verschollen. Wieder lief ich vor die Haustür, klingelte, klopfte, rief. Mit einem Blick auf meine Uhr stellte ich fest, dass zwölf Minuten vergangen waren, seit wir verabredet waren. Auf der Rückseite versuchte ich mein Glück erneut, irgendwie musste man doch hochklettern können, um in die Küche zu schauen, nicht dass sie da irgendwo lag. Innerhalb weniger Minuten hatte ich mich von einem scheinbar normalen Menschen in einen emotionalen Zombie verwandelt. Olivier David, seit zwölf Minuten Gefangener seines Panikschädels. Gerade wollte ich mithilfe eines Brettes, das ich aus dem Gebüsch gezogen hatte, die Fassade zum Fenster hochklettern, da klingelte mein Handy. Auf dem Display stand ihr Name. Vierzehn Sekunden dauerte das Telefonat, nur ich redete, hörte aber nichts, da ich keinen Empfang hatte. War ich eben noch panisch, verlor ich nun vollends die Kontrolle. Ich stürmte wieder ums Haus herum zur Eingangstür, da sah ich sie stehen und lächeln. »Alles ist gut«, versuchte sie mich zu beruhigen, aber bei mir war nichts mehr gut, mein Zustand war besorgniserregend. Ich fiel ihr in die Arme, und für die nächsten zwanzig Minuten war ich am Boden zerstört. Ich war emotional so hinüber, dass ich nicht einmal weinen konnte. Vom einsetzenden Hyperventilieren waren meine Arme ganz schwer, die kleinen Finger an beiden Händen waren taub und kribbelten zugleich. Sie hatte Baklava für unseren Ausflug gekauft und mich an der Bushaltestelle abholen wollen. Meinen Bus hatte sie verpasst, darum wartete sie die nächsten drei Busse ab. Als ich dann immer noch nicht kam, ging sie schließlich zurück. Eine Bagatelle für die Menschheit, für mich ein Vorfall, der meine Grundfeste ins Wanken brachte.
Ich freue mich auf meine nächste Therapiestunde, denn es gibt viel zu besprechen. Die geschilderte Situation ist quasi eins zu eins vergleichbar mit der an jenem Tag, an dem ich mit vierzehn nach Hause kam und meine Mutter nicht zu Hause war, obwohl sie es hätte sein sollen. Erst wurde ich unruhig, dann verlor ich die Kontrolle über mein logisches Denken, rannte raus auf die Straße, rief ihren Namen, lief die Straße hoch zum Platz und wieder zurück, dann bis zum Einkaufszentrum und wieder zurück. Schließlich kam sie mir entgegen, völlig entspannt. Ich fing an zu heulen. Sie hatte sich nichts angetan, sie war einfach nur kurz einkaufen gewesen.
1Tua, Vorstadt, aus dem Album TUA (Chimperator Productions 2019)