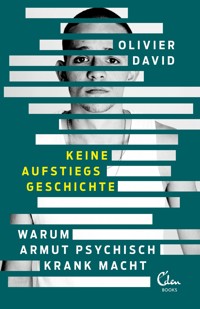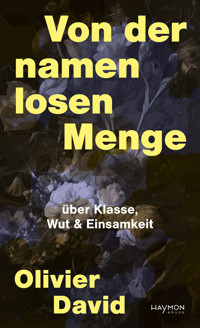
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DIE VERMESSUNG SOZIALER WAHRSCHEINLICHKEITEN DAS ARCHIV MEINER SOZIALEN WUT Geschichten von der UNTEREN KLASSE, Literatur über SOZIALE HERKUNFT – meist sind das Erzählungen von AUFBRUCH und AUFSTIEG. Olivier Davids Essays kreisen um diejenigen, die UNTEN GEBLIEBEN sind. Die, mit den SCHMERZENDEN KÖRPERN, die NACHTARBEITENDEN, die VERGESSENEN – und um ihn SELBST. Wie fühlt es sich an, MIT DEM EIGENEN KÖRPER und der eigenen GESUNDHEIT den WOHLSTAND HÖHERER KLASSEN zu bezahlen? Was bedeutet es, unten zu bleiben, damit die oberen ihren STATUS, ihre MACHT, ihre PRIVILEGIEN behalten können? Wie selbstbestimmt kann die Entscheidung, allein zu bleiben sein, wenn soziale Beziehungen durch VEREINZELUNG, GELDMANGEL und EINGESCHRÄNKTE TEILHABE unter Druck stehen? Wie soll Geschichte weitergegeben werden, wenn es KEIN KOLLEKTIVES GEDÄCHTNIS ARMER MENSCHEN gibt? "ES GEHT HIER NICHT UM DIE KULTURALISIERUNG VON ARMUT, NACH DEM MOTTO: SO SIND SIE, DIE ARMEN. ES GEHT UM DAS AUFZEIGEN VON LEBENSREALITÄTEN ALS KAUSALKETTEN." Olivier David beschäftigt sich anhand von BEOBACHTUNGEN und ERFAHRUNGEN mit dem EINFLUSS VON KLASSE auf sein Leben – und die Leben derer, die er SEINE LEUTE nennt. In SPRACHGEWALTIGEN, INTIMEN, WÜTENDEN und dabei EINFÜHLSAMEN ESSAYS schreibt er über INNERE MIGRATOIN, vom FREMDSEIN und einer blauen ANGST. Und er ringt zugleich um eine ERZÄHLWEISE, die den GESCHICHTEN VON UNTEN gerecht wird. "Von der namenlosen Menge" ist ein Versuch, sich selbst in die Welt einzuschreiben, denn: "Für gewöhnlich liest UNSEREINS nicht vor Publikum aus Büchern, unsereins trägt SICHERHEITSSCHUHE beim Arbeiten, hat KOPFHÖRER auf den Ohren gegen den Lärm, hat SCHMERZEN irgendwo, LEHNT, wo er kann, GÄHNT, so oft es geht …"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
den Unterdrückten
den Ausgebeuteten
den Vergessenen
der namenlosen Menge
„We are without a home in the world and we are without a home in our psyche and body. A ghost within a ghost, dead but still living.“
Cynthia Cruz
„Irgendwann wird uns bewusst, daß der einzige Akt, der uns unsere Würde, die Welt und unsere Sprache, also die Freiheit zurückgeben kann, die Revolte gegen die Vergangenheit ist; die einzige Chance, sie im doppelten Sinn aufzuheben: sie zu besiegen und sich ihrer würdig zu erweisen.“
Bernward Vesper
1. Innere Migration
In ihrer sozialen Identität, in ihrem Selbstbild zutiefst infrage gestellt durch ein Schulsystem und eine Gesellschaft, von diesen mit leeren Worten abgespeist, bleibt ihnen zur Wiederherstellung ihrer persönlichen und sozialen Integrität kein anderer Ausweg, als jenen Verdikten ihre globale Verweigerung entgegenzusetzen.
Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede
Ein später Nachmittag am letzten Tag des alten Jahrtausends. Um dem Gefühl des Alleinseins zu entfliehen, schnüre ich meine Schuhe, ich rufe meiner Mutter ein paar Worte zu und verlasse die Wohnung. Raus aus dem Haus, vorbei an dem Fenster meines ghanaischen Nachbarn, aus dem Gelächter und Musik dringt, durch das Tor, das verschlossen aussieht, aber nur angelehnt ist und das eines Tages eingebaut wurde, um zu verhindern, dass Drogensüchtige ihre Spritzen in unserer Sandkiste liegen lassen. Meine Stimmung passt zu diesem nasskalten Dezembertag, sie passt zum taubengrauen Himmel, sie passt nicht zum Tag der Tage, für den ich zu wenig enge Freunde habe, zu pleite und zu hobbylos bin. Ich bin elf Jahre alt, ich bin draußen auf der Straße unterwegs, streife durch die Stadt, mit einer Handvoll Böller. Auch, wenn wir für richtige Partys eigentlich zu jung sind, meine Mitschüler und ich, weiß ich, dass manche von ihnen mit ihren Familien ins neue Jahrtausend hineinfeiern und andere die Jahrtausendwende bei ihren Freunden verbringen.
Die Dämmerung bricht langsam herein, als ich beschließe, mich auf den Rückweg zu machen. Vorbei an den sechs oder acht Stufen, die an die Außenmauer des Karstadtgebäudes angrenzen, vorbei an der Post nahe der großen Bergstraße. Am Schaufenster des Klamottenladens Hundertmark bleibt mein Blick an der dunkelbraunen Lederjacke für 699 Mark kleben. Kurz hellt sich meine Stimmung auf, als ich mir vorstelle, diese schwere, edle Lederjacke eines Tages zu besitzen. Nach ein paar Sekunden reiße ich mich los. Es gibt die Welt hinter der Auslage, und es gibt meine Welt, und dazwischen gibt es die Sicherheitsscheibe, die unüberwindbar zwischen meinen Tagträumen und der Realität steht. Das hinter der Scheibe, das bin nicht ich, das werde ich nie sein.
Die Kälte zieht mich wie an einer Schnur zurück nach Hause. Allein Böller auf die Straße zu werfen, so wie ich es bis vor wenigen Minuten gemacht habe, erzeugt keine Freude in mir, es ist eher etwas, das ich pflichtbewusst erledige, weil alle Jungs in meinem Umfeld vernarrt darin sind, etwas in die Luft zu jagen. Die letzten zwei D-Böller stecke ich zurück in die Tasche. Am Ende der großen Bergstraße explodiert plötzlich etwas unmittelbar vor meinen Füßen. Die Detonation ist heftig, sie reißt mich aus meiner Lethargie. Ich sehe ein paar übermütige Jugendliche, die sich mit Böllern beschmeißen, und hoffe, dass sie nicht auf mich zielen. Der Schock, den die Explosion in mir auslöst, wird verstärkt durch die empfundene Isolation von der Welt, die mich schon umgeben hat, lange bevor ich das Haus verlassen habe. Eine Isolation, die genau genommen ein Teil von mir ist. Eine Isolation, die gleichzeitig auch ein Trugschluss ist, denn ich bin nicht allein, meine Mutter wartet zu Hause, auch ihr geht es nicht gut, auch sie ist allein. Genau genommen ist es kein isoliertes Alleinsein, wir sind jeder für sich nebeneinander allein. Es ist das Alleinsein des versprengten Rests einer Familie aus der unteren Klasse.
Vor einiger Zeit habe ich online einer Podiumsdiskussion über soziale Herkunft und Klassenwechsel zugesehen, und in den Wochen und Monaten danach ploppte der Titel der Veranstaltung immer wieder in meinem Inneren auf: Die Klasse, die es nicht gibt. Die Formulierung zeigte mir eine Realität auf, die sich meinem Bewusstsein bisher entzogen hatte, obgleich ich ihre Wahrheit körperlich spürte. Schon seit meiner Kindheit existieren für mich parallel zwei Realitäten, die sich zu widersprechen scheinen.
Die eine besagt, dass es nur mich gibt, nur ich allein kann mir meiner selbst sicher sein. Klar, da sind noch meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, aber es ist wichtig, dass ich mich auf niemanden verlasse. Keine Freunde werden bleiben, keine Frau. Es ist eine Art innerer Kern, der nicht durch das Vertrauen in andere Menschen kontaminiert werden darf, denn im Außen wartet der Verrat. Hoffnung nur dann, wenn ich bereit bin, die der Hoffnung auf dem Fuß folgende Enttäuschung zu akzeptieren, die zum Gefühl, verlassen zu werden, dazugehört. Gefühle dieser Art haben mit dem Pathos nichts gemein, das der unteren Klasse zugeschrieben wird. Teile der Gesellschaft haben es sich angewöhnt, mit unversöhnlichem Blick auf die Empfindungen der Menschen aus der Unterklasse zu schauen. Den Problemanalysen und Schlüssen der Menschen von unten wird misstraut. Der Entzug der Deutungshoheit über die eigene Situation funktioniert als nachgelagertes Herrschaftsinstrument, als Enteignung nach der Enteignung. Erst nimmt die herrschende Klasse einem die Mittel zu einem würdevollen Leben, dann diskreditiert die kulturelle Fraktion derselben Klasse die Intensität der Gefühle, die ob des Verlustes aufsteigen.
Diese Gefühle, über die ich hier zu sprechen versuche, sind Teil eines verkörperten Wissens. In ihnen liegt keine Trauer und auch keine Überhöhung, dafür ist ihnen eine Desillusionierung eigen. Mir kommt kein Gefühl in den Sinn, das gleichzeitig ehrlicher und ernüchternder zugleich ist als jenes, das beim Vorgang spürbar wird, sich der Realität zu stellen, in der es für die meisten so wenig zu gewinnen gibt. Dieselbe Wahrheit besagt, dass ich alleine von dieser Erde gehen werde. Eine Wahrheit, in der geschrieben steht, dass ich in Einsamkeit und Armut sterben muss, zu früh sterben muss, weil diese Phänomene einer Gesetzmäßigkeit folgen.
Die zweite Realität meiner Kindheit ist die eines Miteinanders, das sich durch Mitgefühl zeigte. Zu Hause waren die Herzen so offen, wie sie nur sein konnten, wenn einem die Ungerechtigkeiten (und manchmal auch das erlernte Wissen, es nicht besser verdient zu haben) in den Lebenslauf eingeschrieben worden sind. Neben dem Mitgefühl war da Platz für Diskussionen am Küchentisch, da gab es die Freude meiner Mutter, wenn anderen kleinen Leuten ein bisschen Gerechtigkeit widerfuhr. Da wurde der Glaube verteidigt, dass ihre Kinder den eigenen Weg finden würden. Trotz allem – oder gerade deswegen.
Wie gehen diese beiden Wissensstände zusammen? Wie kann die eine Wahrheit stimmen – die Wahrheit um das Wissen einer kollektiven Betroffenheit und eine damit verbundene Empathie für viele, deren Leben den Gesetzen dieser selektierenden Welt unterworfen sind –, während das Wissen darüber, dass das Leben in der Unterklasse vereinzelt, sich jeden Tag mit kalter Präzision in mein Bewusstsein eingeschrieben hat?
Für mich beschreibt der Begriff der inneren Migration am treffendsten den Mechanismus der Vereinzelung, der nicht nur, aber insbesondere ein Phänomen der unteren Klasse ist. In Deutschland wird vor allem im Kontext des Nationalsozialismus von innerer Migration gesprochen. Der Begriff beschreibt in diesem Zusammenhang eine innere Haltung, die einige Schriftsteller und Künstler nach der Machtergreifung der Nazis 1933 bis zum Kriegsende 1945 für sich beanspruchten. Aus Furcht vor Berufsverboten und Konzentrationslager produzierten viele Künstler gefällige oder seichte Kunst, Kritik an der NS-Diktatur wurde zurückgehalten oder auf ein Minimum reduziert. Der Widerstand der Künstler fand nur vereinzelt und im Geheimen statt, in den allermeisten Fällen bestand er aus einem bloßen Rückzug ins Innere.
Im Sammelband Zwischen innerer Emigration und Exil zeigt die Autorin und Herausgeberin Leonore Krenzlin auf, dass der Begriff nicht, wie oft fälschlich behauptet, von Frank Thiess begründet wurde, der ihn auf die Zeit des Nationalsozialismus angewendet hat. Schon in den 1920er-Jahren fand die innere Migration in Leo Trotzkis Literatur und Revolution Erwähnung. Für Krenzlin behauptet die Formulierung innere (E-)Migration, dass es „eine Abwesenheit ohne eine reale körperliche Auswanderung gebe, eine Absetzbewegung in irgendeiner indirekten Bedeutung: als Nichtübereinstimmung mit den Zuständen des Landes, als ein Sichausgliedern aus den Anforderungen des Staates, als Weigerung, ihn zu unterstützen – oder sogar auf einer ganz unkörperlichen Ebene als ein Rückzug in das Innere des Geistes oder der Seele.“
Wichtiger erscheint es mir, den Begriff von historischen Kontexten losgelöst auf soziale Fragen im Hier und Jetzt zu übertragen. Denn wenn wir uns die Lage der unteren Klasse ansehen, ist Krenzlins Definition die Zustandsbeschreibung der Gegenwart vieler armer Menschen. Fast jeder vierte Wahlberechtigte gab 2021 bei der Bundestagswahl keine Stimme ab. Politikverdrossenheit, Populismus und der Glaube an Verschwörungserzählungen sind in der unteren Klasse überproportional vertreten.
~
Ich muss an mein Aufwachsen in Altona denken, einem Viertel von Hamburg, in dem Arbeiterinnen neben Künstlern und arme Menschen neben Bildungsbürgern wohnten. Ein Viertel, in dem Gewalt in manchen Wohnblöcken, Straßen und Häusern Teil des Alltags war. Wie viele Jugendliche und Erwachsene sind hier dem Alkohol, Gras oder harten Drogen verfallen? Wie viele sind eingefahren, ins Gefängnis?
Ein alter Freund, mit dem ich gemeinsam Musik gemacht und bei dem ich Songs aufgenommen habe, wurde vor ein paar Monaten zu zwei Jahren auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe verurteilt.
Vor einem Jahr traf ich in Hamburg durch Zufall einen Bekannten wieder. Er erzählte mir, dass sein Prozess wegen des Handelns mit Kokain anstand. Erst vor ein paar Tagen erfuhr ich, dass er nun im Gefängnis sitzt.
Es gibt bis heute alte Bekannte, die mich, wenn ich sie treffe, mit dem Pseudonym ansprechen, unter dem ich früher gerappt habe. Einer von ihnen ist B. „Soma, digga, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben!“, ruft er, als ich einem Kamerateam mein altes Viertel zeige. „Ich wusste gar nicht, dass es früher bei dir auch so schlimm war. Bei uns ist ja auch richtig heftig gewesen, aber uff, wenn du Buch schreibst darüber, dann …“ Er hört auf zu reden, sein Blick erstarrt auf eine Weise, die ich kenne, weil mein eigener Blick zuvor oft genauso erstarrt ist. Man kann sehen, wie es in ihm rattert: Wie schlimm musste eine Form der Armut sein, die es nötig machte, ein Buch über sie zu schreiben?
Eine weitere Erinnerung. Ich bin mit ein paar alten Freunden in Altona an dem Platz unserer Jugend auf ein Bier verabredet. Wir alle wurden schon über diesen Platz gejagt, mal von anderen Jugendlichen oder Erwachsenen, mal von der Polizei. Ich wurde auf dem Platz geschlagen, habe mich erbrochen, habe ein paarmal Gras verkauft, öfter aber Gras gekauft. Ich habe an Wände gepinkelt, Mauern und Mülleimer angemalt und mit Stickern beklebt. Ein Bekannter von früher stößt dazu, er will ebenfalls über mein Buch sprechen und nimmt mich zur Seite. Er wolle es mir persönlich sagen und nicht hinter meinem Rücken reden. Er habe Respekt davor, dass ich ein Buch geschrieben habe, aber ganz ehrlich und ohne mir zu nahe treten zu wollen, so wie ich seien doch viele aufgewachsen, das sei doch gar nicht so krass. Er erzählt mir die Geschichte seiner Familie.
Zu erkennen, dass der eigene Lebenslauf, die Hautfarbe, der Nachname oder die Straße, in der man lebt, Türen verschließt, ist für die meisten Menschen nicht leicht zu ertragen. Ich weiß von einigen Beispielen, in denen junge Erwachsene, Männer öfter als Frauen, auf diese Zuschreibungen affirmativ reagieren. Meine Mutter putzt Toiletten, mein Vater ist abgehauen, die Gesellschaft traut mir nichts zu, die Initiative, die ich zeige, um vom Fleck zu kommen, wird zurückgewiesen – dann soll es so sein. Dann mache ich euch den Gangster, den Dealer, den Alkoholiker, den Taugenichts, die Depressive, bitte schön. Das sind Zeichen innerer Migration. Ein Verstummen; sich den Zuständen und Spielregeln ergeben, die Rolle annehmen. Seinen Platz kennen. Nicht aufsteigen können und also auch nicht wollen, den Mächtigen die Zustimmung verwehren. Merkmale innerer Migration weisen auch die oben beschriebenen Situationen auf, in denen es nur dann möglich erscheint, ein Buch über die sozialen Bedingungen des Aufwachsens zu schreiben, wenn die Zustände wüster sind als Hartz IV, als die Intervention des Jugendamtes in der Familie, als Drogenprobleme, Vorstrafen, Ärger um den Duldungsstatus und das Über-die-Runden-Kommen durch Kleinkriminalität. Umgekehrt gesprochen: Was sagt es aus, wenn das alles als eine Form der Normalität empfunden wird, über die man nicht zu sprechen braucht? Was sagt es über eine Gesellschaft aus, in der ein Teil glaubt, dass ihm kein würdevolles Leben zusteht?
~
Der Junge mit den Böllern in der Hand verwandelte sich in einen spätpubertierenden Jugendlichen, aus der Jahrtausendwende wurde 2007. Hätte mich damals jemand gefragt, wer die Hintermänner von 9/11 seien, ich hätte, mit einem Lächeln auf den Lippen, das Überlegenheit ausstellen sollte, aber von Verbitterung geprägt war, gesagt, es sei ein Insidejob gewesen – was denn sonst? Das war keine rein private Meinung, es war so etwas wie die kollektive Wahrheit meines Milieus. Wir alle wussten, nachdem wir die Dokumentation Loose Change gesehen hatten, einen Amateurfilm, der Verschwörungserzählungen über die einstürzenden Twin-Towers verbreitete, was wahr und was gelogen war.
Die Amis haben die Flugzeuge in die Türme gelenkt, um den Irakkrieg zu starten wegen Öl.
Es war ein gutes, ein überlegenes Gefühl, einer der Wissenden zu sein.
Mitte 2008 begann ich zweiunddreißig Stunden die Woche in einem Supermarkt zu arbeiten. Irgendwann in dieser Zeit fing ich schon vor der Schicht zu kiffen an, ab dem Nachmittag oder Abend trank ich Bier, ein paar Mal die Woche dazu Schnaps. Dieses Leben führte ich einige Jahre, es fühlte sich wie der Schatten dessen an, was einem durch mediale und popkulturelle Erzählungen vom Start ins Erwachsensein versprochen worden war. Die Arbeitskollegen und Freunde, mit denen ich mich umgab, waren wie ich, zumindest fühlte ich mich ihnen gleich. Sie zogen Speed vor der Frühschicht, malten in ihrer Freizeit Wände und Züge, dealten und kifften oder tranken zu viel. Niemand glaubte an das eigene Vorankommen. Keiner gab sich der Illusion hin, dass die Welt für einen von uns etwas anderes zu bieten hatte. Man kämpfte dafür, es im Rahmen seines Alltags etwas weniger schlecht zu haben. Mehr Freizeit, weniger Lohnarbeit: Das war die ganze Zukunftsvision. Das schöne Leben, das wir uns ausmalten, war von dem Wunsch nach „weniger“ gekennzeichnet, weniger Probleme zu haben, anstatt nach Verbesserungen, von denen wir nicht zu träumen wagten. Man war gegen die Ausbildung zum Koch, in die Eltern ihre bekifften Schulabbrechersöhne steckten, gegen die Ausbildung zur Erzieherin, gegen den Staat, den man immer nur dann zu spüren bekam, wenn es um das Abbezahlen von Verfahren, um Kürzungen des Arbeitslosengeldes ging, oder vor dessen Exekutive man sich auf der Straße in Acht nahm. Vorankommen bedeutete aufzuhören, die Regeln der oberen Klassen zu befolgen, so sehr hatte sich die Hoffnungslosigkeit in vielen von uns breitgemacht.
Vielleicht weil ich es durch meinen Vater vor Augen hatte, der vor meiner Geburt zweimal im Gefängnis saß, jedenfalls erschien mir die Möglichkeit, ins Gefängnis einzufahren, als reale Option – eine Zukunftsversion, die jederzeit Wirklichkeit werden konnte. Es ging hierbei nicht darum, inwieweit die Gefahr einzusitzen real war, es ging um das Selbstbild, in dem das Gefängnis eine von mehreren Möglichkeiten darstellte, wodurch man den Realitäten im Viertel Tribut zollte. Vielleicht wurde ein Teil davon auch durch meine Erfahrungen beeinflusst, die mich erahnen ließen, eine Haftstrafe läge im Bereich des Logischen – musste ich doch als Jugendlicher und junger Erwachsener immer wieder vor der Polizei wegrennen. Jener Polizei, die zu dem Zweck gegründet worden war, arme Menschen zu verfolgen, zu bestrafen, sie zu inhaftieren, um die Ordnung der Gesellschaft in Klassen aufrechtzuerhalten. Eine Praxis, die heute noch Bestand hat.
An einem Tag warfen sie einen Bekannten für eine Nacht in eine Zelle, an einem anderen steckten sie einen Kumpel für eine Woche in den Jugendknast. Hier kassierte jemand einen Messerstich, dort suchten wir nach jemandem, der uns Geld schuldete, hier wurde ich beim Taggen hochgenommen, dort verschwanden Nachbarn für ein paar Jahre wegen Überfällen ins Gefängnis. Warum sollte ich verschont bleiben?
~
Merkmale innerer Migration finden sich auch im Leben meines Vaters wieder, einem Leben, das von Brüchen, von Job- und Wohnortwechseln gekennzeichnet ist. Mein Vater hat in Frankreich, Deutschland, China und Vietnam gelebt. Während seines Dienstes beim französischen Militär stand er eine Zeit lang unter Hausarrest. In Hamburg saß er wegen Dealens einmal für einige Wochen und einmal für ein paar Monate im Gefängnis. Er hat sich, seinen Körper und Geist mit Drogen betäubt, mit Heroin und Kokain, mit Opium und Gras, mit Alkohol und Zigaretten. Neben diesen bildhaften Merkmalen innerer Migration ist die äußere Migration ein wichtiger Faktor für eine nachgelagerte innere Migration. Anders als viele Migranten ist mein Vater nicht als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, er ist mit einem seiner großen Brüder im Alter von siebzehn oder achtzehn Jahren nach Deutschland gefahren, mit einem Auto, das schrottreif war, und einem Plan, der sich als Quatsch erwies. Sie hatten die Idee, Kasinos abzuzocken.
Für einen Film, an dem ich arbeitete, zu der Frage, wer in Deutschland alles kein Wahlrecht hat, habe ich ihn vor einiger Zeit gefragt, wie er es empfand, in Deutschland nicht wählen zu dürfen. Ihn, der sich in seiner Jugend mit französischen Nazis schlug, der politisch aktiv war. Wählen zu können, sagte er, habe ihm gefehlt, aber irgendwann hatte er sich so daran gewöhnt, kein Stimmrecht zu haben, und aufgehört, das politische Tagesgeschehen in Deutschland zu verfolgen. Es wurde ihm egal. Die Entfremdung gegenüber der Welt blieb nicht auf einer abstrakten Ebene. Vielleicht war es dem Sich-Durchschlagen im Ausland geschuldet, vielleicht lag es an der Notwendigkeit, sich gegenüber seinen Mitmenschen durchzusetzen, die seit seiner Kindheit zu ihm gehört. Jedenfalls ist da eine Kompromisslosigkeit in ihm, wie sie nur jemand haben kann, der sich mit innerer Härte gegen die Härten der Welt verteidigt
als er zu Besuch in Hamburg war, wir an der Ampel einer Hauptstraße warteten und ich einen kleinen Jungen, der ein heranfahrendes Auto übersehen hatte, davon abhielt, über die Straße zu laufen. Und wie mein Vater zu mir sagte: „Warum hast du ihn gewarnt? So ist das Leben, man macht eine Sache falsch und ist tot. Der kleine Idiot wäre selbst schuld gewesen.“
als er sagte, meine Mutter habe es darauf angelegt, geschlagen zu werden.
wenn wir uns in Hamburg verabredeten, nachdem wir uns jahrelang nicht gesehen hatten, und er viel zu spät erschien, betrunken und bekifft.
Es geht an dieser Stelle nicht darum, meinen Vater als Opfer seiner Lebensumstände zu verklären, es geht um die Vermessung sozialer Wahrscheinlichkeiten. Es geht darum, über die Regel zu schreiben und nicht über die Ausnahme, die überproportional viel Aufmerksamkeit erhält. Und diese Regel besagt, dass in der unteren Klasse häufiger körperliche Gewalt angewendet wird. Wie kann ich dieser sozialen Wahrheit Rechnung tragen und gleichzeitig weder entschuldigen noch rechtfertigen, was er tat? Wie kann ich die Frage sozial beantworten und ihn dennoch nicht aus seiner Verantwortung entlassen?
Mein Vater heute. Er geht nicht wählen, er ist nicht einmal im Wählerverzeichnis eingetragen. Er fühlt sich von den meisten Politikern nicht vertreten, links wie rechts, alles dasselbe. Zu der Zeit, in der ganz Frankreich bestreikt wird, um Macrons Rentenreform zu verhindern, schimpft er über die Streikenden, wie er früher über die Herrschenden geschimpft hat. Mit denen hat er sich abgefunden, man kann es ja sowieso nicht ändern. An meinem Vater zeigt sich, wie unsere Klassengesellschaft Lebensläufe prägt. Wie fehlendes Handwerkszeug im Umgang mit Krisen, ausbleibender Erfolg, das Scheitern persönlicher Beziehungen, die Flucht in Drogen, die Zurückweisung von Politik und Gesellschaft, das Erschaffen eigener Spielregeln, ein Staat, der straft, ohne Perspektiven aufzuzeigen, patriarchal-autoritäre Männlichkeitsbilder, Migration und die damit einhergehende Entwurzelung zum Rückzug ins Innere führen – zur inneren Migration. Ich bin mir fast sicher, dass mein Vater eine andere Wahrnehmung, eine andere Sicht auf seine Realität hat. Sich einzugestehen, dass kapitalistisch organisierte Staaten, dass die unterschiedliche Ausprägung von Gesellschaften und die sozialen Determinanten der Politik solche massiven Auswirkungen auf seinen Körper und Geist haben, ist schmerzhaft. Denn es führt vor Augen, wie unfrei die Wahl des eigenen Lebensweges tatsächlich ist.
Vor Kurzem las ich bei erneuter Lektüre von Didier Eribons Rückkehr nach Reims folgende Sätze, in denen ich sowohl meinen Vater als auch mich wiedererkenne. „Dass es anderswo anders zugeht, dass andere Leute andere Ziele und Möglichkeiten haben, weiß man sehr wohl, aber dieses Anderswo liegt in einem so unerreichbaren, separaten Universum, dass man sich weder ausgeschlossen noch benachteiligt fühlt, wenn einem der Zugang zu den Selbstverständlichkeiten der anderen verwehrt bleibt. So ist die Welt geordnet, Punkt. Warum, weiß man nicht. Dazu müsste man sich selbst von außen betrachten, bräuchte einen Überblick über das eigene Leben und das Leben der anderen.“
Diesen Überblick im Alltag zu gewinnen ist alles andere als leicht, zumal, wenn der Alltag von körperlicher Arbeit und Armut strukturiert ist. Erst als ich diesem Teufelskreis des Multijobbens und der körperlichen Arbeit entkommen war, wurde es mir möglich, mich mit der sozialen Gewalt zu beschäftigen, die meinen Lebensweg bestimmte.
~
Wieso ist es dem Jungen von damals, mit den Böllern in der Hand, nicht gelungen, sich als Teil von etwas zu sehen, obwohl
seine Mutter ihm eine Idee davon vermittelte, wer die Benachteiligten waren und wem Solidarität gebührte?
sein Vater ihn früher zum Fußball mitnahm und er in den folgenden Jahren im Stadion immer wieder das Gefühl von Zugehörigkeit empfand?
er eine Idee davon hatte, wohin er gehörte, die sich durch die Auswahl vieler seiner Freunde zeigte?
In verschiedenen Momenten meines Lebens habe ich mich als Teil von etwas gefühlt, das ich heute im Nachgang als Klasse oder Klassenfraktion bezeichne. Im Stadion, wenn ich mit einem Lied verschmolz und die Gedanken, die sonst unaufhörlich ratterten, endlich verstummten. Wenn ich mit Freunden auf dem Skateboard durch die Stadt fuhr und die Trennung zwischen mir und der Welt überwand. Wenn ich mit Nachbarn und Bekannten gegen einen Klamottenladen aus der rechtsextremen Szene demonstrierte, dessen Mitarbeiter und Kunden im Stadtteil Präsenz zeigten. Wenn ich sah, dass eine linke Partei irgendwo auf der Welt eine Wahl gewann. Ich denke: Mit dem Klassenbewusstsein ist es wie mit dem Glück; es schaut mal kurz vorbei, es streift den Geist, wärmt ihn, aber dieses Gefühl zu konservieren, wollte mir weder als Kind und Jugendlichem gelingen noch zu der Zeit, in der ich körperlicher Arbeit nachging. Das veränderte sich, sobald ich mit dem Schreiben begann. In Denken in einer schlechten Welt beschreibt der Philosoph Geoffroy de Lagasnerie, wie die Produktion von Kunst, Literatur und Wissen mit einer Verantwortung zum Engagement einhergeht. Im Augenblick des Schreibens „haben wir uns folglich entschieden, uns zu engagieren. Wir sind in etwas engagiert. Und damit können wir die politische Dimension unseres Handelns nicht länger verdrängen und bestreiten“.
An dieses Engagement glaube ich. Mein Schreiben ist ein Versuch, diesem Anspruch an das eigene Engagiert-Sein gerecht zu werden. Zwei Bewegungen geschahen beinahe zeitgleich, zum einen erschrieb ich mir die Klasse, der ich angehörte. Dieser Zustand hält bis heute an, und es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass es ein Prozess ist, der nicht zum Abschluss kommen wird, denn Gefühle und das Bewusstsein für Verwurzelung unterliegen permanenten Veränderungen. Durch mein Schreiben erweckte ich die sozialen Bedingungen, durch die ich meine wesentliche Prägung erfuhr, zum Leben. Oder besser: Ich gewann ein Verständnis davon, welche Machtdynamiken in mir wirkten. Ich wurde zweimal geboren, einmal brachte meine Mutter mich zur Welt, das zweite Mal erschuf ich mich durch das Aufschreiben dieser sozialen Bedingungen selbst. Da ich auf die erste Geburt kaum Einfluss nehmen konnte, ist es die zweite Geburt, der ich vertraue und an die ich glaube, denn sie ist eine selbstbestimmte.
In Rückkehr nach Reims schreibt der Autor und Soziologe Didier Eribon, er habe die „Zugehörigkeit zu einer Klasse immer gespürt. Was nicht dasselbe ist, wie einer selbstbewussten Klasse anzugehören. Man kann sich über seine Zugehörigkeit zu einer Klasse bewusst sein, ohne dass sich diese Klasse ihrer selbst als Klasse oder als ‚klar definierte Gruppe‘ bewusst ist“. Mein Klassenbewusstsein war kein tatsächliches, es erschöpfte sich durch einen Sinn dafür, was ich alles nicht war. Es war ein Klassenbewusstsein der Negation.
Bei dem Soziologen Pierre Bourdieu lese ich, dass „eine jede soziale Lage (…) mithin bestimmt (ist) durch die Gesamtheit dessen, was sie nicht ist, insbesondere jedoch durch das ihr Gegensätzliche: soziale Identität gewinnt Kontur und bestätigt sich in der Differenz“.
Ich spürte meinen Platz in der Welt, als ich am Fachabitur scheiterte und aus dem Schulsystem aussortiert wurde, in dem Sinne, als dass ich mein Scheitern – das genau genommen kein Scheitern war, denn ich bestätigte mit dem Ausschluss aus der Schule nur die Klassenposition meiner Eltern; meine vorzeitige Aussortierung aus dem Schulsystem war die Regel – als unabänderlich ansah und die Möglichkeit, die Schulklasse zu wiederholen, nicht in Anspruch nahm. Ich wusste: In der Schule zu bleiben, das ist nicht dein Weg.
Ich spürte meinen Platz in der Welt, als ich nach dem Zivildienst einen Job in einem Supermarkt annahm und in die Fußstapfen meiner Eltern und meiner Schwester trat, die allesamt im Einzelhandel gearbeitet hatten oder arbeiteten. Ich wusste: Ins Ausland zu gehen und zu studieren, wie die meisten meiner Mitschüler, das ist nicht dein Weg.
Ich spürte die Zugehörigkeit zu einer Klasse indirekt, indem ich mit den Lebenswegen meiner ehemaligen Mitschüler aus der Privatschule, auf die ich ging, fremdelte. In der Folge suchte ich meine Freundschaften unter meinesgleichen. Ich wusste: Mit deinen Mitschülern hast du nicht viel gemein.