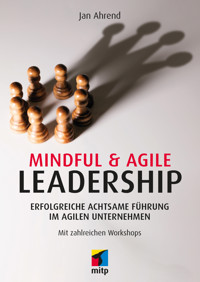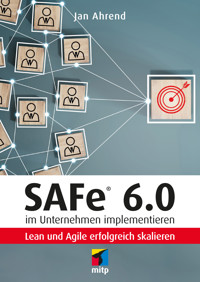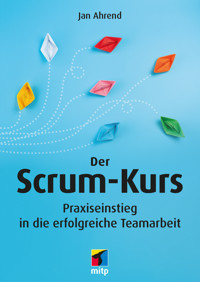Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: mitp Business
- Sprache: Deutsch
- KI-Grundlagen für Führungskräfte
- Einführung in moderne Führungskonzepte im Kontext von KI
- Strategischer Einsatz von KI für die unternehmerische Zukunftsfähigkeit
KI verstehen und richtig einsetzen
Dieses Buch gibt Ihnen das nötige Wissen an die Hand, um die Auswirkungen und daraus entstehenden Chancen der Künstlichen Intelligenz in der Arbeitswelt zu verstehen. Es zeigt, wie Sie KI erfolgreich in Ihrem Unternehmen einführen und die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine sinnvoll gestalten. Sie lernen, wie Sie KI zu Ihrem Vorteil und ohne Berührungsängste nutzen können.
Führung neu denken
Erfahren Sie, wie sich Führungsansätze im Zeitalter der KI verändern und welche bewährten Konzepte Sie auch für die KI-Transformation anwenden können. Ein innovatives Kapitel demonstriert das Potenzial intelligenter Systeme im Führungsalltag ganz praxisnah. Außerdem finden Sie zu jedem Thema Vorschläge für zielgerichtete Prompts zum praktischen Einsatz.
Unternehmen zukunftsfähig gestalten
Entdecken Sie Modelle und Strategien, mit denen Sie Ihr Unternehmen ganzheitlich für die KI-Zukunft aufstellen. Ein Ausblick auf kommende Entwicklungen hilft Ihnen, bereits heute die Weichen für morgen zu stellen.
Aus dem Inhalt:
- Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt implementieren
- Herausforderungen und Chancen der KI-Integration
- Veränderungen in der Führungsrolle durch KI
- Bewährte Führungskonzepte im Kontext von KI
- Modelle und praktische Gestaltung der Unternehmenstransformation
- Zusammenarbeit von Mensch und Maschine effektiv gestalten
- Ethische Fragen der KI-Nutzung
- Langfristige Anpassung an KI-getriebene Veränderungen
- Zukunftsperspektiven: Wie KI die Arbeitswelt weiter verändern wird
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Ahrend
KI braucht Führung
KI-Transformation im Unternehmen erfolgreich gestalten
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/opac.htm abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0973-9 1. Auflage 2025
www.mitp.de E-Mail: [email protected] Telefon: +49 7953 / 7189 - 079 Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2025 mitp Verlags GmbH & Co. KG
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Dieses E-Book verwendet das EPUB-Format und ist optimiert für die Nutzung mit Apple Books auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung von anderen Readern kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des E-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine E-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die E-Books mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen E-Book-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Lektorat: Katja Völpel Sprachkorrektorat: Jürgen Benvenuti Covergestaltung: Christian Kalkert Coverbild: © Banstanks/stock.adobe.com Satz: III-satz, Kiel, www.drei-satz.deelectronic publication: III-satz, Kiel, www.drei-satz.de
Einleitung
Seit dem Jahr 2023 ist KI ein Thema in sehr vielen Bereichen. ChatGPT hat KI erlebbar gemacht. Wir alle können es nutzen oder zumindest ausprobieren. Jeder hat eine Meinung dazu. Von Utopie bis Dystopie ist alles dabei. KI steht auch im Verdacht, nur ein Hype zu sein und genauso schnell wieder zu verschwinden, wie sie gekommen ist. Aktien mit KI wecken bei Investoren gigantische Zukunftserwartungen, und Nvidia ist das wertvollste Unternehmen.
Abb. 1: Transformation der Arbeit
Was bedeutet das für Unternehmen? Die ING-DiBa-Studie 2015 (Brzeski & Burg, 2015) schlussfolgert für Deutschland, dass 59 Prozent aller existierenden Arbeitsplätze aufgrund des hohen Industrialisierungsgrades durch KI und Automatisierung bedroht sind. Spätere Studien haben die Größenordnung bestätigt. Es gibt weitere Studien mit anderen Zahlen. Sicher ist: Eine große Veränderung steht an. Wir kennen noch keine Details, Zahlen und Daten, aber sie wird kommen. Es reicht jedoch nicht, den Blick einseitig auf den Verlust zu richten. Es werden auch neue Jobs entstehen.[1]
In der Zukunft wird KI sehr viele Aufgaben übernehmen. Die Robotik folgt der KI im Moment eher unbemerkt. Sie wird durch KI ebenfalls einen Höhenflug erleben, auch wenn dieser nicht die gleiche Beachtung findet wie die KI selbst. Diese Transformation muss gesteuert werden. Deshalb der Titel »KI braucht Führung«, und auch nachdem sie eingeführt wurde, ist nicht mehr alles wie vorher. Führungskräfte haben Teams aus Mitarbeitern und künstlicher Intelligenz. Dies ist ein Buch über Führung im Kontext von KI. Auch Führung wird sich verändern – nein, sie wird nicht digitalisiert.
In Kapitel eins werden die Grundlagen von KI so weit vorgestellt, dass die wichtigsten Zusammenhänge und Begriffe verstanden werden.
Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Prinzipien für die Arbeit mit KI vorgestellt. Diese sind relevant, um KI erfolgreich einzuführen. Die Prinzipien gelten für alle, die mit KI arbeiten.
Das dritte Kapitel beschreibt die Führung im Kontext von KI. Die zu erwartenden Veränderungen werden dargestellt. Bestehende Konzepte, die im Kontext von KI besonders geeignet sind, werden erklärt.
Das vierte Kapitel wird von einer KI geschrieben. Dort sind nur die KI-Anfragen abgedruckt. Dies soll das Potenzial von KI aufzeigen. Es fasst den aktuellen Stand der KI-Entwicklung im Bereich von Führung zusammen.
Das fünfte Kapitel zeigt auf, wie das Unternehmen als Ganzes transformiert werden kann. Modelle für diese Transformation und zur Gestaltung eines passenden Rahmens für die Transformation werden aufgezeigt.
Das sechste Kapitel versucht einen Ausblick in die Zukunft.
Dieses Buch will viel mehr sein als nur ein Text zwischen zwei Buchdeckeln. Es soll eine Lernreise initiieren. Am Ende jedes Kapitels sind KI-Anfragen (sogenannte Prompts) für eine KI aufgeführt. Die KI Ihrer Wahl schreibt dann die Kapitel weiter. Diese sind immer auf dem neuesten technischen Stand. Dieses Buch hätte ca. 1.000 Seiten, wenn man die KI-Antworten alle drucken wollte. Diese Fragen sollen zum spielerischen Umgang mit KI anregen. Eigene Fragen kommen auf, und ein eigener Dialog mit der KI beginnt. Auf diese Weise hat jeder die Möglichkeit, von den gedruckten Kapiteln ausgehend eigene Schwerpunkte zu setzen. Die Kapitel sind so gestaltet, dass sie jeweils eine Übersicht über einen bestimmten Bereich geben. Sie sind in sich abgeschlossen. Ein Springen zwischen den Kapiteln ist jederzeit möglich. Ich wünsche viel Freude auf der Reise!
Abb. 2: Lernreise – ausgelöst durch dieses Buch
Um die am jeweiligen Kapitelende abgedruckten Fragen einer KI stellen zu können, gibt es verschiedene KI-Tools, die unterschiedlich gute Antworten geben. Hier eine Auswahl der gängigsten. Wenn Sie noch keine Präferenz haben, lohnt es sich sogar, zwei oder drei im Vergleich zu nutzen, um die Stärken und Schwächen der Systeme besser einschätzen zu können. Die Gratisversionen reichen für dieses Experiment vollkommen aus.
Die gängigsten KI-Chatbots sind die folgenden:
ChatGPT
Gemini
Perplexity (geht auch ohne Login)
Claude
Für das erste spielerische Kennenlernen können diese Fragen helfen. Sie führen die Chatbots ein wenig an die Grenze der Logik.
Wie begann die Geschichte der KI im alten Römischen Reich vor Christi Geburt?
Wann werde ich persönlich durch KI arbeitslos?
Was sind die wichtigsten KI-Kunstwerke von Leonardo da Vinci?
Die Fragen finden Sie ganz bequem zum Download unter www.mitp.de/0971. Wichtig ist, die Fragen nacheinander und nicht alle gleichzeitig in das Chatfenster zu kopieren. So entsteht ein Dialog im Chatfenster und die Antworten der KI werden mit der Zeit immer besser und treffender. Die KI hat mit wirklich interessanten Texten auf die Anfragen geantwortet. Die sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ich bezeichne sie deshalb an einigen Stellen des Buches auch als Co-Autor.
[1] Zeitschrift Organisationsentwicklung, Beitrag Mensch, KI und Roboter: das neue Dreamteam?, Dr. Melanie Hasenbein, Ausgabe 3/2024
Kapitel 1: KI-Grundlagen
In diesem ersten Kapitel geht es darum, KI und den relevanten Kontext von KI besser zu verstehen. Dabei geht es nicht um Algorithmen und mathematische Modelle von KI, sondern um die Anwendung von KI im Unternehmen. Es geht um die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Mitarbeiter, um ethische und juristische Aspekte. Das Ziel ist, die Breite der Themenfelder aufzuzeigen, um einen Überblick zu schaffen. Dieses Buch hat nicht den Anspruch, die Themenfelder umfassend zu vertiefen. Das wäre weder in der Summe leistbar noch hilfreich. Bei der Vertiefung einzelner Aspekte kann die KI gute Dienste leisten. Sie ist im Gegensatz zum gedruckten Wort immer aktuell und nimmt alle neuesten Trends auf. Die Fragen am Kapitelende zeigen eine Möglichkeit auf, wie man mit einer KI interagieren kann, um Themen zu vertiefen. Wer gute Fragen stellt, bekommt gute Antworten. Die Idee ist, je nach Interesse des Lesers, am Kapitelende zur KI zu wechseln und dort mit der Recherche zu beginnen. Das Buch wird von der KI sozusagen im Virtuellen weitergeschrieben. Die Kapitel sind deshalb klar thematisch abgegrenzt und kurz gehalten. Die KI kann sehr schöne und spannende Ergänzungen formulieren.
1.1 Einführung in KI-Systeme
KI steht für »künstliche Intelligenz«. Dieser Begriff bezeichnet einen Teilbereich der Informatik. Die Abgrenzung zu anderen Gebieten der Informatik ist jedoch nicht scharf, weil der Begriff »Intelligenz« in diesem Kontext unscharf ist. Ab wie viel Logik kann man von Intelligenz sprechen?
Die Herkunft der Intelligenz kann durch Logikprüfungen, durch Regeln, durch Entscheidungsbäume oder durch maschinelles Lernen erreicht werden. Üblicherweise werden die Verfahren auch kombiniert angewendet.
Machine Learning
»Machine Learning« ist ein Teilbereich der KI. Das Training im Machine Learning wird durch den Menschen mit sehr spezifischen Daten umgesetzt. Das erlernte Wissen wird in neuronalen Netzen abgespeichert. Das Training erfolgt mit einem sehr starken Fokus auf eine konkrete Aufgabe. Ein Beispiel für den Einsatz von Machine Learning ist das Erkennen von Verkehrsschildern innerhalb des autonomen Fahrens. Ein Stoppschild muss sicher erkannt werden, um die richtige Reaktion des Autos einleiten zu können. Hierzu wird ein Netzwerk trainiert. Das Training erfolgt mit Bildern von Stoppschildern an vielen verschiedenen Kreuzungen. Mögliche Fehler bei der Erkennung werden vom Menschen korrigiert. Dadurch wird die Software immer besser und irgendwann funktioniert sie fehlerfrei.
Deep Learning
Im »Deep Learning« fällt der Mensch als Trainer für die KI weg. Die KI lernt selbstständig aus großen Mengen an unstrukturierten Daten. Die Speicherung des generierten Wissens erfolgt genauso wie beim maschinellen Lernen in neuronalen Netzen. Dabei kann ein Modell wie ChatGPT aus willkürlichen Internetdaten ein Verständnis für mehrere Sprachen und deren Grammatik aufbauen. Ein solches Netzwerk kann Bilder aller Art erkennen, auch Stoppschilder. Das hat sich das Netzwerk selbst beigebracht. Es ist jedoch unklar, wie es dabei vorgegangen ist und welche Merkmale es zur Kategorisierung heranzieht. In einem sehr bekannten Beispiel hat ein Netzwerk sehr viele Bilder zum Training bekommen. Unter den Bildern waren auch Pferdebilder. Die Pferdebilder waren zufällig alle von derselben Agentur und hatten dasselbe Copyrightzeichen. Die Software erkannte später Pferde auch zuverlässig, solange das Copyright identisch war. Pferde ohne Copyright wurden sehr viel seltener erkannt. Die Ablage der Information im neuronalen Netzwerk ist für den Menschen nicht nachvollziehbar. Wir können die Wissensrepräsentation im Netzwerk nicht den Inhalten zuordnen. Entsprechend aufwendig ist es, gelernte Fehler nachträglich zu korrigieren. Ab einem bestimmten Ausmaß von Fehlern ist es nur noch möglich, das ganze Netzwerk zu löschen und mit verbesserten Daten von vorn zu beginnen.
Entstehung von KI
Die Entwicklung von KI ist im Grunde so alt wie die Informatik selbst. Man hat sich sehr früh mit diesem faszinierenden Thema befasst. Die Möglichkeiten waren durch die Rechenleistung sehr lange erheblich beschränkt, weshalb man sich anfangs auf ressourcenschonende Verfahren beschränkte. Das erste große Ausrufezeichen in der Öffentlichkeit war der Sieg von Deep Blue im Jahr 2008 gegen den amtierenden Schachweltmeister. Es dauerte noch weitere zwanzig Jahre, bis durch neue Verfahren zur Speicherung von Wissen in neuronalen Netzen und entsprechende Rechenleistung neue Möglichkeiten eröffnet wurden.[1]
Ein weiterer öffentlichkeitswirksamer Meilenstein war der Sieg im Jahr 2011 der KI von IBM im bekannten amerikanischen Fernsehquiz Jeopardy. Hier müssen alle möglichen Fragen aus verschiedensten Wissensgebieten richtig beantwortet werden. Ähnlich große Aufmerksamkeit erzeugte es, als Google DeepMind AlphaGo die besten menschlichen Go-Spieler besiegte. DeepMind hatte sich das Go-Spielen selbst beigebracht, indem es sehr viele Go-Spiele gegen sich selbst gespielt und die daraus resultierenden Erkenntnisse in einem neuronalen Netzwerk abgelegt hatte. Aus diesem Selbststudium resultierte eine Spielweise, die selbst erfahrene Spieler überraschte. DeepMind machte dabei Züge, die bisher als »Fehler« eingestuft wurden, sich aber entgegen der Expertenmeinung als erfolgreich erwiesen. In der Folge hat sich die Spielweise von menschlichen Profispielern verändert.
Abb. 1.1: Entwicklung und Begriffe der KI
Aktuelle KI-Systeme
Was von außen wie ein KI-System aussieht, wie zum Beispiel ChatGPT, ist in Wirklichkeit ein Netzwerk aus verschiedenen KIs, die sich je nach Anfrage die Arbeit teilen. Eine Anfrage an eine KI bezeichnet man als Prompt. Dieser Prompt wird im ersten Schritt vom System selbst optimiert, um noch bessere und passendere Ergebnisse zu liefern. Manche Experten gehen davon aus, dass in nicht allzu ferner Zukunft diese Optimierung das Erstellen von komplexen Anfragestrukturen (siehe übernächstes Kapitel) überflüssig machen könnte. In den Anfragen vieler Systeme können Texte, Bilder, Sprache oder Videos gemeinsam verwendet werden. Anfragen können nicht nur von Menschen, sondern auch von Maschinen oder Robotern gestellt werden. Ein Haushaltsroboter könnte ein Foto einer Küche zusammen mit dem vom Menschen erhaltenen Befehl »Stell das Glas bitte in die Spülmaschine« senden. Aus dem Kontext könnte die Vorverarbeitung ergänzen: »Der Roboter benötigt eine Anweisung in Maschinensprache.«
Abb. 1.2: KI-Beispiel einer Systemlandkarte
Der Prompt wird an die KI übergeben und dort verarbeitet. Bei der Verarbeitung können sehr viele kleinere und vor allem spezialisiertere Modelle zum Einsatz kommen. ChatGPT hat gelernt, dass es selbst nicht besonders gut rechnen kann. Deshalb hat es ein weiteres Modul bekommen, das diese Rechenaufgaben übernehmen kann. ChatGPT extrahiert also die enthaltene Rechenaufgabe und sendet nur diese an das Modul. Das Modul löst die Aufgabe und gibt sie zurück an ChatGPT. ChatGPT baut aus der Anfrage und dem Rechenergebnis die entsprechende Antwort.
Nachbearbeitung der Ergebnisse
Die Nachbereitung der Ergebnisse ist wichtig, um korrekte Antworten auszugeben. Teile davon kann das Modell selbst lernen, in bestimmten Fällen muss nachträglich noch gefiltert werden, damit die anfragende Person korrekt behandelt wird. Dieser Schritt hat durchaus Nebenwirkungen. Wenn man ChatGPT nach Tipps zu Ergebnissen von zukünftigen Fußballspielen fragt, tendiert es gern zu einem Unentschieden. Man vermutet, dass dies mit der vorgegebenen Gleichbehandlung zusammenhängt.
Das Beispiel mit dem Küchenroboter könnte eine ganze Serie von Anfragen auslösen. Die Antwort der KI könnte sein, wo eine Spülmaschine in der Küchenzeile auf dem Bild identifiziert wurde und der Fahrweg des Roboters dahin. Wenn sich der Roboter auf den Weg macht und an der Maschine angekommen ist, könnte der Roboter das nächste Bild senden. Die KI könnte daraus die Marke der Spülmaschine identifizieren und dem Roboter als Antwort mitteilen, wie er sie öffnen kann. Auf ein Bild vom Inneren der Maschine, das den Füllstand zeigt, könnte eine Position für das Glas als Antwort kommen. Eine komplexe Aufgabe wird in viele kleine Teilschritte aufgesplittet. Der Roboter allein bräuchte nicht mehr sehr viele eigene Fähigkeiten. Die Hürde für die Robotik in der Vergangenheit war, dass ein Haushaltsroboter selbst alles lösen musste. Dazu musste er alle Spülmaschinen und deren Bedienung lernen, um eine solche Aufgabe selbstständig zu lösen. Die Kombination von KI und Robotik befreit die Robotik von dieser Komplexität. Aus diesem Grund werden in naher Zukunft erhebliche Fortschritte in diesem Feld erwartet. Der Haushaltsroboter wird vermutlich jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Lernen mit KI
Eine sehr gute Quelle, um noch mehr über die Entwicklung von KI zu erfahren, ist eine KI selbst. Man braucht ihr nur die richtigen Fragen zu stellen. Die folgenden Fragen sind ein paar Beispiele, mit denen man die KI dieses Kapitel schreiben lassen könnte:
Was ist künstliche Intelligenz und wozu kann man sie nutzen, erkläre es mir bitte wie einem Fünfjährigen?
Wie grenzt sich Machine Learning von Deep Learning ab?
Welche Rolle spielt die Verarbeitung natürlicher Sprache für die KI und für die Robotik?
Welche Wellen hat es in der Entwicklung von KI bisher gegeben und welche Wellen sind in naher Zukunft zu erwarten?
Wozu braucht es in der Zukunft noch gedruckte Bücher?
Alle vier Modelle antworten jeweils etwas anders. Alle zeigen neue, interessante Aspekte auf und laden zum Weiterforschen ein.
1.2 Einfluss von Daten und Datenqualität
Ohne Daten keine KI. Der Zusammenhang ist vorweg erst einmal unstrittig. Die KI benötigt sehr viele Daten zum Lernen und Trainieren. Es verwundert auch nicht, dass die Qualität der KI-Ergebnisse von der Qualität der Daten abhängt. Datenqualität wird dabei durch die folgenden Attribute bestimmt: Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Rechtzeitigkeit, Gültigkeit, Einzigartigkeit. In einer auf Daten basierenden KI ist es noch vergleichsweise einfach, die Datenqualität einschätzen zu können. Dies ändert sich jedoch sofort, wenn man zum Beispiel eine KI für die Selektion von Bewerbern in der Personalabteilung am Markt einkauft. Dann kauft man zusammen mit der KI sozusagen die Daten ein. Mit dem Aufstieg der KI hat auch der Datenhandel einen erheblichen Aufschwung erlebt. Nicht bei allen Datensätzen, die gehandelt werden, ist die Urheberschaft eindeutig. Viele junge KI-Startups stehen unter erheblichem Erfolgs- und Zeitdruck, was zu Kompromissen bei der Datenqualität führen kann. Für den Kunden ist es deshalb wichtig, sich selbst ein klares Bild zu machen. Wenn die KI im Personalbereich Minderheiten oder Geschlechter diskriminiert, kann das erheblichen Schaden anrichten. Juristisch lässt sich das Thema Compliance möglicherweise auf den Anbieter übertragen, den Reputationsschaden hat jedoch das Unternehmen selbst.
Von möglichen negativen Folgen einmal abgesehen, werden sich die positiven Effekte von KI nicht im gewünschten Umfang einstellen. Die Qualität von Analysen oder die Effizienz in der Kollaboration könnten sich möglicherweise nicht wie gewünscht entwickeln.
Wer auf eigenen Daten basierend eine eigene KI entwickelt, wird feststellen, dass in diesem Entwicklungsprozess der Datenerhebungsprozess eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Dieser lässt sich nicht linear planen, sondern wird iterativ in Schleifen ausgeführt. Es ist ein explorativer Suchprozess. Er beginnt immer wieder mit der Auswahl von relevanten Daten. Datenanalysten bauen dann in einem kreativen Prozess neue Modelle auf. Diese werden so visualisiert, dass die Anwender die Ergebnisse gut nutzen können. Basierend auf dem Feedback der Anwender wird in einer weiteren Schleife das Modell weiter optimiert. Für die Umsetzung bedeutet dies den Einsatz von agilem Projektmanagement in Verbindung mit interdisziplinären Teams, in denen unterschiedliche Experten gemeinsam kollaborieren. Die Schleifen können am Anfang noch deutlich kürzer als in der agilen Softwareentwicklung sein, und es ist auch nicht immer notwendig, alle Prozessschritte abzuarbeiten. Manche Iterationen werden frühzeitig abgebrochen, und es wird wieder neu angesetzt.
Abb. 1.3: Datenqualität und Datenprozess für KI-Nutzung
Vor dem Start eines KI-Projektes sollten unbedingt die folgenden Fragen geklärt werden:
Welche Daten können verwendet werden?
Ist der Umfang der Daten ausreichend für die Erreichung der angestrebten Ziele?
Wie hoch wird die Datenqualität von Experten eingeschätzt?
Sind Compliance und Datenschutz gewährleistet?
Wie werden die Daten aktuell gehalten?
Möglicherweise müssen bestimmte Datenquellen zugekauft werden, was Einfluss auf das Projektbudget hat. Oder Teile können besser durch die Integration anderer KI-Systeme umgesetzt werden. Prototypen können helfen, aus vielen möglichen Ansätzen die beste Lösung auszuwählen.[2]
Lernen mit KI
Die Fragen für die KI zum Weiterführen des Themas können sein:
Wo bekommen KI-Anbieter ihre Daten her?
Wie kann ein Kunde die Datenqualität von gekauften KI-Anwendungen prüfen?
Wie kann ein Kunde die Compliance einer KI-Anwendung prüfen?
Was sind die Aufgaben von Datenanalysten in KI-Projekten?
Wie werden Datenanalysten ausgebildet, und wie einfach ist es, gute Datenanalysten einzustellen?
Was ist meine Verantwortung als Manager beim Einsatz einer KI in meiner Abteilung?
1.3 Prompt Engineering
Als Prompt Engineering bezeichnet man das Gestalten von Anfragen an die KI. Das klingt erst mal trivial, ist es aber je nach gestellter Aufgabe nicht. Das Werkzeug, also die KI, ist immer dasselbe. Je nachdem, wie man eine Anfrage gestaltet, erhält man unterschiedliche Ergebnisse. Das Wort Engineering klingt danach, dass es sich um eine technisch geprägte Fachrichtung handelt, das passt jedoch nur zum Teil. Es handelt sich um einen explorativen Prozess, in dem es bestimmte Regeln gibt, aber keine Wissenschaft. Mit jeder neuen Version von Sprachmodellen ändert sich das Verhalten der KI wieder.
Das folgende Kapitel ist mithilfe von KI geschrieben. In der ersten Beschreibung erkläre ich, wie ich die Anfrage für dieses Kapitel erstellt habe. Dann erklärt die KI selbst das Hauptthema »Prompt Engineering«. In diesem Fall habe ich mich für ChatGPT als Co-Autor entschieden. Die gegebenen Beispiele im Text waren treffender und leichter nachzuvollziehen als die der anderen Chatbots.
Ein Prompt besteht aus ganz normaler Sprache. Das Kernstück ist eine Frage, in der ich der KI mein Anliegen mitteile. Für einfache Themen reicht es oft, einfach eine treffende Frage zu formulieren. Im folgenden Prompt lautet die Frage:
»Wie kann ein Mensch über Prompts eine KI steuern und gute Anfragen generieren?«
Der nächste Absatz beschreibt, welche Details mir besonders wichtig für die Frage sind. Grundsätzlich gilt: Je mehr Kontext ich der KI übergebe, desto passender werden die Antworten. So ist auch die Ergänzung mit dem Beispiel für die Ausgabe zu verstehen.
Abb. 1.4: Prompt-Engineering-Methoden
Prompt Anfrage
Gehe bitte insbesondere auf die folgenden Methoden ein:
Statische Eingabeaufforderungen
Agenten
Prompt-Zerlegung
Prompt-Vorlagen
Modi und ChatML
Eingabeaufforderungs-Pipelines
Kontextbezogene Eingabeaufforderungen