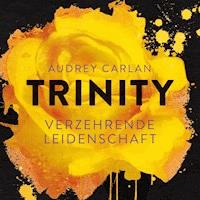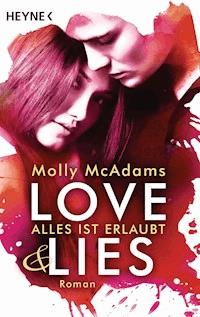Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Diese Buch, das erstmals 1742 erschien und sich bereits damals großer Beliebtheit erfreute, ist inzwischen zu einem Klassiker der französischen erotischen Literatur geworden. Der Roman schildert den Aufenthalt eines jungen Franzosen in Konstantinopel und seine Liebesabenteuer im Reich des Sultans. Er entführt uns in die magische und geheimnisvolle Welt der orientalischen Erotik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicolas Fromaget
Sexabenteuer in türkische Harems
Inhalt
Band 1
Band 2
Vorwort
Das französische Original dieses erotischen Romans erschien 1742 unter dem Titel „Le cousin de Mohammed“ (Der Vetter Mohammeds). Von dem Autor Nikolas Fromaget wissen wir nur, daß er 1759 gestorben ist. Außer diesem Roman verfaßte er noch einige andere galante Erzählungen.
Das vorliegende Werk erfreute sich im 18. Jahrhundert einer großen Beliebtheit, wie die zahlreichen Ausgaben und Übersetzungen beweisen. Der Taschenbuchausgabe wurde eine deutsche Übersetzung aus dem Jahre 1787 zugrunde gelegt, die mit der französischen Erstausgabe verglichen wurde. Diese alte deutsche Übersetzung enthält einige Zusätze, welche die Handlung besser motivieren und ausgestalten.
Fromagets Roman, der zu den klassischen Werken der französischen erotischen Literatur zählt, schildert die Liebesabenteuer eines jungen Franzosen im Reich des Sultan. Da diese Liebesaffären durch widrige Umstände jeweils schnell ein Ende finden, lernt der liebeshungrige Sklave fast alle Gruppen und Würdenträger des osmanischen Reiches kennen. Der Leser erfährt so viele Einzelheiten über das Sexualverhalten der Türken, die damals durch zahllose Reisebeschreibungen in Europa bekannt wurden. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Bemerkungen des Autors über die sexuellen Praktiken der Sekte der Bekthaschiten. Der junge Franzose verliebt sich auch in die Verwandte eines Scherrif. Die Angehörigen dieser Gruppe behaupten, daß sie direkte Abkömmlinge Mohammeds seien, und deshalb trägt dieser Roman auch den Titel „Der Vetter Mohammeds“. Denn der Held dieses Romans wurde durch dieses Liebesabenteuer ein Verwandter Mohammeds.
Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts wußte man von dem Palast des Sultans, dem Serail und seinem geheimsten Teil, dem Harem, nur wenig.
Im Jahre 1740 entschließt sich ein junger Franzose namens Flachat, eine ausgedehnte Orientreise zu unternehmen. Der französische Botschafter erlaubt ihm jedoch nur, Konstantinopel zu besuchen und sich dort aufzuhalten. Dieser junge Franzose gewinnt die Freundschaft und das Vertrauen eines hohen Beamten des Serail. Aufgrund dieser Beziehung gelingt es ihm als erstem Außenstehenden, den Harem zu sehen.
Seine Beobachtungen veröffentlicht er in einem Buch. Man wird in Paris auf diesen jungen Franzosen nicht zuletzt wegen seiner geschäftlichen Erfolge aufmerksam. Ludwig IV. verleiht ihm den Titel „Königlicher Kaufmann“.
Der Held dieses pikanten Erotikums hat eine große Ähnlichkeit mit Flachat.
Die Biographie und das literarische Werk Fromagets sind leider nicht erforscht, so daß bei unserem Kenntnisstand dazu nur sehr beschränkte Aussagen möglich sind. Ich habe jedoch Hinweise gefunden, daß Fromaget durch diesen Flachat zu dem vorliegenden Roman angeregt wurde und den Titelhelden nach ihm gezeichnet hat.
Helmut Werner
BAND 1
Wenn es feststeht, daß unser Leben ein Gewebe aus kummervollen Stunden und Vergnügungen ist, so kann ich durch mein Beispiel beweisen, daß man sich den Kummer sehr erleichtern und durch Mut und Geduld sich Vergnügungen verschaffen kann.
Wollte ich mich der Sprache unserer Philosophen bedienen, so würde ich sagen, daß ich wohl zwanzigmal ohne Furcht den Tod vor Augen gesehen habe. Man würde mir dies schwerlich glauben, zumal wenn ich noch anführe, daß ich bei all dem stets der Gefahr ausgesetzt war, lebendig eingegraben, verbrannt, ins Meer gestürzt oder in einen ledernen Sack eingenäht zu werden.
Eigentlich hat mich nicht die Lust zu reisen in die Türkei geführt, sondern der Grund hierfür lag in meiner Unzufriedenheit mit den unerträglichen Launen eines meiner Lehrer, der in der Schule zu Harcourt meine Studien beaufsichtigte. Diese mürrischen Leute können bekanntlich nur solche Menschen leiden, welche die gleiche Gesinnung wie sie haben. Mein aufgewecktes Wesen erlaubte es mir nicht, mich ihnen anzupassen. Dieser Schulmeister, von dem ich hier rede, stellte einige unbedeutende und lustige Jugendstreiche, die ich begangen hatte, bei meinen Verwandten als schwere Verbrechen hin. Mein Großvater, ein schlichter Pariser Bürger, der keineswegs so viel Einsicht besaß, um das steife Wesen dieser Herren richtig zu beurteilen, gab meinem Lehrer in meiner Gegenwart den Auftrag, mich bei der erstbesten Gelegenheit so nachdrücklich zu züchtigen, daß ich mich lange Zeit daran erinnern würde.
Diese Gelegenheit blieb nicht lange aus. Da mir einer meiner Schulfreunde, der das Vertrauen des Lehrers genoß, einen Wink gab, so hielt ich es für richtig, einige Tage die Schule nicht zu besuchen. Ich hoffte nämlich, in dieser Zeit Mittel finden zu können, um das drohende Unheil abzuwenden. Aber das machte die ganze Sache noch schlimmer.
Der Lehrer beschwerte sich erneut. Man hielt einen Familienrat, in welchem beschlossen wurde, daß man mich eine Zeitlang in das Krankenhaus St. Lazare einweisen würde, wenn ich mich nicht freiwillig der Züchtigung unterziehen würde, die ich nach ihrer Meinung zu recht verdient hatte. Ein Mitglied dieses Rates, der Bruder meiner Mutter, der viel älter, aber auch viel verständiger als ich war, verriet mir diesen Plan meiner Verwandten, weil er mich gern hatte.
Ich folgte seinem Wink, entwischte auf sehr listige Weise der Obhut meiner Verwandten und verließ danach meine Heimat, nachdem ich meine Taschen so voll wie nur möglich gestopft hatte.
Ich ging zum Tor St. Antoine hinaus. Eine heimliche Angst trieb mich, ohne daß ich es auch nur gewagt hätte, mich umzusehen, bis nach Charenton fort. Dort betrat ich ein Wirtshaus und setzte danach meinen Weg, ohne zu wissen wohin, fort, nachdem ich mich erquickt und ausgeruht hatte. Ich folgte eine Zeitlang der Heerstraße und gelangte schließlich nach Villeneuve St. George. Sämtliche Einwohner waren auf den Beinen, um sich die Ankunft der Galeerensklaven nicht entgehen zu lassen, die am selben Tag von Paris nach Marseille abmarschiert waren.
Welch ein Glück, dachte ich bei dieser Nachricht. Etwas besseres könnte mir in meiner jetzigen Lage gar nicht zustoßen. Ich wollte mich der Gesellschaft dieser Herren anschließen, um schnell Paris zu verlassen und vor Räubern sicher zu sein, weil sie einen so großen Zug bestimmt nicht wagen würden anzugreifen. Übrigens glaubte ich, daß die Stadt Marseille ein Ort sei, wo ich vor den Verfolgungen meines Schullehrers sicher sein könnte.
Ich stand auf, bezahlte meine Zeche und folgte mit ungefähr dreißig Sous, welche nach Abzug der bisherigen Unkosten meine ganze Barschaft waren, meinen neuen Reisegefährten nach. Dies war gewiß sehr wenig für eine so lange Reise. Ich entschloß mich also, nur sehr wenig für meine Verpflegung auszugeben. Im Notfall konnte ich noch die Kleidungsstücke verkaufen, die ich von meinen Verwandten mitgenommen hatte. Darunter waren einige sehr schöne Schnupftücher und ein Paar seidene Frauenstrümpfe. Das wertvollste Stück meiner Habseligkeiten war ein Gebetbuch, das mit Silber beschlagen war und Schlösser aus dem gleichen Metall besaß. Dies war ein Familienstück, welches meine Mutter von der ihren und diese von ihrer Großmutter geerbt hatte.
Obgleich mein Barvermögen nicht sehr groß war und die übrigen Gegenstände nicht sehr wertvoll waren, so glaubte ich dennoch, nicht nur bis Marseille, sondern bis an das Ende der Welt zu kommen. Diese Hoffnung gab mir Mut, und ich folgte fröhlich dem Zug nach. Ich näherte mich allmählich der Kette, an welche diese Unglücklichen hintereinander angeschlossen waren. Einer von ihnen reichte mir seine hölzerne Schale und bat mich, ihm etwas Wasser aus dem Bach zu geben. Ich erwies ihm diesen Dienst mit so willigem Herzen, daß noch einige seiner Gefährten mich um die gleiche Gefälligkeit baten. Als ich den Durst derjenigen, die am meisten darunter litten, löschte, gab mir einer ihrer Wächter einen derben Kolbenstoß und fragte mich trotzig, weshalb ich mich um Dinge kümmere, die mich nichts angingen.
Durch den heftigen Stoß konnte ich ihm keine Antwort geben. An meiner Stelle taten dies aber diejenigen, die ich so mitleidsvoll behandelt hatte. Aber der Strom von Flüchen, den sie über ihm ausschütteten, wurde auf der Stelle durch eine gute Anzahl von Stockschlägen vergolten. Dadurch wurde die Unruhe und der Lärm so vermehrt, daß der Kommandeur der Wache anhalten ließ und sich dorthin begab, wo die Tat begangen wurde, um sich nach der Ursache des Lärms zu erkundigen.
Der Wächter erzählte ihm den Fall und beteuerte auf Ehre und Gewissen, daß ich entweder ein Verwandter oder doch wenigstens ein Bekannter von einem ihrer Gefangenen sein müßte. Ich würde nicht zu ihnen halten, um ihren Durst zu stillen, sondern ich hätte die Absicht, ihnen bei der Flucht zu helfen.
Der Kommandeur, der gewohnt war, alles nur von der schlimmen Seite zu betrachten, stimmte meinem Ankläger völlig bei, lobte die Feinheit seiner Beobachtungsgabe und befahl, daß ich ohne Verzug auf das genaueste untersucht werden sollte.
Wie geschickt waren diese Herren beim Leeren meiner Taschen. In weniger als einem Augenblick waren sie völlig leer. Da der Glanz des Gebetbuches die Blicke des Kommandeurs auf sich gezogen hatte, verlangte er, es näher zu betrachten. Jeder andere, der auch nur die geringste Erfahrung gehabt hätte, würde aufgrund dieses Begehrens sogleich geurteilt haben, daß dieses Buch nunmehr wohl in eine andere Familie übergegangen sein dürfte. Dieser Meinung waren auch einige von den Gefangenen, die mir mit leiser Stimme zuflüsterten, daß ich das Buch nie wieder sehen würde. Offenbar hätte ich eine so gute Meinung von der Rechtschaffenheit einer Person, die dem Äußeren nach den Charakter eines ehrlichen Mannes zu haben schien, daß mir ein solcher Gedanke gar nicht gekommen sei.
Die Erfahrung hatte mich lehren müssen, daß auch der schönste und treuherzigste Gesichtsausdruck sehr oft trügt. Der Kommandeur, der so viele ehrliche Leute befehligte, fragte mich mit donnernder Stimme, wo ich dieses Kleinod gestohlen hätte, das er schon in seine Tasche steckte. Ein Wächter ergriff bei dieser Frage das Wort und behauptete, indem er ein Buch des römischen Dichters Horaz vorzeigte, daß ich ein Kirchendieb sein müßte, weil man noch ein Buch bei mir gefunden hätte. Seine Gefährten, die noch mit der Betrachtung meiner Schnupftücher und seidenen Strümpfe beschäftigt waren, bestärkten ihn in seiner Meinung. Diese Vermutung hatte allerdings einige Wahrscheinlichkeit für sich und wurde durch meine Angst und Tränen bald zur Gewißheit. Die Gefangenen fällten das selbe Urteil über mich, und einige von ihnen wunderten sich sogar, daß sie mich nicht kannten. All meine Bemühungen, mich zu rechtfertigen, waren umsonst. Meine Richter waren an meiner Unschuld auch gar nicht interessiert. Wenn ich unschuldig war, so mußten sie mir meine Habseligkeiten wieder zurückgeben. War ich schuldig, so war es für sie allemal ein guter Fang.
Eine solche Schlußfolgerung, die bei solchen Leuten gang und gäbe ist, überwog alle Gründe, die ich zu meinen Gunsten anführen konnte, und ich glaubte schon, daß der Offizier mich an die Reihe der anderen anschließen lassen würde. Doch begnügte er sich, mir zu befehlen, ihm zu folgen und mir einen Wächter beizugeben, der mich nicht aus den Augen lassen durfte.
Der Zug setzte nunmehr seinen Marsch fort, und unterwegs wurde die bei mir gefundene Beute geteilt. Mit gesenktem Kopf und hängenden Ohren folgte ich dem Zug und verwünschte all meinen Reichtum, der mir dieses Unglück eingebracht hatte, indem ich sogleich Betrachtungen über die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge anstellte.
Vor allem beklagte ich den Verlust meiner Reichtümer mit viel Bitterkeit. Sicherlich hatte ich auf diese Sachen allemal mehr Rechte als diejenigen, die sich diese jetzt aneigneten. Übrigens ging diese Angelegenheit allenfalls nur mich und meine Miterben etwas an. Diese Herren hatten keineswegs das Recht, dabei ein Wörtchen mitzureden.
Bei unserer Ankunft an dem Ort, wo wir zu Mittag essen wollten, hielt ich dem Kommandeur beim Absteigen den Steigbügel, um mir seine Gunst zu erwerben. Durch diese Aufmerksamkeit lenkte ich sein Interesse erneut auf mich. Während die Wächter ihre Opfer in einen großen Hof führten, wo sie bewacht werden sollten, befahl er mir, ihm in sein Zimmer zu folgen. Der Hausherr hatte ihm dies mit allen Zeichen der Unterwürfigkeit eingeräumt, die er einem so würdigen Offizier schuldig zu sein glaubte. Ich war so diensteifrig, daß ich seinem Kammerdiener beim Ausziehen der Stiefel helfen wollte, aber dies lehnte er ab, weil ich nach seiner Auffassung für so etwas nicht geschaffen sei. Er fügte noch hinzu, er habe die ganze Zeit über Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß sein erster Eindruck von mir allem Anschein nach doch wohl falsch sein müßte.
„Ach, mein Herr“, antwortete ich mit einem tiefen Seufzer. „Sie haben recht, ich bin nicht zum Diener geschaffen, noch weniger spüre ich die Neigung, das Handwerk eines Räubers zu betreiben.“
„Das will ich gern glauben“, erwiderte er, „aber woher haben Sie die Sachen, die man bei Ihnen gefunden hat?“
Diese Frage machte mich verlegen. Es war sehr schwierig, den Beweis zu führen, daß ich keine Neigung zum Stehlen hatte und den Anschein, der gegen mich sprach, zu zerstreuen.
Ich entschloß mich also, die Wahrheit zu gestehen, nachdem ich mit mir kurz Rat gehalten hatte, und bat ihn, daß er seinen Diener aus dem Zimmer entfernen sollte. Aufgrund dieser Vorsichtsmaßnahme kam er auf den Gedanken, daß dieses Geheimnis, das ich ihm an vertrauen wollte, von großer Wichtigkeit sein müsse. Er befahl deshalb, uns allein zu lassen.
„Nun, mein Kind“, sagte er zu mir, „lassen Sie mich Ihr Anliegen hören. Ich bin nicht willens, Sie unglücklich zu machen. Aber Sie müssen mir die Wahrheit gestehen. Sonst können Sie von mir keine Gnade erhoffen.“
Da mir dieser Beginn unserer Unterredung die Angst nahm, erzählte ich ihm mit großer Treuherzigkeit meine Flucht und die Ursachen, die mich dazu bewogen haben. Ich bemerkte, daß jede Einzelheit meiner Schulgeschichte ihn erheiterte. Deshalb fuhr ich fort, meinen Fall in einem günstigen Licht erscheinen zu lassen. Dreistigkeit trat bei mir an die Stelle der Furcht, die vorher mein Denken und Fühlen bestimmt hatte. Ich beendete meinen Vortrag mit so standhaften und männlichen Ausdrücken, daß mein Richter sich hinreißen ließ, in ein lautes Gelächter auszubrechen. Dies brachte mich ganz aus der Fassung. Als ich nachdenklich wurde, versuchte mein Zuhörer mich zu zerstreuen und fragte mich, wo ich mich hinzuwenden gedächte.
„Es ist mir gleichgültig“, erwiderte ich ihm, „wohin mein Schicksal mich führt, wenn ich nur nicht die Züchtigung erdulden muß, die man mir angedroht hat . .
„Es ist wahr“, unterbrach er mich mit einem bedenklichen Kopfschütteln, „Sie sind nicht der erste junge Mann, der auf diese Weise seine Familie verläßt, aber Sie sind noch zu jung. Doch Reisen bildet. Sie handeln nicht schlecht, wenn Sie ein wenig die Welt kennenlernen. Haben Sie Geld?“
„O ja, mein Herr“, erwiderte ich, „ich habe dreißig Sous, und wenn ich das Buch, welches Sie in der Tasche haben, und die Schnupftücher, welche Ihre Herren in Verwahrung genommen haben, verkauft habe, besitze ich genug Geld, um nach Marseille zu kommen. Dorthin möchte ich gehen.“
Nachdem er ein wenig darüber nachgedacht hatte, sagte er zu mir, daß mein Buch nur sehr wenig Geld bringen würde. Trotzdem wolle er mir aus Freundschaft helfen, es für einen anständigen Preis unter die Leute zu bringen. „Ich werde es behalten“, fuhr er fort. „Gehen Sie mit meinen Leuten zum Mittagessen, und weil Sie Lust haben, einen Seehafen zu sehen, erlaube ich Ihnen, mit uns zu reisen.“
Ich verließ das Zimmer und pries diesen Mann, der mir einen so vorteilhaften Verkauf der besten Stücke meiner Habseligkeiten vermitteln wollte. Ihm hatte ich es zu verdanken, daß ich mit Hilfe seines Sklaventransportes ohne Schwierigkeiten nach Marseille kommen konnte. Dies ließ ich mir jedoch nicht anmerken.
Ich hatte die Ehre, mit seinen Wächtern an einem Tisch zu speisen, die mir zuerst einige Schwierigkeiten machten, als ich mich dort niederließ. Sie fühlten sich beleidigt, weil sie einer Person Gesellschaft leisten sollten, die im Verdacht eines Diebstahles stand. Nachdem ihr Kommandeur ihnen bedeutet hatte, daß ich ein ehrlicher Kerl sei, den er in seinen Schutz genommen habe, hörten aber alle Einwände auf. Nach einem sehr guten Mittagsmahl setzten wir unsere Reise fort und jeder versah wieder seinen Dienst. Was mich anbelangte, so nutzte ich die Freiheit, die man mir gestattete, nach Möglichkeit aus und folgte bald vorn, bald hinten, bald seitwärts nach meinem Belieben dem Zug. Ich wagte es sogar, neben dem Kommandeur zu gehen, und meine Verwegenheit war erfolgreich. Er stellte mir verschiedene Fragen, und meine Antworten fanden Beifall.
„Sie haben Verstand“, sagte er zu mir in einer Art und Weise, mit der man gern zu erkennen geben möchte, daß man selbst welchen besitzt. „Dies wird Ihnen von Nutzen sein, denn mit Vergnügen nimmt man einen jungen und gesunden Mann mit fähigem Kopf auf ein Schiff. Ich bin bereit, Ihnen bei meiner Ankunft zu einer solchen Stelle zu verhelfen.“
Beglückt von diesen angenehmen Aussichten, bemerkte ich überhaupt nicht die Beschwerlichkeiten einer so langen Reise. Denn ich hatte erfahren, daß Marseille viel weiter entfernt war, als ich glaubte. Da ich ein junger Mann von sechzehn Jahren war, der sich für einen Fußmarsch hinlänglich stark fühlte und während der Reise für seinen Unterhalt sorgen mußte, hielt ich einen Weg von mehr als sechzig Meilen für eine unbedeutende Kleinigkeit. Als ich schon für mein Gebetbuch vier Mahlzeiten verzehrt hatte, wollte man mir die fünfte versagen. Ich beschwerte mich auf der Stelle bei meinem Gönner, der mich aber aus dem Zimmer wies. Er gab mir zur Antwort, ich hätte kein Recht zu verlangen, daß man mich bis Marseille ernähre. Ein Wanderer, der vom Blitz geblendet wird, ist weniger von dem Donner betroffen, der mit entsetzlichem Geprassel über seinem Haupt niedergeht und ihn zu zermalmen, droht, als ich beim Anhören dieser Worte. Diese Antwort brachte mich völlig aus der Fassung.
Unbeweglich stand ich da, und trotz aller Anstrengungen meines Verstandes wußte ich nicht, wie ich mit dreißig Sous die weite Reise beenden konnte. Ich ging die Treppe hinunter und wiederholte in meinen Gedanken mit schmerzlichen Empfindungen die letzten Worte meines Gönners: Sie haben nicht das Recht zu fordern, daß ich Sie bis Marseille ernähre.
Ich begab mich in die Küche, wo ich in einem Winkel ein den Umständen angemessenes Mittagessen verzehrte. Ich war lange Zeit unschlüssig, ob es nicht besser wäre, wieder zu meinen Verwandten zurückzukehren, als auf meinem Vorhaben zu bestehen, aus meiner Heimat zu verschwinden.
Ich hatte mich noch ganz meinem Kummer hingegeben, als ein Galeerensklave im Vorbeigehen mir zurief: „Hab Mut, Freund! Heute haben wir eine große Tagesreise vor uns. Ich kenne den Weg. Ich habe ihn einst als Feldwebel der Eskorte zurückgelegt. Jetzt gehe ich ihn als Sklave. Aber in beiden Fällen ist er gleich lang. In der Welt kommt es bloß auf Zeit und Glück an.“
Diese Bemerkung beendete mein Nachdenken. Als ich mich nach der Person, die dies sagte, umsah, erkannte ich, daß es eben derjenige war, der vor einigen Tagen mich gebeten hatte, ihm etwas zu trinken zu geben. Ich ging neben ihm her, und nachdem wir uns über gleichgültige Dinge unterhalten hatten, fragte er mich endlich, was aus meinem Buch geworden sei.
„Das werde ich leider nie wieder sehen“, antwortete ich mit einem Seufzer.
„Das will ich gern glauben“, erwiderte er, „denn auch Ihre Schnupftücher sind größtenteils verkauft. Seht, dieser Greis da, der zehnte Mann von hier, der unter der Last seiner Jahre und der Ketten schwer zu leiden scheint, hat den Auftrag bekommen, Ihre seidenen Strümpfe zu verkaufen. Der Wächter, dem sie bei der Teilung zugefallen sind, würde nicht soviel als er dafür bekommen, wenn er sie als sein Eigentum verkaufen würde. Denn dieser alte Mann erregt bei allen gutherzigen Menschen so viel Mitleid, wenn wir an ihnen vorbeiziehen, daß er sie gut absetzen kann. Der Eigentümer und der Verkäufer teilen sodann den Gewinn. Auf diese Weise leben wir und lassen andere leben. Dieser harmlose Handel fördert das gute Einvernehmen auf beiden Seiten, weil jeder auf seine Kosten kommt.“
„Sie sind wohl“, sagte ich zu ihm, „wegen Ihres ehemaligen Ranges einer von diesen ehrlichen Verkäufern?“
„Es war von mir unklug gewesen“, antwortete er lebhaft, „Ihnen eine so wichtige Angelegenheit anvertraut zu haben. Meine ehemaligen Kameraden wissen nicht oder geben vor, als ob sie es nicht wüßten, wer ich gewesen bin.“
„Wenn ich an Ihrer Stelle wäre“, erwiderte ich, „so würde ich mich ihnen zu erkennen geben, und sie würden auf Sie in vielerlei Hinsicht Rücksicht nehmen, weil Sie ein ehemaliger Kamerad sind.“
„Blitz und Hagel!“ schrie er heftig. „Das werde ich bleiben lassen! Wenn mich nämlich das Unglück treffen würde, daß sie davon etwas erfahren würden, so würden sie mich bedenkenlos ermorden, weil sie die Ehre ihrer Gemeinschaft retten wollten. Diese Herren sind sehr streng, wenn es um ihre Ehre geht. Wissen Sie denn nicht, daß es etwas Unerhörtes ist, wenn ein Wächter zu der Galeerenstrafe verurteilt worden ist?“
„Sie vermitteln mir einen sehr hohen Begriff von dieser Gemeinschaft, und ich kann nicht den Grund erkennen, weshalb Sie ausgestoßen wurden.“
„Ich konnte mich“, erwiderte er, „zu gewissen gemeinen Kniffen nicht entschließen, die man wohl nicht vermeiden kann, wenn man unter diesen Leuten ohne Verdruß und in Ruhe leben will. Ich legte meine Stelle also nieder und wählte, um mein Gewissen zu beruhigen, das Handwerk eines Schwarzhändlers. Ich wurde verraten und ertappt. Ein einziger Tag raubte mir die Früchte meiner vierjährigen Arbeit. Meine Freunde haben alle Mühen angewandt, die Sache durch Vermittlung einer Dirne aus der Gegend des Palais Royal beizulegen, welche einer unserer Herren Pächter aushält. Sie wollte sich für mich verwenden. Aber ich konnte ihr nur ein sehr mittelmäßiges Opfer anbieten, und da mir fünfzig elende Gulden fehlten, wurde ich zum Ruder verurteilt. Doch ich habe mich jetzt mit meinem Schicksal abgefunden. Ich habe das Glück gehabt, keine Brandmarke zu bekommen. Die drei Jahre werden bald vorüber sein. Da ich noch jung bin und noch - Gott sei Dank - genug Jugendkräfte besitze, werde ich alle Strapazen aushalten.“
Nach diesem freimütigen Geständnis hielt er sich für berechtigt, von mir ebensoviel Vertrauen zu verlangen. Deshalb erzählte ich ihm meine Geschichte. Ich beendigte sie mit der Schilderung meiner Sorgen, denn ich wußte ja nicht, ob ich meine Reise fortsetzen oder zu meinen Verwandten zurückkehren sollte.
„Wenn Sie mehr Geld hätten“, unterbrach er mich, „so würde ich Ihnen raten, die Reise mit uns fortzusetzen.“ Nachdem er ein wenig nachgedacht hatte, fügte er noch hinzu: „Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern, daß Sie bei uns einen Posten erhalten und bequem Marseille erreichen. Dort können Sie weitere Entscheidungen treffen.“
Nach dieser Zusicherung entschloß ich mich, meinen Weg als Reisender mit dem Sklaventransport fortzusetzen. Noch am selben Tag trat ich die Stelle an, die mir versprochen worden war. Gleich einem gütigen Hausvater versucht der König, wenn er die Vergehen seiner Untertanen bestrafen muß, die Züchtigungen zu mildern, welche er in seiner väterlichen Güte gegen seine ungehorsamen Kinder verfügen mußte. Durch die Art und Weise, wie er seine Verordnungen vollziehen läßt, nimmt er ihnen schon einen großen Teil ihrer Strenge. Dies hat zur Folge, daß er auch für diejenigen, welche die Schärfe der Gesetze zum Ruder verdammt hat, auf der Straße eine menschenwürdige Versorgung getroffen hat. Diese Aufgabe ist aber sehr oft Leuten an vertraut worden, welche keineswegs die Absichten des Fürsten erfüllten. Deshalb müssen diese armen Unglücklichen die allernotwendigsten Dinge des Lebens entbehren, so daß sie ohne die Hilfe barmherziger Menschen niemals die Last ihrer Ketten ertragen könnten. Da ihnen nicht gestattet wird, selbst die nötigen Lebensmittel herbeizuschaffen, so müssen sie jemanden haben, der ihnen diese Aufgabe abnimmt. Dies war nun meine Aufgabe. Zwölf von ihnen übertrugen mir die Aufgabe, für sie zu sorgen. Ich gab mir große Mühe, die empfangenen Almosen gerecht unter ihnen zu verteilen. Keiner von ihnen hätte dieses Amt besser verrichten können. Als Dank dafür gaben sie mir einen Teil der Almosen und ich lebte als Bruder mit meinen Herren zusammen, die ich bediente.
Mit Heiterkeit verrichtete ich dies beschwerliche Amt, als der Diener des Kommandeurs in Valence krank wurde. Da nun ein Mann mit einem so wichtigen Posten ohne Diener sich nicht helfen kann, warf er sein gnädiges Augenmerk auf mich und beehrte mich mit dem Posten des Kranken.
Ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daß mehr sein eigener Vorteil, als die Beruhigung des Gewissens ihn zu dieser Wahl bewogen hat. Der lächelnde Blick des Glücks änderte nicht im geringsten meine Gesinnung, sondern ich versuchte nach Möglichkeit das Elend meiner ehemaligen Herren zu lindern.
Als wir schließlich Marseille erreichten, wurden die Ruderknechte auf die Galeeren verteilt, nachdem mein Herr über seine Mission Rechenschaft abgelegt hatte. Dieser redliche Mann trug mir dann an, ihm nach Paris zu folgen, wenn er wieder zurückging. Doch ich hielt es nicht für gut, seinen Vorschlag anzunehmen. Ich enthob ihn lieber der Sorge, sein Versprechen zu erfüllen, mir eine Stelle zu suchen, indem ich mich selbst um eine kümmerte.
Eines Tages ging ich am Hafen spazieren. Ich war in tiefes Nachdenken über den unglücklichen Zustand meiner Angelegenheiten versunken, die sich jeden Augenblick noch sichtlich verschlimmerten, als ich einem meiner ehemaligen Schulkameraden begegnete.
„Wie, mein armer . . .!“ rief er mir entgegen, „ist es möglich, daß ich dich in Marseille treffe, dich, von dem man glaubt, daß er sich in Paris im Krankenhaus St. Lazare befindet?“
„Wie du siehst“, erwiderte ich, „bin ich nirgends in Kost und Verwahrung, und selbst meine Verwandten wissen nicht, wo ich bin. Aber du, was machst du hier? Was führt dich in die Provence?“
„Kein anderer Grund“, erwiderte er, „als nach Konstantinopel zu fahren, wo mein Oheim bei unserem Botschafter am Hofe des Sultans die Stelle eines Küchenmeisters innehat. Ich bin wie du ein Flüchtling. Bei der ersten Nachricht, daß mein Oheim diese Stelle bekleiden würde, überkam mich die unwiderstehliche Lust, die stolzen Muselmanen im Mittelpunkt ihres Reiches, im weltberühmten Konstantinopel, zu sehen, das immer ein Denkmal der Schande des christlichen Namens sein wird. Ich unterbreitete diesen Plan meiner Mutter. Sie segnete sich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes, als sie nur den Namen Türke hörte und versuchte mich von diesem Vorhaben abzubringen. Ich bin glücklich entwischt und habe meinen Oheim getroffen, dem ich mein brennendes Verlangen nach dieser Reise so einleuchtend zu schildern wußte, daß er mir endlich erlaubt hat, ihm zu folgen. Heute Nacht vertrauen wir dem türkischen Meer unser Leben und unser Glück an.“
„O glücklicher, allzu glücklicher Dumont!“ rief ich, von innerer Traurigkeit gemartert. „Das unerbittliche Schicksal hat deinen Gefährten nicht mit soviel Güte geleitet. Du siehst einen Unglücklichen vor dir, der nicht weiß, wie er ein Obdach finden soll und der unvermeidlichen Gefahr ausgesetzt ist, Hungers zu sterben, zweihundert Meilen von seiner Heimat entfernt.“
Nach diesen Worten schloß mich mein großmütiger Freund in seine Arme und schlug mir vor, mit ihm nach Konstantinopel zu gehen.
„Ich will versuchen“, sagte er zu mir, „meinen Oheim zu überreden, daß er dich mitnimmt. Sicherlich wird er einen Küchenjungen brauchen. Hast du Mut genug, fürs erste so eine Stelle anzunehmen?“
„Ach, mein Freund!“ rief ich aus. „Du hast mein Interesse geweckt! Ja, bester Dumont, wir wollen uns auf die Reise machen! Wir wollen dem Gott des Meeres ein großes Opfer bringen und ihn günstig stimmen, damit er uns in dem ersehnten Hafen wohlbehalten einlaufen läßt, wo die Töpfe seiner Exzellenz vor Anker liegen.“
Dumont führte mich zu seinem Oheim, der mich zunächst nicht freundlich empfing. Ich kann ihm dies nicht übel nehmen, weil mein Aufzug nicht zu meinen Gunsten sprach. Man mußte schon genau hinsehen, wenn man erkennen wollte, daß die schmutzigen Lumpen und die stinkende Wäsche, die ich auf dem Leibe trug, ehemals die Bestandteile eines Hemdes gewesen waren, das ich von Paris mitgenommen hatte. Die übrigen Kleidungsstücke ließen diesen Schatten von einem Hemd nicht weit hinter sich. Glücklicherweise gehörte Herr Dumont, der Oheim, zu diesen gutherzigen Geschöpfen, die blindlings alles glauben, wenn sie einmal von jemandem eingenommen sind, was ihnen gesagt wird. Dies war hier der Fall bei meinem Freund, der viel bei ihm erreichte. Es dauerte nicht lange, so hatte er ihn schon so weit gebracht, einzugestehen, daß bei mir trotz der zerlumpten Kleidung ein gewisses Etwas von guter Erziehung hervorsteche. Es kostete ihn nicht viel Mühe, mir einen Platz auf einem Schiff zu beschaffen, das uns nach Pera brachte.
Ein Schriftsteller, der weniger die Wahrheit liebt, würde sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auf Kosten der Wahrheit seine schöpferische Einbildungskraft bei der Beschreibung eines tobenden Sturmes zur Schau zu stellen. Da wir aber Gott sei Dank ein solches Unglück nicht erlebten, halte ich es nicht für redlich, den Leser mit einer langweiligen Beschreibung zu ermüden. Denn trotz der krachenden Donnerschläge und der schlängelnden Blitze, welche dem Gemälde das nötige Licht und Schatten geben würden, müßte es ihm eiskalt über den Rücken laufen. Mit der gleichen Fürsorge will ich ihm die Mühen der Fahrt nach Malta und um den Peloponnes ersparen, damit er geschwind die Dardanellen passiert und zu seiner größten Zufriedenheit ohne irgendeinen Zwischenfall in Pera an Land geht.
Welch ein majestätischer Anblick ist es, Konstantinopel von Pera aus vor sich liegen zu sehen. Die hohen Zypressen und andere Bäume, die verschiedenen Farben der Häuser, die bemalten und vergoldeten Türme der Moscheen, der Anblick des Serail und der im Kanal liegenden Schiffe stellen ein so vortreffliches Bild dar, wie es der menschliche Verstand nur in den Werken der Dichter schaffen kann.
Ich kam in Konstantinopel im Jahre 1714 an. Ohne daß ich Seiner Exzellenz vorgestellt wurde, wurde ich aufgenommen, da seine ausdrückliche Genehmigung bei der Aufnahme eines Dieners meiner Gattung überflüssig war. So niedrig und unbedeutend nun mein damaliger Stand war, so konnte ich mich doch durch einen Umstand auszeichnen, der mir nie in den Sinn gekommen wäre. Er war die Ursache meines späteren glücklichen und unglücklichen Schicksals.
Wir hatten in Paris einen Mann zum Nachbar, welcher die Flöte meisterhaft spielte. Sämtliche Kanarienvögel aus der ganzen Gegend bewiesen täglich durch ihren Gesang, wie geschickt ihr Meister war. Mein Großvater bekam Lust, einen solchen gefiederten Sänger zu besitzen. Weil aber so abgerichtete Vögel ziemlich teuer waren, entschloß er sich, um seinen wirtschaftlichen Grundsätzen treu zu bleiben, mich die Kunst, Vögel auf diese Weise abzurichten, lernen zu lassen. Den Vogel, den er kaufen wollte, sollte ich diesen Gesang lehren.
Auf diese Weise schlug der gute Mann, wie man im Sprichwort zu sagen pflegt, mit einer Klappe zwei Fliegen, indem er seinen Ohren ein angenehmes Vergnügen verschaffte und meine Talente weiter ausbildete. Durch den Unterricht bei meinem Nachbar machte ich solche Fortschritte, daß ich in kurzer Zeit imstande war, einen Kanarienvogel abzurichten, den man gekauft hatte und bei dem ich zuerst meine Kunst beweisen sollte.
Ich kann wohl sagen, daß dieses Instrument fast bei allen Herren, bei denen ich als Sklave diente, der Grund meines Glücks wurde, aber auch die Ursache dafür, daß ich oft dem Tode nahe war, dem ich Gott sei Dank immer wieder entging.
Als ich eines Abends meinen Dienst in der Küche beendet hatte, ging ich auf die Terrasse des königlichen Palastes, um frische Luft zu schöpfen. Ich ging spazieren und spielte verschiedene Lieder auf meiner Flöte, welche ich von Paris mitgenommen und wegen ihres geringen Wertes vor der Gier der Wächter gerettet hatte.
Der Gesandte, welcher mich hörte, erkundigte sich, wer ich sei. Als man ihm dies gesagt hatte, ließ er mich zu sich rufen. Er stellte mir verschiedene Fragen bezüglich meiner Familie und wollte den Grund wissen, welcher mich von meinem Vaterland in eine so entfernte Gegend Europas verschlagen hatte.
Ganz freimütig erzählte ich ihm meine Geschichte und zog schon günstige Schlußfolgerungen aus der Aufmerksamkeit, mit welcher er mich anhörte. Doch plötzlich sagte er in ernsthaftem Ton, daß ich ein Mensch sei, der Hang zu einem liederlichen Leben zeige. Er werde sich deshalb darum kümmern, daß ich zu meinen Verwandten zurückgeschickt würde, die meinetwegen in großer Sorge sein müßten. Sogleich gab er den Befehl, ein wachsames Auge auf mich zu haben, bis sich eine Gelegenheit bieten würde, mich sicher nach Frankreich zurückbringen zu lassen.
Unter allen Schlägen des Unglücks, die mich bisher getroffen hatten,, schien mir dieser der heftigste zu sein. Umsonst warf ich mich ihm zu Füßen, umsonst suchte ich durch Bitten und Tränen sein Mitleid zu wecken. Die übrigen Diener, die seinen ihm angeborenen sanften.Charakter kannten, konnten sich über die Härte, mit der er zu Werke ging und die ich nicht verdient zu haben schien, nicht genug wundern.
Um sein Vorgehen zu rechtfertigen, erläuterte er seinen Leuten die Ursache seiner Strenge gegen mich.
„Dieser junge Mann“, sagte er, „ist hier großen Gefahren ausgesetzt, was seine Religion und Unschuld anbelangt. Die Türken, die jeden bekehren wollen, würden nichts unversucht lassen, um ihn in den Abgrund zu stürzen, den sein jungendlicher Eifer für einen mit Rosen bestreuten Weg ansehen würde. Er wird es mir in der Zukunft danken, ihn dieser Verführung entrissen zu haben.“
Ich sah die guten Absichten des Gesandten nicht ein und war folglich äußerst gegen ihn aufgebracht. In Stunden, wo ich ganz allein war, äußerte ich mich über seine Exzellenz in Ausdrücken, die mir durch meinen Umgang und die Reise mit den Sträflingen schon zur Gewohnheit geworden waren.
Um die Mittagszeit brachte man mir gewöhnlich mein Essen, welches der junge Dumont für mich besorgte. Dieser treue Freund riet mir zur Flucht und traf alle Vorbereitungen dafür so gut, daß ich drei Tage nach meinem Arrest wieder in Freiheit war. Mein Befreier riet mir ab, in Pera zu bleiben. Der Weg nach Konstantinopel war mir bekannt, da ich einige Male dort gewesen war. Doch ich konnte den Kanal nur mit einem Schiff passieren. Ich hielt es daher für das beste, durch Galata zu gehen und mied den Hafen, indem ich meinen Weg über die Kirchhöfe nahm, die zwischen diesem Ort und Pera liegen. Mit Einbruch der Nacht kam ich glücklich in Konstantinopel an. Meine erste Sorge war darauf gerichtet, einen Aufenthaltsort ausfindig zu machen, wo ich vor Verfolgungen und Nachforschungen des Gesandten sicher war. Ein Jude, der mein unruhiges Wesen und die Unentschlossenheit , mit der ich bald hier, bald dorthin lief, bemerkt hatte, fragte mich, ob ich frei oder ein Sklave sei. Meine sorgenvolle Miene ließen ihn mehr als meine Antwort erraten, daß ich einen Zufluchtsort suchte, den er mir auch anbot. Er hielt mich nämlich für einen flüchtigen Sklaven, der sich vermutlich seinem Herrn entziehen wollte.
Meine Mutmaßungen waren nicht unbegründet, denn seine Handlungen bewiesen mir in der Folge, daß meine Schlußfolgerungen richtig waren. Er hielt mich einige Tage in seinem Haus versteckt, wo ich Gelegenheit hatte, ihm meine Geschichte zu erzählen. Dieser Bösewicht versuchte in mir die Angst zu wecken, die ich vor einem so einflußreichen Mann wie dem Gesandten haben müßte, und dies veranlaßte mich, mich für einen Ausweg zu entscheiden, welchen er mir zur Erhaltung meiner Freiheit vorschlug. Ich sollte bei dem Kapitän Jussuf Pascha meine Zuflucht suchen!
„Dort“, sagte er zu mir, „werden Sie völlig sicher sein, und selbst wenn der Gesandte Ihren Aufenthaltsort erfahren sollte, so darf er es nicht wagen, sich an Ihrer Person zu vergreifen.“
Ich billigte den Vorschlag, dessen Ausführung auf den nächsten Tag verschoben wurde, weil in dieser Zeit der Kommandeur der Eunuchen des Kapitäns gewonnen werden mußte. Denn nur durch seine Vermittlung könnte ich in den Harem seines Herrn auf genommen werden.
Der verräterische Jude holte mich ab, wie er versprochen hatte. Bei Einbruch der Nacht führte er mich auf geheimnisvolle Weise zu dem Kommandeur der Eunuchen. Dieser schien mit meinem Äußeren sehr zufrieden, und nachdem er sich eine Weile mit dem treulosen Juden in einer Sprache unterhalten hatte, die ich nicht verstand, verabschiedeten sie sich.
Ich ward sogleich in eine Art von gewölbtem Saal gebracht, wo sich ungefähr zwanzig Personen befanden, die mich alle in verschiedenen Sprachen willkommen hießen. Vor allem machte mich ein Franzose, der sogleich an der Kleidung seinen Landsmann erkannte, durch seine feurigen Umarmungen, Tränen und Klagen auf meine Gefangenschaft aufmerksam.
„Ich bin nicht ein Sklave, ich bin freiwillig hier“, antwortete ich ihm und erzählte allen Männern, die um mich herumstanden, wie ich an diesen Ort gekommen war. Alle bedauerten meine Leichtgläubigkeit. Der Franzose steigerte meine Verzweiflung bis ins Unermeßliche, als er mir begreiflich zu machen versuchte, daß ich von dem Juden hintergangen worden war. Zwischen Furcht und Hoffnung verbrachte ich die Nacht.
Mein Unglück bestätigte sich am folgenden Morgen, als man mir das Sklavenkleid brachte. Man zwang mich mit Stockschlägen es anzuziehen, weil ich nicht freiwillig dazu bereit war. Jetzt sah ich das ganze Ausmaß meines Unglückes und verfluchte den Elenden, der mir ein so bedauernswertes Schicksal bereitet hatte. Ich erfuhr endlich von einem anderen Sklaven, daß mich der Jude an den Kapitän als sein Eigentum verkauft hatte. Ich beklagte die Ungerechtigkeit und Grausamkeit, aber dasselbe Mittel, welches mich zwang, die Sklavenkleidung anzuziehen, brachte mich auch hier zum Schweigen. Dies war noch nicht genug. Auf der Stelle mußte ich mit der Arbeit anfangen.