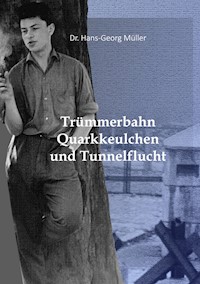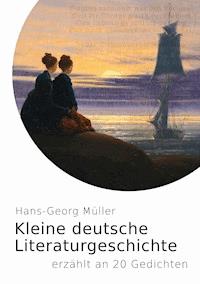
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Literaturgeschichte ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger zufälligen Ereignissen. Es ist eine wirkliche, echte Geschichte und wer sie kennt, der kann sie nur lieben. Sie reicht weit zurück ins Mittelalter. Sie führt vorbei an Kunstwerken von unfassbarer Eleganz und von berauschender Kühnheit. Sie erzählt von Heldentaten und Intrigen - in der Wirklichkeit wie auf dem Papier. Sie ist durchkreuzt von Revolutionen und Erneuerungen - im Geiste wie auf der Barrikade. Sie führt quer durch Kriege und Koalitionen - zwischen Dichtern wie zwischen Völkern. Und dazu ist sie auch noch ungeheuer spannend! Und weil Literatur das Schönste ist, was man mit Sprache anstellen kann, und Lyrik das Schönste, was die Literatur zu bieten hat, deshalb kann man die Geschichte der deutschen Literatur vielleicht präziser, aber niemals schöner erzählen als an einer Auswahl handverlesener Gedichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tom
Inhaltsverzeichnis
Geneigte Leserin, geneigter Leser!
Einführung und Vorgeschichte
Walther von der Vogelweide: Under der Linden (um 1200)
Barock
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau: Vergänglichkeit der Schönheit (vor 1679)
Aufklärung
Magnus Gottfried Lichtwer: Die beraubte Fabel (1762)
Empfindsamkeit
Friedrich Gottlieb Klopstock: Die frühen Gräber (1764)
Sturm und Drang
Johann Wolfgang v. Goethe: Vor Gericht (1776)
Weimarer Klassik
Friedrich Schiller: Der Handschuh (1797)
Romantik
Novalis: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren (1800)
Biedermeier
Eduard Mörike: Er ist's (1829)
Junges Deutschland/Vormärz
Heinrich Heine: Die schlesischen Weber (1844)
Realismus
Theodor Storm: Die Stadt (1851)
Naturalismus
Karl Henckell: Das bejahrte Freudenmädchen (1888)
Jahrhundertwende
Stefan George: Komm in den totgesagten park (1897)
Expressionismus
Georg Heym: Der Gott der Stadt (1910)
Neue Sachlichkeit
Erich Kästner: Jahrgang 1899 (1928)
Nationalsozialismus
Herbert Böhme: Der Führer (1934)
Exilliteratur
Bertolt Brecht: Schlechte Zeit für Lyrik (1939)
Nachkriegsliteratur
Paul Celan: Todesfuge (1945/48)
Literatur der Bundesrepublik
Rose Ausländer: Blinder Sommer (1965)
Literatur der DDR
Peter Huchel: Der Garten des Theophrast (1962)
Postmoderne Gegenwart
Ann Cotten: Aporetisch wie nix (2007)
Fachwortregister
Zeitstrahl der deutschen Literaturgeschichte
Geneigte Leserin, geneigter Leser!
Sie warten auf die Post der weißen Taube
aus einem fremden Sommer in der Welt.
Wer diese beiden Verse aus Rose Ausländers Gedicht Blinder Sommer (1965, Kap. 18) liest, ohne ihre Geschichte zu kennen, kann wohl ihren Inhalt verstehen, aber niemals ihre volle Bedeutung ermessen. Er wird aus den Begriffen Post und Taube unschwer das Bild der Brieftaube rekonstruieren können, die hier aus einem fremden Sommer erwartet wird. Wenn er angesichts der weißen Farbe der kleinen Postbotin außerdem das Symbol der Friedenstaube erkennt, wird er sich leicht zusammenreimen können, auf was für eine Art von Nachricht die Menschen hier offenbar warten. Aber nur wer zusätzlich die Hintergründe dieser schlichten Zeilen kennt, wird begreifen können, welche unerhörte und resignierte Traurigkeit in ihnen steckt – und welch nagendes Misstrauen.
Die tiefe Traurigkeit der Verse liegt in ihrem Bezug auf die Gegenwart des Jahres 1965, denn auf Frieden wartete zur Entstehungszeit des Gedichtes buchstäblich die ganze Welt. Und wie die Autorin selbst wartete die Welt zwar schmerzhaft sehnsüchtig, aber ohne große Hoffnung. Zu verfeindet, zu verhärtet, zu verfahren standen sich die Supermächte des Kalten Krieges gegenüber; bereit, den Gegner jederzeit durch einen Atomschlag auszulöschen, und abgehalten von einer solchen Tat nur durch das Wissen, dass sie auch unweigerlich das eigene Ende bedeutet hätte.
Das nagende Misstrauen der Verse steckt in ihrer Sprache, die im Lichte einer solch immensen Bedrohung doch eher nüchtern und karg wirkt. Aber Rose Ausländer verweigert sich der Versuchung, an die große und gefühlsreiche Sprachtradition eines Goethe, eines Heine oder eines Fontane anzuknüpfen. Denn deren Sprache hatte man keine 30 Jahre zuvor dazu missbraucht, im Namen der edelsten menschlichen Regungen eine ganze Nation zum größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte aufzuhetzen. Im Nationalsozialismus waren Glaube, Hoffnung und Treue so oft mit den sprachmächtigen Bildern der deutschen Dichtkunst beschworen worden, dass die Autoren nach 1945 einen tiefen Argwohn gegen jedweden gefühlsschwangeren Sprachgebrauch hegten. Die erhabene alte deutsche Literatursprache hatte durch den nationalsozialistischen Missbrauch einen fauligen Beigeschmack bekommen, von dem sie sich erst sehr langsam erholte.
Die Geschichte dieser beiden Verse ist lang. Sie reicht bis weit ins Mittelalter zurück. Sie führt vorbei an Kunstwerken von unfassbarer Eleganz und von berauschender Kühnheit. Sie erzählt von Heldentaten – in der Wirklichkeit wie auf dem Papier. Sie ist durchkreuzt von Revolutionen – im Geiste wie auf der Barrikade. Und sie führt durch Kriege – zwischen Dichtern wie zwischen Völkern. Dazu ist sie auch noch ungeheuer spannend.
Und genau diese Geschichte möchte ich dir jetzt erzählen.
Gestatte, dass ich mich zuvor kurz vorstelle. Ich bin der Erzähler diese kleine Abhandlung und dein Begleiter auf den folgenden Seiten. Verwechsle mich bitte nicht mit dem Autor, dessen Name draußen auf der Titelseite steht. Er hat mich erfunden, damit ich dir die Geschichte der deutschen Literatur erzähle. Er selbst hätte sich das nie gewagt, denn in den Texten, die er sonst schreibt, bemüht er sich betont um wissenschaftliche Nüchternheit und sachliche Neutralität. Ich aber will dir keinen Vortrag halten, sondern eine Geschichte erzählen. Und wie Geschichten nun einmal sind, zeichnen sie immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit und scheuen sich dabei nicht, eine bestimmte Position einzunehmen und eine eigene Meinung zu haben. Eine Meinung, neben der es viele andere Meinungen geben kann und soll.
Fakt ist nämlich: Die deutsche Literaturgeschichte ist verworren und verzweigt. Die allerwenigsten Dichter haben sich als Teil einer bestimmten Entwicklung begriffen. Manche haben sich sogar aktiv gewehrt, zu einer Epoche gezählt zu werden. Die allermeisten haben nach eigener Ansicht einen ganz individuellen Stil gepflegt, der sich außerdem noch im Laufe ihres Lebens verändert hat und nur in manchen Werken wirklich in Reinform zu einer bestimmten Stilrichtung gezählt werden kann.
Auf der anderen Seite ist es immer wieder erstaunlich, wie klar sich in der Rückschau bestimmte historische Entwicklungen erkennen lassen, und zwar nicht nur in der Literatur- oder Kunstgeschichte, sondern in der gesamten Geisteshaltung der Menschen: In dem, was sie liebten und verabscheuten; in dem, was sie ersehnten und wovor sie Angst hatten; in dem, was sie für selbstverständlich erachteten und was ihnen erstaunlich erschien. Sieh dir beispielsweise das übernächste Kapitel zum Barock an – dort werde ich dir von einer solchen Geisteshaltung erzählen, die in Kunst, Literatur und Musik, ja sogar in Politik und Philosophie ganz ähnliche Eigenschaften gezeigt hat.
Die Vorstellung, dass die (Literatur-)Geschichte in verschiedene Epochen zerfällt, ist immer eine Verkürzung und Vereinfachung. Wir können auch sagen: Sie ist ein Modell. Und so wie ein Schiffsmodell kein wirkliches Schiff ist, sondern mit diesem nur bestimmte Ähnlichkeiten teilt, versucht die Literaturgeschichte das Allgemeine und Typische der Entwicklung herauszustellen und verzichtet dafür auf allzu viele Details und individuelle Besonderheiten. Deshalb erkennen wir an den Epochen der Kunst die Ähnlichkeiten zwischen Künstlern, die sie selbst untereinander gar nicht wahrnehmen konnten. Das Modell hilft uns, einen Überblick zu behalten, der uns abhandenkommt, wenn wir uns zu schnell in die Einzelheiten stürzen.
Auch meine Geschichte ist ein Modell, will sagen: eine skizzenhafte Abbildung der literaturhistorischen Entwicklung. Wäre die deutsche Literaturgeschichte ein Schiff, so wäre diese kleine Abhandlung eine Bleistiftzeichnung davon. Aber eine, in der du unweigerlich das Schiff wiedererkennen könntest, wenn es leibhaftig vor dir im Hafen läge.
Um diese Art von Nach-Zeichnung geht es meinem Autor. Deshalb hat er mich erfunden und mich zwischen sich und dich gestellt. Nur deshalb erlaube ich mir auch, dich einfach zu duzen, da es mich ja nur in der Welt dieser Zeilen gibt. Ich möchte dir zu einem Überblick im Wirrwarr der deutschen Literaturgeschichte verhelfen, indem ich dir zwanzig Meilensteine der Dichtung vorstelle und dir erzähle, was es mit ihnen auf sich hat und warum es Meilensteine (geworden) sind. Die meisten Gedichte sind außerdem so unerhört schön, dass es sich allemal lohnt, sie einmal ganz genau zu betrachten.
Nach dem Lesen – das ist der didaktische Anspruch1 meines Autors – wirst du nicht nur einen Strauß wunderbarer Gedichte kennen, sondern auch zu jeder Kunstepoche ein bestimmtes Bild vor Augen haben – eben ein Modell. Wenn du im Anschluss weitere Literatur kennen lernst oder eine der großen Literaturgeschichten aufschlägst, wirst du feststellen, dass es zu jedem Thema noch viel mehr zu sagen gegeben hätte. Aber das Modell wird dir helfen, den Überblick zu behalten. Wenn ich das erreiche, ist mein Autor zufrieden mit mir.
Vielleicht fragst du dich jetzt nur noch, wieso ich dir die Epochen der deutschen Literatur nun ausgerechnet an Gedichten erklären möchte. Falls ja, dann findest du die Antwort gleich im folgenden Kapitel.
1 Die Didaktik ist die Wissenschaft vom Unterricht und tatsächlich ist diese Literaturgeschichte als ein kleines didaktisches Experiment angelegt. Kurz gesagt sucht sie die These zu belegen, dass sich ein betont induktiver Ansatz unterbewusster Verwendung literarischer Mittel signifikant positiv auf die Lern- und Behaltensleistung auswirkt. Wenn du mehr wissen willst, frag lieber meinen Autor selbst.
1. Einführung und Vorgeschichte
Walther von der Vogelweide Under der Linden (um 1200)
Wo soll man mit der Darstellung der deutschen Literaturgeschichte beginnen? Schon von Tacitus (um 100 n. Chr.) wissen wir, dass die Germanen ihre eigenen Mythen, Geschichten und Gesänge hatten, aber wenig davon ist überliefert. Außerdem: Können wir diese germanische Tradition überhaupt als „deutsche“ Literatur bezeichnen? Eher nicht. Sie ist eine Wurzel, aber nicht der Stamm.
Unter den ältesten Dokumenten, die von der Sprachwissenschaft als (Althoch-)Deutsch bezeichnet werden, findet sich ziemlich viel erzählende Literatur, zum Beispiel Heldenepen wie das Hildebrandlied und volksreligiöse Texte wie die Merseburger Zaubersprüche. Aber ohne spezialisierte Sprach- und Geschichtskenntnisse sind sie kaum zu genießen – ja eigentlich kaum als Deutsch zu erkennen.
Mit dem Minnesang im Hochmittelalter, so um das Jahr 1200, ändert sich das. Die deutschsprachige Literatur erlebte hier eine Blütephase, die noch Jahrhunderte später Auswirkungen zeigen und Bewunderer anziehen sollte. Doch das ist nicht der Grund, warum ich mit einem Gedicht des berühmtesten deutschen Minnelyrikers, Walther von der Vogelweide, beginnen möchte. Der eigentliche Grund liegt darin, dass man an dem folgenden Werk wie an kaum einem anderen entdecken kann, was Gedichte eigentlich sind und warum man an ihnen so großartig die Geschichte der deutschen Literatur nachzeichnen kann.
Die Sprache Walthers ist mittelhochdeutsch und wirkt damit fremd und schwer verständlich. Aber wenn man sich etwas einliest, versteht man sie doch ganz gut. Ich habe dir neben die Zeilen kleine Übersetzungshilfen gesetzt, aber versuch es ruhig auch mal mit dem Mittelhochdeutschen:
Walther von der Vogelweide Under der Linden (um 1200)
Under der linden
Unter der Linde
an der heide,
an der Heide,
dâ unser zweier bette was,
wo unser beider Bett war,
dâ muget ir vinden
da könnt ihr finden
schône beide
schön beides:
gebrochen bluomen unde gras.
gebrochene Blumen und Gras.
Vor dem walde in einem tal,
Vor dem Wald in einem Tal,
tandaradei,
-?-
schône sanc diu nahtegal.
schön sang die Nachtigall.
Ich kam gegangen
Ich kam gegangen
zuo der ouwe,
zu der Aue,
dô was mîn friedel komen ê.
wo mein Freund bereits war.
Dâ wart ich enpfangen,
Da wurde ich empfangen (wie eine)
hêre frouwe,
Hohe Frau,
daz ich bin sælic iemer mê.
sodass ich selig war immer mehr.
Kuster mich? Wol tûsentstunt:
Küsste er mich? Wohl tausendmal:
tandaradei,
(s.o.)
seht, wie rôt mir ist der munt.
Seht, wie rot mir der Mund ist.
Dô het er gemachet alsô rîche von bluomen eine bettestat. Des wirt noch gelachet inneclîche, kumt iemen an daz selbe pfat. Bî den rôsen er wol mac, tandaradei, merken, wâ mirz houbet lac.
Da hatte er gemacht so reich von Blumen eine Bettstatt. Darüber wird noch lachen inniglich
,
jemand an denselben Pfad kommt. An den Rosen kann er wohl, (s.o.) erkennen, wo mir das Haupt lag.
Daz er bî mir læge, wessez iemen (nû enwelle got!), sô schamt ich mich. Wes er mit mir pflæge, niemer niemen bevinde daz, wan er und ich, und ein kleinez vogellîn tandaradei, daz mac wol getriuwe sîn.
Dass er bei mir gelegen hat, wüsste es jemand (Das wolle Gott nicht!), so schämte ich mich. Was er mit mir getan hat, niemals niemand herausfinden, als er und ich, und ein kleines Vögelchen (s. o.) das wird wohl verschwiegen sein.
Das Gedicht erzählt von intimen, ja von intimsten Erlebnissen eines Paares in der freien Natur. Es ist in scheinbar einfache, in Wirklichkeit aber höchst kunstvoll gesetzte Worte gefasst. Da die Person, die hier Ich sagt (z. B. V. 10) offenbar eine junge Frau ist, können wir sie nicht mit dem Dichter Walther von der Vogelweide gleichsetzen. Vielmehr lässt der Autor eine erfundene Sprecherin, ein lyrisches Ich auftreten, um die Ereignisse zu schildern – ganz so, wie der Autor dieses Buches mich, den Erzähler, erfunden hat, damit ich dir von der Literaturgeschichte erzähle.
Die Handlung des Gedichtes ist höchst delikat und es zeugt von der hohen Kunstfertigkeit des Dichters, mit welch zarten Worten und sanften Andeutungen er uns die erotische Situation nahebringt.
Under der linden
Unter der Linde
an der heide,
an der Heide,
dâ unser zweier bette was,
wo unser beider Bett war,
dâ muget ir vinden
da könnt ihr finden
schône beide
schön beides:
gebrochen bluomen unde gras.
gebrochene Blumen und Gras.
Vor dem walde in einem tal,
Vor dem Wald in einem Tal,
tandaradei,
-?-
schône sanc diu nahtegal.
schön sang die Nachtigall.
In Strophe 1 wird von einem Ort under der linden an der heide (V. 1 f) berichtet, an dem ein bette (V. 2) gewesen sei. Dieses Schlüsselwort sowie die Tatsache, dass es unser zweier bette, also die Schlafstatt eines Paares, gewesen ist, bleiben die einzigen vorsichtigen Hinweise auf eine Liebesbeziehung. Oder doch nicht ganz, denn wer an diesen Ort kommt, wird gebrochen bluomen unde gras (V. 6) finden, was nicht gerade nach einem gewöhnlichen Schlaflager klingt. Auch die Ortsbeschreibung ist ganz bewusst eine Landschaft der Liebe: die Linde (V. 1) mit ihren herzförmigen Blättern, die Heide (V. 2) mit ihrem Honigduft, der einsame Wald, der ein Tal (V. 7) umschließt, und schließlich die Nachtigall, die nächtliche Ariensängerin schlechthin (V. 9) – all das sind höchst kunstvoll gewählte Charakteristika eines idealisierten Schauplatzes der Liebe.
Wie harmonisch durchkomponiert diese Landschaft ist, erkennt man am besten, wenn man einmal probeweise die Wörter durch andere austauscht: Stell dir vor, der Ort wäre unter einer Eiche gewesen. Oder unter einer Fichte! Oder an einem See. Vielleicht auf einem Berg? Stell dir außerdem vor, es würde nicht die Nachtigall, sondern der Kuckuck rufen – die Stimmung des Ortes wäre eine völlig andere und nicht mehr annähernd so lieblich. Das macht einen entscheidenden Wesenszug der Lyrik aus: Jedes Wort bringt nicht nur seine Bedeutung, sondern auch seine Stimmung mit, aus der ein geschickter Dichter eine besondere Gefühlslage aufbauen kann, die beim Hörer ankommt.
Ich kam gegangen
Ich kam gegangen
zuo der ouwe,
zu der Aue,
dô was mîn friedel komen ê.
wo mein Freund bereits war.
Dâ wart ich enpfangen,
Da wurde ich empfangen (wie eine)
hêre frouwe,
Hohe Frau,
daz ich bin sælic iemer mê.
sodass ich selig war immer mehr.
Kuster mich? Wol tûsentstunt:
Küsste er mich? Wohl tausendmal:
tandaradei,
(s.o.)
seht, wie rôt mir ist der munt.
Seht, wie rot mir der Mund ist.
In Strophe 2 kommt das lyrische Ich an den verabredeten Treffpunkt, die Aue (ouwe, V. 10), wo ihr Geliebter (friedel, V. 12) sie bereits erwartet und sie wie eine hohe Frau (hêre frouwe, V.14), also wie eine Adlige empfängt,2 was sie selig (saelic, V. 15) macht. Die Frage „Küsste er mich?” (kuster mich?, V. 16) muss als rhetorische Frage gemeint sein, denn die Antwort ist geradezu selbstverständlich: Wohl tausendmal (Wol tusentstunt, ebd.), was der noch ganz rot geküsste Mund der lyrischen Ich-Erzählerin beweist (V. 18).
Strophe 2 berichtet also vom zart-intimen Beginn der kleinen Verabredung in der Einsamkeit der Natur. Noch ist das Geschilderte in den Grenzen des Sittlichen (höchstens die Anzahl der Küsse könnte prüde Seelen bereits bedenklich stimmen). Doch schon in der folgenden Strophe 3 werden die Andeutungen intimer und knisternder:
Dô het er gemachet
Da hatte er gemacht
alsô rîche
so reich
von bluomen eine bettestat.
von Blumen eine Bettstatt.
Des wirt noch gelachet
Darüber wird noch lachen
inneclîche,
inniglich,
kumt iemen an daz selbe pfat.
jemand an denselben Pfad kommt.
Bî den rôsen er wol mac,
An den Rosen kann er wohl,
tandaradei,
(s.o.)
merken, wâ mirz houbet lac.
erkennen, wo mir das Haupt lag.
Wir erfahren, dass die gebrochen bluomen aus Strophe 1 vom Geliebten zu einer Art Liebesnest arrangiert worden sind (von bluomen eine bettestat, V. 21), was für die Zeitgenossen offenbar ein so deutliches Zeichen für den erotischen Zweck des Lagers war, dass jeder Wanderer, der den selben pfat (V. 24) nimmt, darüber inniglich lachen wird (V. 22 f). Beachte, mit welchen zarten Andeutungen Walther von der Vogelweide hier deutlich macht, dass der Zweck des Blumenbettes eindeutig zu erkennen ist, ohne dabei sprachlich derb oder anzüglich werden zu müssen. Lediglich ein Verweis auf die rosen (V. 25), an denen man sehen könne, wo mein Kopf lag, (wâ mirz houbet lac, V. 27), geben einen vorsichtigen Hinweis darauf, dass das Blumenbett nicht ungenutzt geblieben ist…
Dafür spricht schließlich auch Strophe 4, die das Gedicht mit einem kleinen Paradoxon (einem Widerspruch in sich) abschließt.
Daz er bî mir læge,
Dass er bei mir gelegen hat,
wessez iemen
wüsste es jemand
(nû enwelle got!),
(Das wolle Gott nicht!),
sô schamt ich mich.
so schämte ich mich.
Wes er mit mir pflæge,
Was er mit mir getan hat,
niemer niemen
niemals niemand
bevinde daz, wan er und ich,
herausfinden, als er und ich,
und ein kleinez vogellîn
und ein kleines Vögelchen
tandaradei,
(s. o.)
daz mac wol getriuwe sîn.
das wird wohl verschwiegen sein.
Das lyrische Ich berichtet uns freimütig, dass um Gottes Willen niemand außer er und ich (V. 34) wissen dürfe, dass er bei mir lag ([d]az er bî mir læge, V. 28) und was er mit mir tat ([w]es er mit mir pflæge, V. 31), denn sonst hätte es allen Grund, sich zu schämen (sô schamt ich mich, V. 31). Wir erfahren damit nicht nur, dass es offenbar tatsächlich zu sehr privaten Intimitäten zwischen den Liebenden gekommen ist, sondern paradoxerweise auch, dass wir genau das nicht erfahren dürfen!
Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Für diese Frage müssen wir uns deutlich machen, was ein Gedicht eigentlich ist: Wie keine andere Kunstgattung ist die Dichtkunst (Lyrik), der Ausdruck eines persönlichen (subjektiven) Empfindens. Das lyrische Ich ist ja ein Wesen, das in keiner anderen Welt als in der Welt des Gedichtes existiert – einer Welt, die ausschließlich aus Sprache besteht und in der alles – wirklich alles! – möglich ist, was überhaupt sprachlich ausgedrückt werden kann!
Im Gedicht akzeptieren wir Situationen, Szenen und Bilder, mit denen wir in anderen Literaturgattungen Probleme hätten. Denk nur an das kleine vogellîn (Vögelchen, V. 36), das vom lyrischen Ich in den letzten beiden Zeilen unseres Gedichtes als (hoffentlich verschwiegener) Zeuge der Liebesbeziehung genannt wird – ganz so, als könnte er wirklich das Geheimnis ausplaudern. Einen sprechenden Vogel akzeptieren wir in einem Gedicht viel eher als etwa in einem Roman. Selbst im Märchen können Vögel nicht einfach so sprechen, sondern nur, wenn irgendwie Magie am Werk ist. Im Gedicht hingegen wundert es uns überhaupt nicht, dass das lyrische Ich auf die Verschwiegenheit des gefiederten Zeugen hofft, obwohl wir das vogellîn deshalb nicht zwangsläufig für verzaubert halten.
In der Lyrik akzeptieren wir auch Wortneuschöpfungen, selbst wenn diese noch nicht einmal eine Bedeutung haben: Viermal – nämlich in jeder vorletzten Zeile der Strophen – lesen wir das Wort tandaradei, das keinen Inhalt hat, sondern ausschließlich aus Klang besteht. In welcher anderen Textart wäre das so unproblematisch? In Romanen, Novellen oder Dramen findest du schwerlich ein Wort ohne Bedeutung – warum auch? Aber das Wort „Lyrik“ kommt von der „Lyra“, einer antiken Harfe, und aus dieser Tradition erklärt sich die Nähe von Gedicht und Gesang. Das Wort tandaradei dient deshalb nicht der Handlung, sondern ausschließlich dem Klang des Werkes.
In Gedichten geschieht es sogar mitunter, dass die Regeln der Grammatik über den Haufen geworfen werden, ohne dass wir den Verfasser deshalb für unzurechnungsfähig halten (Beispiele dafür werden wir in den folgenden Kapiteln immer wieder finden). Und weil der Autor im Gedicht eine eigene Welt erschafft, in der nur seine eigenen Gesetze herrschen, kann das lyrische Ich uns auch sorglos über seine intimsten Geheimnisse erzählen. Wir, die wir davon wissen, sind nicht von seiner Welt und kommen als Verräter des Geheimnisses nicht infrage.
Übrigens bedeutet „eigene Gesetze des Gedichtes“ keineswegs Gesetzlosigkeit – im Gegenteil! Viele Gedichte folgen sehr strengen Gesetzen – ganz besonders häufig in ihrem Rhythmus, in der Anzahl, Betonung und Abfolge der Silben, in der Anzahl der Verse und Strophen, im Klang der Worte und auch in ihrer Bedeutung. Auf diese Punkte werden wir im folgenden Kapitel eingehen, wenn wir einen besonders strengen Vertreter der lyrischen Gattung kennen lernen werden (das Barock liebte nämlich strenge Kunstregeln).
Auch unser Gedicht folgt verschiedenen Gesetzen. Eines davon haben wir schon am Anfang bei der Darstellung der Landschaft entdeckt, die wie ein idyllisches Gemälde durchkomponiert ist. Ein weiteres Gesetz ist das der zart-andeutenden Sprache, die niemals grob oder überdeutlich wird. Würde sie zu derb, wäre ein Gesetz verletzt und wir als die Leser würden das merken: Stell dir vor, der Geliebte würde in Ritterrüstung unter der Linde erscheinen – warum nicht in einem mittelalterlichen Gedicht, schließlich wurde es sicher oft vor Rittern und Edelfrauen vorgetragen! Darum nicht: Weil die Härte und Kälte von Eisen und der kriegerische Charakter einer Rüstung in unserem Gedicht nichts zu suchen haben. Die künstlerische Freiheit geht so weit, dass der Dichter jedes Gesetz erfinden oder außer Kraft setzen darf. Aber wenn er sich einmal entschieden hat, muss er sich selbst an seine Gesetze halten, sonst leidet sein Werk.
Ein drittes Gesetz in unserem Gedicht ist das des Klanges, mit dem die Sanftheit des Inhalts noch unterstützt wird. Walther verzichtet auf Wörter mit vielen oder mit harten Konsonanten und wählt weiche und vokalreiche Klänge: linde, heide, bluomen, walde, rosen, um nur einige Substantive zu nennen (bei den Verben und Adjektiven ist es ähnlich). Die klangliche Anmut gipfelt schließlich in jeder Strophe in der Lautmalerei tandaradei – stell dir vor, Walther hätte Tschingderassabum gewählt…
Rhythmisch folgt das Gedicht Under der linden eher freien Gesetzen. Es hat eine regelmäßige Anzahl betonter Silben in jeder Strophe, aber dazwischen manchmal eine, manchmal zwei unbetonte Silben (genauer werden wir uns solche Fragen in späteren Gedichten ansehen). Das führt zu einer leichten und wiegenden Singbarkeit des ganzen Werkes, die du gut nachvollziehen kannst, wenn du dir mal eine der vielen Vertonungen anhörst, die man leicht im Internet findet. Walther von der Vogelweide hat sein Gedicht sehr wahrscheinlich selbst zur Laute oder zur Harfe gesungen. Man braucht ein wenig Eingewöhnungszeit, um die eigentümliche Zartheit der mittelhochdeutschen Sprachmelodie lieben zu lernen, aber es hat einen Grund, warum sich noch heute so viele Künstler an der Vertonung von Minnelyrik versuchen.
Fassen wir zusammen: Gedichte sind Kunstwerke, in denen der Autor besonders frei ist, seine ganz eigenen Gesetze walten zu lassen. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb? – ist es keineswegs so, dass die Dichter der Literaturgeschichte diese große Freiheit immer voll ausgeschöpft hätten. Vielmehr haben sie oft und gern Moden und Trends übernommen, die ihnen künstlerisch eingeleuchtet haben. Die wichtigsten und bedeutendsten dieser Trends sprechen wir heute als literarische Epochen an. Sie sind niemals zufällig, sondern immer das Resultat einer Entwicklung.
Viele der berühmtesten und beliebtesten Gedichte der deutschen Literatur zeigen eine bemerkenswerte Mischung aus Neuheit und Eigentümlichkeit einerseits (das macht sie so besonders) und Unterwerfung unter die Trends der Epoche (das macht sie so populär und für die Zwecke dieses Buches so geeignet).
Ist nun Walther von der Vogelweides Under der linden besonders typisch für die mittelalterliche Dichtung? Ja und Nein. Um 1200 sangen viele europäische Dichter von der minne (ein mittelhochdeutscher Ausdruck für die Liebe). Typisch sind auch der sanfte, sangbare Klang und die Zartheit im Umgang mit der geliebten Frau (die wahrscheinlich im krassen Gegensatz zum tatsächlichen Alltagsleben im Mittelalter stand). Typisch ist schließlich die hohe Bedeutung einer meist idyllisch geschilderten Natur, die den Seelenzustand der Handelnden widerspiegelt: Jedes Mal, wenn König Artus mit seinen Rittern ausreitet, ist (zufällig?) gerade Pfingsten.
Anders als bei Walther war Minnelyrik sonst in der Regel an eine höher stehende, adlige Dame gerichtet, die der ritterliche Sänger niemals würde erreichen können und die er deshalb nur umso mehr anschmachten konnte. Dass Walther hier seine eigenen Wege geht und aus der Sicht eines wahrscheinlich nicht-adligen Mädchens schreibt, ist einer der Gründe, warum dieses Gedicht – und nicht die vielen viel typischeren – so unsterblich geworden ist.
Im folgenden Kapitel werden wir ein Gedicht kennen lernen, das typischer für seine Epoche kaum sein könnte. Und wir werden daran genauer begreifen, was Epochen eigentlich sind.
2 Für diese Stelle gibt es auch andere Deutungen, weil der Satzbau hier nicht ganz typisch für das Mittelhochdeutsche ist, aber diese Feinheiten überlassen wir getrost den Literaturwissenschaftlern.
2. Barock
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau Vergänglichkeit der Schönheit (vor 1679)
Wenn es eine Kunstepoche gegeben hat, in der Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit die zentralen Eigenschaften waren, dann ist das wohl das Barock (ca. 1600–1770). Das fängt schon damit an, dass man nicht einmal genau weiß, was das Wort „Barock“ überhaupt bedeutet und wo es herkommt.3 Außerdem zeigt kaum eine Epoche so deutlich und in allen Künsten solche Ähnlichkeiten der Merkmale. Eines dieser gemeinsamen Merkmale war eine große Vorliebe für Kunst – aber nicht so, wie wir das Wort heute verstehen, sondern im Sinne von Können, Künstlichkeit, Kunstfertigkeit oder Handwerkskunst. Wenn du dir im Grünen Gewölbe in Dresden einmal den berühmten Kirschkern betrachtest – den mit den 185 geschnitzten Gesichtern darauf – dann weißt du, was ich meine.
Barock ist Künstlichkeit ins Extrem getrieben: Man hatte in der Mode eine Vorliebe für reich verzierte Kleider mit Brokat, Spitzen und Rüschen, deren Korsette so eng und deren Unterröcke so füllig waren, dass die Damen darin kaum atmen, geschweige denn laufen konnten. Du kennst vielleicht das berühmte Gemälde des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.? Mit dem Mantel könnte der Monarch keine fünf Meter zurücklegen. Man trug aufgetürmte Perücken über den stark gepuderten und geschminkten Gesichtern. Sich zu waschen, war verpönt – bei Hof sprühte man sich stattdessen mit teuren Parfums ein, um den mitunter schauderhaften Körpergeruch zu überdecken (kein Witz!). Die Schlösser mit ihren markanten grünen Kuppeln wurden aus einer schier unendlichen Reihe von Zimmern und Sälen gebildet, alle üppig verziert mit Spiegeln und Deckengemälden, mit prächtigen Stuck-Ornamenten und aufwändig furnierten und polierten Möbeln. Hinter dem Schloss der akkurat geschnittene Park, in dem keine Pflanze wachsen durfte, wie sie wollte: Bäume, Sträucher, Hecken wurden zu kunstvollen geometrischen Figuren gestutzt und in schnurgerader Linie oder eleganten Schwüngen ausgerichtet: Selbst die Natur musste sich der Kunst unterwerfen. Wie stark unterscheidet sich dieser Geschmack von der Idylle aus dem Gedicht Walthers von der Vogelweide! Selbst die Kochkunst spiegelte mit ihren aufwändigen Pasteten und subtilen Süßspeisen diesen Hang zur Künstlichkeit wider.
Die dauerhafteste Wirkung hat das Barock bis heute wohl auf die Musik gehabt, die Schwester der Dichtkunst. Wo immer es festlich wird, sind die feierlichen Werke von Bach und Händel mit dabei: Weihnachtsoratorium, Matthäus-Passion, Feuerwerksmusik – hier ist ein Stück Barock zum Teil unserer eigenen Kultur geworden. Dabei ist die barocke Musik so kunstvoll, dass sie es uns nicht gerade einfach macht, sie zu genießen, denn die Bauprinzipien sind streng und schwer zu durchschauen.
Am besten kann man sich das anhand der Fuge deutlich machen, einer extrem barocken Kompositionsart, der uns in dieser Geschichte wiederbegegnen wird. Stell dir das so vor: Ein Violinist trägt eine beliebige Melodie mit Orchesterbegleitung vor. Während er spielt und die Melodie seines Stückes entwickelt, kommt ein zweiter Violinist und beginnt das gleiche Stück mit der gleichen Melodie – nur 20 Sekunden später. Und siehe da, beide Klänge harmonieren miteinander – oder besser: die Melodie harmoniert mit sich selbst – mit ihrer eigenen Vergangenheit. Aber nicht genug damit: 10 Sekunden später tritt eine Flötistin hinzu und beginnt das Lied zum dritten Mal, diesmal aber in den hohen Lagen des Klangraumes. Und weitere 20 Sekunden später beginnt ein Bass und dann eine Viola und dann noch ein Cello, sodass ein höchst verschlungenes Geflecht aus Stimmen entsteht. Es gibt Fugen, die dieses Spiel mit sieben Stimmen betreiben – kein Wunder, dass man darin die Orientierung verliert, wenn man barocke Musik nicht gewohnt ist. Ein leicht verständliches Beispiel für eine Fuge ist das Presto aus Bachs Brandenburgischem Konzert No. 4, das du leicht im Internet findest.
Das Barock war also eine Zeit, die strenge, komplizierte Kunstprinzipien liebte und der es gar nicht künstlich genug sein konnte. Das ist kein Zufall, denn dieser hellen, verspielten Seite der barocken Kultur stand eine düstere, ängstliche und pessimistische gegenüber, von der man sich nur allzu gern ablenken wollte. Diese düstere Seite beruhte auf den vielen Erfahrungen von Zerstörung und Unheil, die das 16. und das 17. Jahrhundert reichlich zu bieten hatten: Da war zunächst das Glaubensproblem. Die Reformation, gerade zwei bis drei Generationen her, hatte den Menschen die Gewissheit geraubt, nach dem Tod in den Himmel zu kommen, sofern sie sich nur halbwegs an die kirchlichen Regeln hielten. Seit dem 16. Jh. predigten die Lutheraner etwas anderes als die Calvinisten und die Calvinisten etwas anderes als der Papst, aber wer hatte recht? Wie zur Bestätigung gingen in der Landwirtschaft die Erträge für viele Jahrzehnte zurück (die sog. kleine Eiszeit um 1600) und wegen der deutlich schlechteren Ernährungslage gingen Seuchen um – ganz so, als wolle Gott die Menschen strafen. Man lebte in panischer Angst vor dem Teufel und seinen Hexen, die plötzlich überall aufzutauchen schienen (und entsetzlich häufig grausam umgebracht wurden). Den Gipfelpunkt der Katastrophen bildete schließlich der 30-jährige Krieg 1618-48, der Not, Gewalt und Elend eine ganze Generation lang in Europa verbreitete und die Bevölkerung Deutschlands in manchen Gebieten auf weniger als ein Drittel dezimierte. Ist es da verwunderlich, dass man sich aus diesem Chaos gern in eine Welt strenger künstlicher Ordnung flüchtete? Ordnung schafft Sicherheit und Sicherheit war rar in diesen Zeiten.
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau
Vergänglichkeit der Schönheit (vor 1679)
Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand
Dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen
Der liebliche Corall der Lippen wird verbleichen;
Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand
Der Augen süsser Blitz, die Kräffte deiner Hand
Für welchen solches fällt, die werden zeitlich weichen
Das haar, das itzund kan des Goldes Glantz erreichen
Tilget endlich tag und jahr als ein gemeines band.
Der wohlgesetzte Fuss, die lieblichen Gebärden
Die werden theils zu Staub, theils nichts und nichtig werden
Denn opfert keiner mehr der Gottheit deiner pracht.
Diß und noch mehr als diß muß endlich untergehen
Dein Hertze kan allein zu aller Zeit bestehen
Dieweil es die Natur aus Diamant gemacht.
Hoffmannswaldaus Gedicht spielt mit den beiden Seiten des Barock – mit der hellen, kunstvollen Lebensfreude und dem tiefen Pessimismus. Was dabei herauskommt, ist das sog. Vanitas-Motiv (Vanitas, lat.: Vergänglichkeit): Alles Schöne ist letztendlich dazu verurteilt zu vergehen:
Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand
Dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen
Hoffmannswaldau empfängt uns in seinem Gedicht mit der Personifikation des Todes, der mit seiner bleichen Hand (V. 1) nach den Lebenden greift. Diese Art der Darstellung ist ein typisches Beispiel für eine Allegorie (ein Gedankenbild): Das abstrakte Konzept „Tod“ wird zu einer Person und wir alle wissen, wie ein solcher allegorischer Tod aussieht: Er spukt mit seinem Mantel, der Sense und der Sanduhr durch jeden zweiten Disney-Film. In unserem Gedicht spielt er aber nur die dritte Person, denn das lyrische Ich wendet sich an einen – wahrscheinlich an eine – Leserin, der es nicht gerade zimperlich deutlich macht, dass sie eines Tages zu sterben habe. Diese Botschaft nennen wir ein Memento mori (lat.: Bedenke, dass du sterben wirst) und wir begegnen dieser Gedankenfigur überall im Barock, in Liedern, in Gemälden, in Skulpturen, in der Architektur: hier ein Totenkopf, da eine verwelkende Blume im Glas, dort ein totes Rebhuhn.
Ist dir aufgefallen, wie kunstvoll Hoffmannswaldau die Botschaft des Memento mori in eine kühl-erotische Atmosphäre setzt: Die kalte[...] Hand des Todes streicht um deine Brüste (V. 1 f). Deutlicher kann ein barocker Dichter nicht werden. Höchstens genauer:
Der liebliche Corall der Lippen wird verbleichen;
Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand
Rote Korallen waren im Europa des 17. Jahrhunderts extrem selten und entsprechend teuer. Die Lippen der Angebeteten mit dem Corall (V. 3) zu vergleichen, unterstreicht folglich nicht nur die Schönheit, sondern auch den Wert dieser körperlichen Zierde. Beachte bitte auch das wunderbare sprachliche Bild Der Schultern warmer Schnee (V. 4): Kann man kunstvoller gleichzeitig den Anblick des schönen Körpers wie auch die kühl-erotische Ausstrahlung der Angesprochenen charakterisieren?
Lass uns kurz den Aufbau der Strophe untersuchen, denn Form ist eines der Schlüsselprinzipien des Barock. Jeder Vers zerfällt genau in der Mitte rhythmisch in zwei gleich große Teile:
„der Schul |tern war|mer Schnee “ (7 Silben)
„wird wer |den kal |ter Sand“ (7 Silben).
Und auch der Inhalt folgt diesem Bruch: hier die schöne Angesprochene – dort das, was aus ihr wird.
Einen solchen Vers nennen wir Alexandriner: Sechs betonte Silben pro Vers (ich hab sie fett markiert), dazwischen je eine unbetonte, in der Mitte ein klarer Schnitt (eine Zäsur). Probier es aus: es klappt in allen Zeilen des Gedichtes – bis auf eine einzige Ausnahme, und das hat Gründe...4
Auf heutige Leser wirkt der Alexandriner immer etwas behäbig und statisch – wie ein Tanzbär, und so ähnlich sahen die barocken Schreit-Tänze ja auch aus. Die völlig exakte Rhythmik wirkt eher ermüdend als ermunternd – aber genau das passte in die strenge Kunstwelt des Barock. Und das Thema ist ja auch wahrhaft nicht besonders ausgelassen.
Alexandriner wurden im Barock gern verwendet. Sie sind schwer zu bändigen, weil der Dichter exakt auf den Versaufbau Rücksicht nehmen und seine Botschaft in kleine, sechs- oder siebensilbige Abschnitte zwängen muss, die darüber hinaus noch in ein komplexes Reimschema passen müssen – eine würdige Herausforderung für einen Sprachkünstler. Siehst du, wie der barocke Dichter – ganz so wie der Gärtner des Schlossparks – aus dem wildwüchsigen Gebüsch der Sprache eine exakte, geometrische Palisadenhecke schneidet? Das ist Barock.
Es wird dich bei all der Formstrenge nicht wundern, dass auch der Gesamtaufbau des Gedichtes einem strengen Prinzip folgt. Wir nennen es Sonett und praktisch jeder große Dichter hat sich irgendwann einmal daran versucht: Goethe, Heine, Rilke – und natürlich Shakespeare mit seinem unsterblichen Sonettzyklus.
Auch inhaltlich ist das Gedicht streng gegliedert: Jedem Merkmal des Lebens und der Schönheit wird eines des Todes und des Hässlichen entgegengestellt:
o die
Brüste
und der
bleiche Tod
(V. 1),
o der warme Schnee und der kalte Sand. (V.2),
o Des
Goldes Glanz
wird ein
gemeines Band
(V. 7 f),
o die lieblichen Gebärden werden zu Staub (V. 9 f).
Eine solche Gegenüberstellung von Gegensätzen nennen wir Antithese. Antithesen sind ausgesprochen häufig in der Literatur, denn im Grunde sind sie nichts anderes als ein Konflikt (gut – böse; schön – hässlich; stark – schwach; dumm – klug etc.) und ohne solche Konflikte kommt Literatur nun einmal nicht aus. Aber Antithesen sind natürlich auch ganz besonders geeignet, die Zerrissenheit der barocken Kultur in Sprache zu kleiden. Deshalb sind sie so typisch für die Zeit: Hoffmannswaldau kostet die Schönheit der Angesprochenen sprachlich voll aus, aber er negiert den Wert dieser Schönheit in jedem zweiten Vers durch sein Memento mori.
Der wohlgesetzte Fuss, die lieblichen Gebärden
Die werden theils zu Staub, theils nichts und nichtig werden
Denn opfert keiner mehr der Gottheit deiner pracht.
Es wäre dennoch zu kurz gegriffen, die beschriebene Schönheit der Angesprochenen nur als etwas Zerstörbares und Nichtiges zu deuten, denn indem Hoffmannswaldau den schönen weiblichen Körper in den Quartetten buchstäblich von Kopf bis Fuß sprachlich auskostet, ja sogar zu einer Gottheit (V. 11) stilisiert, beweist er einen feinen, ja überfeinen Sinn für (Lebens-)Lust. Sie gehört zur hellen Seite des Barock und wird oft mit dem lateinischen Sinnspruch Carpe diem (Nutze den Tag) dem düsteren Memento mori entgegengestellt.
Sonette sind häufig Liebesgedichte. Aber es sind auch häufig philosophische Sinnsprüche. Für unser Gedicht passt erstaunlicherweise beides – je nachdem, ob wir die Angesprochene als eine konkrete Person oder nur allgemein als irgendeine Schöne interpretieren. Das ist bemerkenswert, denn es verändert stark die Bedeutung der Schlussverse:
Dein Hertze kan allein zu aller Zeit bestehen
Dieweil es die Natur aus Diamant gemacht.
Nehmen wir an, das lyrische Ich will die Leserinnen und Leser lediglich allgemein vor der Vergänglichkeit der Schönheit warnen: Dann ist die Botschaft der letzten beiden Zeilen ein tröstender Hoffnungsschimmer: Etwas von dir wird die Zeiten überstehen, denn die Natur hat dein Herz aus Diamant gemacht. Die Diamant-Metapher verdeutlicht in dieser Lesart die Festigkeit und Ewigkeit des Herzens und natürlich seinen immensen Wert. Das Herz allein wird überleben – das ist der Ausweg aus der Sterblichkeit und Vergänglichkeit unseres irdischen Daseins.
Ganz anders lesen sich die Zeilen, wenn das lyrische Ich ein ganz konkretes lyrisches Du anspricht – noch dazu eines, das nicht nur weiblich und höchst anmutig ist, sondern das dem Dichter auch schon einmal kühl die schneeweiße Schulter gezeigt hat (vgl. V. 4): In diesem Falle stünde die Diamantenmetapher eher für die Härte, Kälte und edle Unnahbarkeit des Herzens der schönen Dame. Der letzte Vers wäre nun plötzlich der Vorwurf eines zurückgewiesenen Liebhabers.
Was Hoffmannswaldau eigentlich meinte, kann uns im Augenblick herzlich egal sein, denn wir sind nicht seine Biografen, sondern sein Publikum. Es ist gut möglich, dass er mit der Doppeldeutigkeit der Schlussverse bewusst gespielt hat. Vielleicht auch unbewusst. Aber ist es nicht faszinierend, wie die Metapher des Diamanten, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, so etwas Unterschiedliches aussagen kann? Und dabei doch in beiden Blickwinkeln völlig Sinn ergibt?
Fassen wir also zusammen: Hoffmannswaldau bringt die Zerrissenheit der barocken Kultur zwischen Lebensfreude und Todesangst durch ein Sonett mit Vanitas-Motiven zum Ausdruck, in welchem in strengen Alexandrinern Carpe diem und Memento mori einander antithetisch gegenübergestellt werden. Wenn du diesen letzten Satz lesen und verstehen konntest, kannst du dich zurecht einen Adepten6der Literaturwissenschaft nennen.
Das Barock war die letzte große höfische Epoche, also eine Kultur, die vom Adel ausging: Er war nicht nur der wichtigste Kunstkonsument, sondern auch der bedeutendste Geldgeber. Kein Wunder, dass es daher im Barock auch thematisch viel um das Leben und die Sorgen einer überwiegend adligen Schicht ging. Die dem Barock folgende Epoche, die Aufklärung, war dagegen vor allem bürgerlich geprägt, stellte ganz andere Fragen und setzte auch künstlerisch neue Akzente. Einige Merkmale des Barock übernahm sie dabei und entwickelte sie weiter, andere hingegen hat sie radikal negiert.
3 Es gibt da verschiedene Annahmen und Herleitungsversuche, die uns hier aber egal sein können, weil keine uns wirklich etwas über die Epoche und ihre charakteristischen Eigenschaften verrät.
4…, die wir aber an dieser Stelle nicht besprechen werden. Im übernächsten Kapitel werden wir solche Abweichungen genauer unter die Lupe nehmen und ihre Gründe untersuchen. Im Anschluss kannst du dich auch an dieser Stelle einmal versuchen.
5 Hand > Sand > Hand > Band, und in den geraden Versen: streichen > verbleichen > weichen > erreichen.
6 Und wenn du diese Fußnote nachgeschlagen hast, möchtest du bestimmt wissen, was ein Adept ist. Falls ja, finde es heraus...
3. Aufklärung
Magnus Gottfried Lichtwer Die beraubte Fabel (1762)
Wer an die Epoche der Aufklärung denkt, denkt sofort an Begriffe wie Vernunft, Verstand, Denken – kurz: an Rationalität. Kant sagt, der Wahlspruch der Aufklärung sei: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Was allerdings schnell vergessen wird, ist, dass Denken, Verstand und Rationalität bereits im Barock in hohen Ehren standen. Die großen Denker des Rationalismus – Descartes, Newton, Leibnitz und viele andere – waren Kinder des Barock, nicht erst der Aufklärung. Und was sind die strengen mathematischen und geometrischen Kunstprinzipien des Barock anderes als Kunst gewordene Rationalität?
Der Unterschied zwischen Barock und Aufklärung liegt nicht in der Rationalität; auch nicht darin, dass das Barock ein höfische, die Aufklärung hingegen eine bürgerliche Kultur war. Der eigentliche und fundamentale Unterschied liegt im unerhörten Optimismus der Aufklärung! Nämlich der Überzeugung, dass alles gut werden kann auf dieser Welt, dass der Mensch im Grunde gut ist und nur durch geeignete Mittel in die Lage versetzt werden müsse, auch tatsächlich gut zu sein und Gutes zu tun.
Diesen Optimismus, der das genaue Gegenteil des barocken Pessimismus war, teilte die Aufklärung mit vielen späteren Strömungen, zum Beispiel mit der Klassik oder der Romantik (Kap. 6 und 7). Wir sprechen sie alle gemeinsam als Idealismus an und meinen damit, dass die Künstler danach strebten, den Menschen in irgendeiner Weise zu vervollkommnen – also ein menschliches Ideal zu erreichen. Unterschiede zwischen den Strömungen bestanden nicht so sehr im Ziel der Entwicklung, als in dem Weg, den man zur Vervollkommnung des Menschen einschlagen wollte.
Der Weg, den die Aufklärung für richtig hielt, war die Vernunft