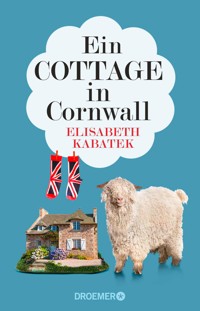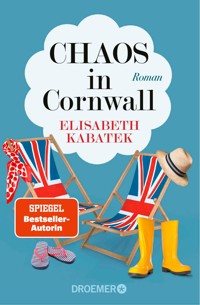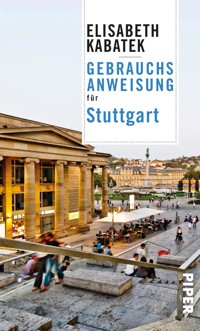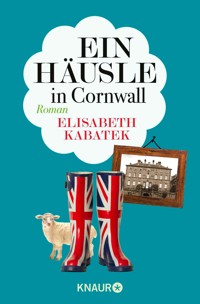9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Autorin der Bestseller-Reihe "Laugenweckle zum Frühstück", "Spätzleblues", "Brezeltango", und "Zur Sache, Schätzle!" Der neue Roman von Elisabeth Kabatek ist ein lebenskluger und unterhaltsamer Roadtrip durch ganz Deutschland. Drei Personen, die alle vor etwas davonlaufen, treffen zufällig an einer Autobahnraststätte aufeinander und setzen ihre Reise gemeinsam fort: Luise, Mitte 70, wurde jahrelang von ihrem Mann betrogen. Jan, 50, flieht vor der Midlife-Crisis und die dreißigjährige Sabrina ist gerade mit dem besten Freund ihres Freundes im Bett gelandet. Schnell geht dem verrückt normalen Trio das Geld aus. Die Geldbeschaffungsmaßnahmen sind reichlich unkonventionell, und schon bald nimmt die Polizei die Verfolgung auf. Die anfangs harmlose Reise fordert immer mehr Konsequenzen. "Elisabeth Kabatek ist wieder eine umwerfende Komödie gelungen, mit Herz und Charme - superlustig!" Für Sie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Elisabeth Kabatek
Kleine Verbrechen erhalten die Freundschaft
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Witwe aus der Stuttgarter Halbhöhenlage mit ungeahnten Potenzialen. Ein Familienvater in der Midlife-Crisis. Eine junge Referendarin, die tablettenabhängig ist: Sie hauen ab und suchen nicht weniger als den Sinn des Lebens. Zufällig kreuzen sich ihre Wege, und sie setzen ihre Reise gemeinsam fort. Die Geldbeschaffungsmaßnahmen sind reichlich unkonventionell. Dann nimmt noch ein verrückter Kommissar die Verfolgung auf. Die ungeplante Reise quer durch Deutschland fordert immer mehr Konsequenzen – kleine Verbrechen inklusive …
Von der Autorin der Bestseller-Reihe »Laugenweckle zum Frühstück«, »Brezeltango«, »Spätzleblues« und »Zur Sache, Schätzle!«
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Sabrina
Luise
Jan
Luise
Jan
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Jan
Sabrina
Luise
Kommissar Schwabbacher
Sabrina
Jan
Sabrina
Luise
Jan
Kommissar Schwabbacher
Sabrina
Luise
Jan
Sabrina
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Jan
Luise
Sabrina
Luise
Dank
Für Susanne, die mich seit Jahren mit ihrer wunderbaren Musik begleitet.
Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind.
Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu
Prolog
Die Kollegen in Hamburg waren schnell gewesen, im Gegensatz zu der Gurkentruppe aus Boppard. Eine knappe Stunde nach dem Überfall hatte Kriminalhauptkommissar Schwabbacher das Video auf seinem Bildschirm. Selten in seiner langen Karriere im Stuttgarter Polizeipräsidium hatte ein Überwachungsvideo Schwabbacher derart viel Vergnügen bereitet; wieder und wieder klickte er darauf, als handele es sich um einen besonders witzigen Clip auf YouTube. Nach einer Weile hatte er das Video so oft gesehen, dass er eigentlich nur noch die Augen schließen musste, und schon lief der Film vor seinem inneren Auge ab.
Das Video zeigte den Schalterraum der »Hamburg Bank« am Jungfernstieg und setzte am Montagmorgen, 10.11 Uhr, ein. In der relativ kleinen Filiale gab es nur zwei Servicetheken für die Kunden sowie einen Kassenraum hinter einer Glasscheibe; alle drei Schalter waren mit Bankangestellten besetzt. Eine Frau bediente die Kasse, jeweils ein Mann und eine Frau arbeiteten an den Stehtischen. Es fing ganz harmlos an. Ein paar Kunden wickelten Geschäfte ab; die Stimmung war entspannt. Nacheinander verließen sie die Bank wieder, bis der Raum, abgesehen von den Angestellten, leer war. Nun betraten eine Frau und ein Mann gemeinsam die Filiale. Der Mann war um die fünfzig und hatte ungewöhnlich fülliges, kurzes braunes Haar, die Frau hatte lange schwarze Haare und trug Jeans und Chucks. Ihr faltiges Gesicht stand in seltsamem Kontrast zu ihrer jugendlichen Aufmachung. Der Mann hielt ein Blatt Papier in der Hand, das er nun in aller Ruhe mit der Schrift zur Straße auf die gläserne Eingangstür klebte. Darauf stand, wie Schwabbacher nur zu genau wusste: »Wegen Dreharbeiten bleibt diese Filiale heute geschlossen«. Die drei Mitarbeiter, sichtlich perplex, starrten den Mann ungläubig an.
»He, was machen Sie denn da!«, rief der Bankangestellte. Es klang empört, nicht ängstlich.
Die ältere Frau in Jeans sagte nun laut und vernehmlich: »Schönen guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, wir möchten Ihnen keine Umstände machen.« Die drei Angestellten guckten die Frau mit großen Augen an. »Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist ein Überfall. Geben Sie uns alles Geld, was Sie haben. Machen Sie keine Dummheiten, damit wir Komplikationen verhindern, niemand verletzt wird und Sie hinterher nicht zum Therapeuten müssen. Posttraumatische Belastungsstörung, man kennt das ja.« Die Frau an der Kasse bekam einen Lachanfall. Die anderen beiden guckten nur ungläubig; alle drei standen da wie angewurzelt. Die Frau in Jeans seufzte; sie öffnete ihre Handtasche, zog eine Pistole heraus und zielte auf die Angestellte am offenen Schalter. Die derart Bedrohte schrie auf, ihr Kollege griff hastig nach einem Telefon. »Finger weg!«, rief die Frau, zielte auf die Decke und gab einen Schuss ab.
»Und Finger weg vom Notknopf!«, brüllte der Mann, der unbewaffnet zu sein schien. »Heben Sie die Hände über den Kopf!« Die drei Angestellten hoben langsam die Hände, alle drei wirkten jetzt völlig verängstigt. Die Frau mit der Pistole ging nun näher an die Bankangestellte heran und zielte auf ihre Schläfe; die Mitarbeiterin schloss die Augen und begann erst heftig zu zittern und dann leise zu weinen.
»Fünfunddreißigtausend Euro«, rief die Frau mit der Pistole in Richtung der Kassiererin. »Geben Sie uns fünfunddreißigtausend Euro, dann stößt Ihrer Kollegin nichts zu.« Ihr Begleiter lief zur Kasse und baute sich drohend davor auf; er humpelte.
»Haben Sie nicht gehört«, zischte er.
»Aber … aber so viel Geld haben wir gar hier nicht hier!«, stieß die Frau an der Kasse atemlos hervor.
»Dann holen Sie alles, was Sie haben«, sagte die Frau. »Und versuchen Sie nicht, uns hereinzulegen, wenn Ihnen das Leben Ihrer Kollegin lieb ist.«
Erste Befragungen der Bankangestellten hatten ergeben, dass der Überfall eine derart bizarre Mischung aus Dilettantismus und Gewaltbereitschaft gewesen war, dass sie eine besonders perfide Taktik dahinter vermuteten, und deshalb erst ein paar Minuten nachdem die beiden Bankräuber die Bank mit fünfzehntausend Euro verlassen hatten, die Polizei riefen. Auch die Kunden, die in die Filiale hineinwollten, hatten das mit den Dreharbeiten geglaubt, obwohl nirgends auch nur ein Kamerateam zu sehen gewesen war. Bewaffneter Banküberfall, dachte Schwabbacher begeistert, besser hätte es nicht laufen können, das gibt mindestens fünf Jahre. Auf diesen Augenblick hatte er zehn Jahre lang gewartet. Das Warten hatte sich gelohnt.
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Seit er gegangen ist, kommt mir das Haus noch viel größer vor. Am frühen Morgen wache ich auf und lausche. Überall höre ich es ächzen, knacken und krachen. Aus den harmlosen Geräuschen werden knarrende Türen, die jemand heimlich aufzudrücken versucht, schleichende Schritte auf dem Parkett, Schubladen, die auf der Suche nach Wertsachen mit leisem Quietschen aufgezogen werden. Ich fürchte mich, in meinem eigenen Haus, dabei lebe ich seit vierundvierzig Jahren hier an der Feuerbacher Heide. Weil ich vor lauter Unruhe nicht mehr einschlafen kann, schimpfe ich mit mir selber und hoffe, dass ich davon wieder müde werde. Die Liste meiner Selbstanklagen ist lang.
Stell dich nicht so an!
Du führst dich auf wie ein kleines Kind!
In alten Häusern knackt es nun mal, selbst in einer Villa am Killesberg!
Weißt du eigentlich, wie viele Leute dich beneiden?
Denk an all die armen Flüchtlinge!
Leider führt die Selbstbeschimpfung selten dazu, dass ich wieder einschlafe. Meistens bin ich richtig erleichtert, wenn ich höre, dass die Haustüre geht und Amila anfängt, unten in der Küche herumzuwerkeln. Dann weiß ich, es ist halb acht und ich habe die Nacht überstanden. Ich rufe sie dann auf dem Hausapparat in der Küche an, lasse mir eine Tasse Earl Grey ohne Milch bringen und wir plaudern ein wenig. Ihr strahlendes Lächeln und ihre freundlichen Worte nach der einsamen Nacht sind wie eine Erlösung. Wann habe ich Amila jemals schlecht gelaunt erlebt? Nach dem Tee stehe ich auf, schlüpfe in meinen Badeanzug und drehe ein paar Runden im Pool, um wach zu werden (niemand kann mich im Pool sehen, nicht einmal Amila, trotzdem würde ich niemals nackt schwimmen). Manchmal falle ich nachts aber auch wieder in einen bleiernen Schlaf und wache erst gegen neun Uhr auf. Einmal habe ich deshalb den Bridge-Treff und einmal die Mitfahrgelegenheit zum Golfplatz auf dem Schaichhof verpasst.
Vielleicht sollte ich doch verkaufen. Ich könnte das Haus sofort loswerden. Es gibt genug Leute mit sehr viel Geld in Stuttgart, und in der Halbhöhenlage werden kaum Objekte angeboten. Jetzt schon stehen manchmal Immobilienhaie auf der anderen Seite der Mauer und fangen mich ab, schließlich lesen sie die Todesanzeigen. Wahrscheinlich denken sie, die Alte macht’s eh nicht mehr lang hier, die zieht bald um ins Augustinum am Killesberg, ins betreute Wohnen für Reiche. Früher wären die gar nicht an mich herangekommen, es hätte praktisch keine Berührungspunkte gegeben, weil ich da fast immer im Mercedes auf dem Beifahrersitz saß und das Tor automatisch aufging. Aber jetzt muss ich zu Fuß zum Bus laufen wie die normalen Leute, und da stellen sie sich mir in den Weg, junge Schnösel im Anzug, die wohl glauben, ich würde mich von ihrem aufgesetzten Lächeln beeindrucken lassen. Sie strecken den Arm aus, wie eine Schranke quer über den Gehweg, und am Ende der Schranke klemmt eine Visitenkarte zwischen spitzen Fingern.
»Sie müssen doch jetzt nichts übers Knie brechen«, beschwören sie mich. »Aber nehmen Sie wenigstens meine Karte!« Manchmal leihe ich mir Amilas Hund aus. Vor dem großen Tier haben sie Respekt und rücken mir dann nicht dermaßen auf die Pelle.
Alle großen Banken und Immobilienmakler aus Stuttgart haben schon Prospekte eingeworfen oder jemanden geschickt, der unangekündigt vor der Tür stand. Wenn diese Leute klingeln, fragt Amila sie über die Sprechanlage, ob sie einen Termin bei der Dame des Hauses haben, und wenn sie verneinen, sagt sie streng, »Dann muss ich Sie jetzt leider bitten zu gehen.« Für wenig Aufwand eine gesalzene Provision, das ist es, wovon sie träumen. Wenn sie mich auf der Straße abpassen, beschleunige ich meine Schritte und lasse mich auf keine Diskussion ein, ich murmle nur: »Kein Interesse.« Einmal aber war so ein junger Mann besonders unverschämt, ich kam kaum an ihm vorbei, schließlich bin ich nicht mehr die Schnellste. Er lief neben mir her, als sei ich eine Prominente und er ein aufdringlicher Reporter, und da riss mir die Hutschnur, und ich sagte zuckersüß: »Aber natürlich will ich verkaufen. Was soll ich denn mit so einem großen Haus, allein?« Da fiel dem Kerl die Kinnlade herunter. Er riss die Augen auf, und ich könnte schwören, dass ich darin die nackte Gier leuchten sah. Ich blieb stehen und sagte (ganz leise, als sei ich nicht mehr recht bei Verstand und würde mit mir selbst reden), »Ja, für zehn bis fünfzehn Millionen wäre ich bereit zu verkaufen.« Da verschwand die Gier ganz schnell, und er sah nur noch töricht aus.
»Das … das Haus ist sicher eine Menge wert«, stotterte er. »Ich fürchte bloß, zehn Millionen ist ein bisschen viel, selbst wenn in den letzten Jahren in Stuttgart die Immobilienpreise für Luxusobjekte in der Halbhöhenlage explodiert sind. Anderthalb Millionen könnten wir sicherlich erzielen, vielleicht sogar zwei. Machen wir doch einen Termin, dann sehen wir es uns in aller Ruhe an und sprechen darüber. Sie sollten nichts überstürzen.«
»Junger Mann, für zwei Millionen Euro verkaufe ich nicht einmal meine Doppelgarage oder den Pool«, erwiderte ich vernichtend. Innerlich war ich ganz aufgeregt, dass ich es fertigbrachte, so etwas zu sagen. Ich habe den frechen Kerl dann auch nie mehr gesehen.
Ich weiß auch nicht, weshalb ich mich plötzlich so einsam fühle im Haus. Schließlich war ich früher auch viel allein, vor allem abends. Günther saß oft bis spät in die Nacht in der Firma und arbeitete, oder er traf sich irgendwo in der Stadt hinter verschlossenen Türen oder in den Nebenzimmern von teuren Restaurants mit irgendwelchen wichtigen Leuten, die gut fürs Geschäft waren – andere Bauunternehmer, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Richter, Lokalpolitiker, Leute von der IHK, von Bosch, Daimler und Porsche, aus der Stadtverwaltung, von den Banken oder von der Presse. Günther liebte diese Treffen. Er bezeichnete sie als Bedarfsermittlung. Jemand hatte einen Bedarf und fand heraus, wer aus der Runde diesen Bedarf decken konnte, und weil man einander kannte, kam man dabei oft auch ohne Verträge aus. Das lief mehr so auf dem kleinen Dienstweg, wie Günther es zu nennen pflegte. Nichts Illegales, wie er betonte. Manchmal war der Bedarf auch einfach eine vertrauliche Information. Ich bekam von diesen Treffen nicht viel mit und hielt mich sowieso nicht für klug genug, um zu begreifen, um was es genau ging. Ein paar Jahre lang war Stuttgart 21 das beherrschende Thema, da wurden bei den Treffen die Pfründe verteilt, das verstand sogar ich. Günther hielt sich normalerweise mir gegenüber sehr bedeckt, aber in diesem Falle kannte seine Begeisterung keine Grenzen. Er bekam den Zuschlag, Luxuswohnungen auf dem S21-Gelände zu bauen, das war der Lohn für das viele Netzwerken, wie er sagte. Es schienen lukrative Projekte zu sein, aber sie waren auch extrem zeitaufwendig, und Günthers Arbeitszeiten wurden immer länger.
Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Geschäfte außen vor blieben, wenn wir als Paar eingeladen waren oder selbst eine Einladung gaben und die Damen mit anwesend waren. Man sprach stattdessen über Golfplätze und Restaurants oder Urlaub, nur manchmal zogen sich die Herren nach dem Essen gemeinsam zurück oder setzten sich im Sommer auf unsere Terrasse und rauchten Günthers teure Zigarren, während wir Frauen drinnen blieben und über die Kinder oder die Schule oder den Tennisclub oder das Ehrenamt redeten. Es gab auch ein paar jüngere Frauen in diesen Kreisen, die traten oft ehrgeiziger auf als die Männer, sie wirbelten herum, verteilten fleißig ihre Visitenkarten und versuchten hartnäckig, Strippen zu ziehen, nicht nur beruflich, sondern überall, auch im Elternbeirat der Schule.
Ich gehörte einer anderen Generation an; aus den Geschäften und dem Tennisclub hielt ich mich heraus, nur in der Schule engagierte ich mich, als die Kinder im schulpflichtigen Alter waren. Ich stand nicht so gerne im Rampenlicht. Dass Günther so viel weg war, war für mich normal. Nur manchmal, als die Kinder aus dem Haus waren, fragte ich ihn ganz vorsichtig, ob er nicht abends ein wenig öfter zu Hause sein könnte. Ein Abend die Woche, das hätte mir schon gereicht, nur Günther und ich, ein gemütliches Essen, von mir gekocht und nicht von Amila. Zwiebelrostbraten und handgeschabte Spätzle, das aß er doch so gern, auch wenn er Rheinländer war, dazu einen schönen grünen Salat vom Markt und ein Glas Rotwein, und Zeit füreinander. Einfach so wie früher, bevor Günther wichtig und erfolgreich geworden war. Normalerweise war er eine Seele von Mensch, aber in diesen Momenten reagierte er dann immer ziemlich gereizt. Was glaubst du eigentlich, wo unser Geld herkommt? Glaubst du, ich wäre selber nicht auch gerne mehr daheim? Ohne diese Termine und die vielen Stunden in der Firma geht es nun mal nicht. Und du willst doch unseren Lebensstandard halten? Ich protestierte nie, aber es tat mir weh, dass Günther offensichtlich vergessen hatte, dass sein ganzes Startkapital von mir stammte. Nicht nur das Geld und die Villa, auch die vielen Kontakte, die ihm die Türen öffneten. Günther war ein armer Schlucker, als er nach Stuttgart kam, während ich aus einer alteingesessenen Stuttgarter Familie stammte und immer schon vermögend gewesen war, mein ganzes Leben lang. Meine Eltern waren mit Theodor Heuss befreundet, sie waren quasi Nachbarn an der Feuerbacher Heide.
Wichtiger als der Lebensstandard wäre es mir gewesen, mehr Zeit miteinander zu verbringen, vor allem, als Günther älter wurde und es erste Anzeichen dafür gab, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Ich liebte ihn doch so sehr, ich liebte ihn noch genauso wie am ersten Tag, und ich hatte Angst um ihn. Ich wagte es aber nie, Günther ernsthaft zu bitten kürzerzutreten, weil ich genau wusste, er liebte die Arbeit mehr als mich und die Kinder. Das war einfach klar, daran gab es nichts zu rütteln, und ich akzeptierte es stillschweigend. Und selbst wenn er so viel außer Haus war, ich war mir doch immer hundertprozentig sicher, dass er mich auch noch liebte. Wie viele andere in seiner Position begannen im Alter eine Affäre mit einer jüngeren Frau? Wie viele Ehen zerbrachen um uns herum, und die Frau stand plötzlich ohne finanzielle Absicherung da? Kein Ehevertrag, keine Zugewinngemeinschaft, man liebte sich ja, und dann warf der Mann die Frau aus der Villa, und die Geliebte zog ein. Vorbei mit der Halbhöhe, die Frau musste hinunter in den Kessel, in eine Dreizimmerwohnung im Westen oder, noch schlimmer, in den Stuttgarter Osten.
Günther war nicht so. Ich wusste, dass er mich niemals betrügen würde und dass ihm der Sex, den wir nicht mehr hatten, nicht so viel bedeutete. Also nahm ich alles andere in Kauf. Man konnte nicht alles haben.
Jan
Sindelfingen, Industriegebiet
Es war wieder spät geworden. Christine hatte schon zweimal angerufen. Ich hatte ihr doch versprochen, früher daheim zu sein, wenigstens einmal! Wir waren bei den Nachbarn eingeladen, zum Grillen, halb acht. Aber das Meeting zog sich hin, länger als gedacht, und der Kunde war schwierig. Endlich war er weg, aber dann verwickelte mich der Chef zwischen Tür und Angel in ein längeres Gespräch. Wollte meine Meinung zum Kunden hören und noch schnell das weitere Vorgehen planen. Ich konnte ihn schlecht abwürgen, es war schließlich wichtig. Irgendwann klingelte das Handy zum dritten Mal.
»Seien Sie mir nicht böse, aber ich muss los. Wir haben eine Einladung. Meine Frau wird langsam nervös.«
Der Chef nickte und klopfte mir jovial auf die Schulter.
»Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, es ist ja auch schon spät. Wir reden morgen weiter. Schönen Abend, Herr Marquardt.« Ich hastete ins Büro, schaltete den Computer aus, schnappte meine Aktentasche und lief zum Parkplatz. Ich stieg ins Auto und rief Christine zurück. Es war kurz vor sieben.
»Wo bleibst du nur!« Sie klang vorwurfsvoll. Wenn ich es mir recht überlegte, klang sie in letzter Zeit eigentlich immer vorwurfsvoll.
»Wir hatten ein Meeting. Ich konnte nicht einfach abhauen.«
»Immer ist irgendwas. Wenn es kein Meeting ist, dann ist es dein Chef oder eine dringende Terminsache. Man kann überhaupt nicht mehr mit dir planen.«
»Christine, ich bin total kaputt. Mach mir doch nicht noch zusätzlich die Hölle heiß.«
»Und ich sitze mit zwei Teenies zu Hause, die mir den ganzen Tag die Hölle heißmachen, und kriege von dir praktisch keinerlei Unterstützung.« Schon waren wir wieder beim Thema. Dabei hatte ich ihr doch nur Bescheid geben wollen.
»Du kannst doch schon mal vorgehen zu den Nachbarn.«
»Wie sieht das denn aus!«
»Wie du willst. Ich bin ja gleich da.«
Als ob es auf zehn Minuten ankäme. Ich knallte das Handy auf den Beifahrersitz und ließ den Motor an. Dann schaltete ich ihn wieder aus, stützte die Arme aufs Lenkrad und starrte durchs Fenster auf den Parkplatz mit Blick auf die Autobahn. Obwohl es spät war, standen noch eine ganze Menge Autos da. Nicht nur in meiner Abteilung wurden Überstunden geklopft. Ich war sicherlich auch nicht der Einzige, der zwei Töchter hatte, die pubertierten wie aus dem Bilderbuch und ohne Unterbrechung stritten, nörgelten und nölten. Das war aber eigentlich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass sich meine einstmals glückliche Ehe in Luft aufgelöst hatte. Einfach weg. Einfach so. Was war bloß mit uns passiert? Oder besser, was war mit mir passiert?
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Ohne Heiderose hätte ich das alles gar nicht durchgestanden.
Günther liebte nicht nur seine Arbeit mehr als mich. Er liebte seine Arbeit auch mehr als seine Gesundheit. Er ging nicht zum Arzt, obwohl er plötzlich schlecht schlief, dabei hatte er immer geschlafen wie ein Stein. Manchmal wirkte er sehr erschöpft. Er hörte auf, Tennis zu spielen, weil es ihn zu sehr anstrengte, und nahm in ziemlich kurzer Zeit stark zu. Das sei eben das Alter, meinte er, mit Mitte siebzig könne er den Stress einfach nicht mehr so gut wegstecken wie früher, aber das sei kein Grund, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, und Kürzertreten käme überhaupt nicht in Frage. Dabei hatte er seit ein paar Jahren einen Geschäftsführer in seinem Bauunternehmen, der ihm das Tagesgeschäft abnahm. Er war wie alle Männer seiner Generation, er hasste es, sich den Kopf über seinen Körper zu zerbrechen. Außerdem fiel es ihm schwer, Verantwortung abzugeben. Sein großes Vorbild war der Schraubenhersteller Reinhold Würth, der trotz seines hohen Alters immer noch täglich in die Firma ging, mehrere Stunden am Tag Briefe diktierte oder Telefonate führte und der selbst im Urlaub auf seiner Jacht das Arbeiten nicht lassen konnte.
Das Bild vom nimmermüden schwäbischen Patriarchen gefiel Günther, auch wenn er selber kein Schwabe war. Ich schlug einen längeren Urlaub in einem Wellnesshotel vor, an der Nordsee oder in den Bergen, zur Erholung, vielleicht auch eine Kur. Günther lehnte ab. Wellness war ihm ein Graus. Früher, mit der Familie, waren wir oft auf Sylt gewesen, die Nordseeluft hätte ihm sicher gutgetan. Ein paar Tage Oberstdorf, das war alles, was er sich und mir zugestand, und ein Wochenende im Luxushotel. Gegen Luxus hatte Günther nichts.
Es ging dann ganz schnell. Zwei Stunden nach dem Herzinfarkt war Günther tot. Er war spät heimgekommen, wie immer, und wie immer hatte ich auf ihn gewartet, und wir redeten noch ein wenig. Das war ja das Schöne, nie hatten wir aufgehört, miteinander zu reden, Günther und ich. Wer konnte das schon von sich sagen, nach vierundvierzig Jahren Ehe? Er erzählte mir von seinem Abendessen, dann zog er sich den Schlafanzug an, bekam auf einmal einen Schweißausbruch und ging hinunter, um sich ein Glas Wasser zu holen. Dann hörte ich plötzlich ein dumpfes Geräusch. Ich wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert war. Das war wie ein Instinkt.
Ich sprang aus dem Bett, packte das Telefon und rannte aus dem Schlafzimmer. Günther lag seitlich auf der Treppe und röchelte, aschfahl im Gesicht.
»Hast du Schmerzen in der Brust?«, schrie ich, und er nickte schwach. Ich tastete nach seinem Handgelenk, der Puls raste. Ich griff von hinten unter seine Achseln und versuchte, seinen Oberkörper etwas höher zu lagern, aber er rutschte mir wieder weg. Ich wählte die 112. »Herzinfarkt, machen Sie schnell, bitte …« Dann kniete ich eine Stufe unter ihm, hielt seine Hand und streichelte seine Stirn, auf der kalter Schweiß stand. Er versuchte zu sprechen, aber er bekam keine Luft. Es dauerte zehn Minuten, bis der Krankenwagen kam. Zehn Minuten, in denen ich glaubte, den Verstand zu verlieren, und in denen ich nur einen einzigen Gedanken hatte: Stirb nicht, Günther, bitte stirb nicht, stirb nicht, ich kann ohne dich nicht leben, lass mich nicht allein, bitte. Ich weiß nicht, ob ich es laut sagte, wie ein Mantra, oder ob ich es nur dachte. Günther sah mich stumm an, ich sah die Todesangst in seinen Augen. Ich wollte ihn eigentlich keine Sekunde allein lassen, aber ich musste hinunter, um das Tor für den Krankenwagen zu öffnen. »Ich bin gleich wieder da, Liebster, ich muss nur kurz aufmachen«, flüsterte ich und drückte seine Hand. »Bitte, geh nicht fort.« Als ich zurückkam, war Günther bewusstlos. Eine Minute später war das Rettungsteam im Haus, legte Günther auf eine Trage und transportierte ihn die Treppe hinunter. Noch im Flur machte der Notarzt eine Herzdruckmassage, dann wurde Günther in den Krankenwagen gebracht.
Ich wäre so gern bei ihm geblieben, aber der Notarzt wehrte ab, und ich musste vorne einsteigen. Wir rasten den Eckartshaldenweg hinunter ins Katharinenhospital, zum Glück war kein Verkehr, es war ja schon nach Mitternacht. Immer wieder drehte ich mich um und blickte durch die Scheibe, ich fixierte den Notarzt mit weitaufgerissenen Augen, ich hypnotisierte ihn, damit er Günther so gut wie nur möglich versorgte. Als ob das einen Unterschied machte! Günther wurde mit routinierten Griffen versorgt, der Arzt bemerkte meinen Blick nicht einmal. Wir hielten im Hof des Katharinenhospitals, ich sprang vom Beifahrersitz und eilte nach hinten. Günther wurde gerade vom Notfallteam ans Krankenhauspersonal übergeben. Ich lief hinter der Trage her und mit hinein in die Notaufnahme. Dort wurde ich von einem Krankenpfleger aufgehalten und höflich gebeten, draußen zu warten. Das war das letzte Mal, dass ich Günther lebend sah. Keine Verabschiedung, keine Berührung, nichts als ein letzter, verzweifelter Blick auf einen reglosen Körper. Als mich der Arzt endlich holen ließ, war Günther schon tot.
Ich weiß nicht, wie lange ich weinend im Flur der Notaufnahme saß. Die Zeit verging quälend langsam, auf der anderen Seite saß eine Frau und wimmerte, ein Mann streichelte hilflos ihre Hand, Menschen in weißen Kitteln verschwanden hinter der Schwingtür. Irgendwann nickte ich ein.
»Frau Engel?« Ich schreckte auf. Man brachte mich in ein Sprechzimmer, hinter einem Schreibtisch saß ein Arzt und deutete auf einen Stuhl. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, ich stand unter Schock. Er redete von irgendjemandem, der infolge von Kammerflimmern einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hatte und gestorben war, ohne dass er hatte leiden müssen, und selbst wenn dieser jemand überlebt hätte, so wäre doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass er ein Pflegefall geworden wäre, und da war es doch letztlich besser so, da war ich doch sicher seiner Meinung? Ich lächelte vor mich hin. Auf dem Schreibtisch standen das Foto einer bildhübschen Frau mit einem Baby auf dem Arm, die mindestens zwanzig Jahre jünger war als der Arzt, und eine Glaskugel mit dem Stuttgarter Fernsehturm. Ich nahm die Glaskugel in die Hand, schüttelte sie und sah zu, wie der Fernsehturm im Schneesturm versank. Ich stellte mir vor, ich würde mit Günther in diesem Schneesturm oben auf der Plattform stehen, im bitterkalten Winter zu Beginn des Jahres 1971. Wir hielten uns an den Händen und waren frisch verliebt. Plötzlich stand der Arzt ganz dicht vor mir. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er aufgestanden war. Er nahm mir die Kugel aus der Hand. Dann sagte er laut und langsam: »Frau Engel, Sie stehen unter Schock. Sie wollen sich jetzt sicher von Ihrem Mann verabschieden, danach müssen Sie sich abholen lassen. Und ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung mit. Haben Sie Kinder? Sagen Sie mir, wen wir anrufen sollen.« Er legte mir ein Blutdruckgerät an.
»Heiderose«, sagte ich automatisch.
Sabrina
Stuttgart-Vaihingen, Universität
Was habe ich getan. Was habe ich bloß angerichtet.
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Die Kinder wollten eigentlich vor dem Begräbnis kommen. Aber dann riefen sie an, eins nach dem anderen. Nun war Vater ja sowieso schon tot, und da würde es ja nicht so viel Sinn machen, früher anzureisen, und eigentlich würden sie es erst direkt zur Beerdigung schaffen. Das würde ich doch sicher verstehen? Zu viel Stress, im Moment. Natürlich verstand ich. Schließlich waren sie alle drei in dem Alter, in dem man total eingespannt ist, Daniel mit seiner eigenen kleinen Firma und Elias mit der neuen Abteilung, die er gerade übernommen hatte.
»Ich hab ein ganz schlechtes Gewissen. Soll ich nicht doch vorher kommen?«, fragte Lea am Telefon. »Es tut mir so leid, dich mit alldem allein zu lassen. Mit den Karten und den Vorbereitungen für die Beerdigung und dem Leichenschmaus. Einen Tag vorher, das könnte ich schaffen.«
»Aber du hast doch selber so viel zu tun«, antwortete ich automatisch, obwohl alles in mir schrie, ja, bitte komm, aber das laut auszusprechen wäre egoistisch gewesen. Ich hatte einen Kloß im Hals. Ich brauchte niemanden, der mir mit den Karten und der Organisation der Beerdigung half, Heiderose war ja da. Ich brauchte jemanden, der mich umarmte und festhielt. Jemanden von der Familie. Jemanden, bei dem ich endlich weinen konnte. Heiderose war dafür nicht die Richtige. Aber das sagte ich nicht.
»Na ja, es wäre schon einfacher, ich käme ein andermal für ein paar Tage«, sagte Lea. Sie klang erleichtert. »Nach der Beerdigung, mit etwas mehr Vorlauf. Das ließe sich besser planen, und du könntest ein bisschen Zeit mit deinem Enkel verbringen. Ich hab gerade einen Wahnsinnsdruck mit dem Projekt. Und ich muss nachts mehrmals raus, Felix hat Alpträume. Ich bin ziemlich erledigt.«
»Kind, das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, du kommst zur Beerdigung.« Lea hatte den Ehrgeiz ihres Vaters geerbt. Einen stressigen Job in München und ein zweijähriges Kind, da hatte sie natürlich alle Hände voll zu tun. Sie hatte Felix spät bekommen, mit achtunddreißig, und nur drei Monate pausiert. Ich dagegen hatte Amila, die mir schon bei meinem Erstgeborenen mit Kind und Haushalt geholfen hatte, dabei war ich nicht einmal berufstätig. Wie sollte ich da kein Verständnis haben?
Jan
Stuttgart-Vaihingen
Ich bog in unsere Straße ein. Alles sah aus wie immer. Wie es eben aussieht in einer schwäbischen Einfamilienhaussiedlung im Speckgürtel von Stuttgart: Frei stehende Häuser mit gepflegten Gärten drum rum, Terrassen mit Rattanmöbeln, Balkone mit Blumenkästen, Riesentrampoline, Rasensprenger, Garagen für Familienkutschen und am Straßenrand der Zweitwagen für die Frau. Keine Ausländer, höchstens mal ein Italiener der zweiten Generation. Schon gar keine Flüchtlinge. Solide Schwaben, die hier gebaut hatten, oder die Kinder dieser soliden Schwaben, oder Schwaben, die sich eingekauft hatten. War ja eine super Geldanlage, so wie die Immobilienpreise in Stuttgart zurzeit stiegen, und dann noch die Nähe zum Freibad Rosental, ein unschlagbarer Standortvorteil.
Es war einfach schön.
Es war einfach grauenhaft.
Ich musste an meine WG-Zeit in Tübingen denken, Ende der Achtziger, ich studierte Philosophie, mein Zimmer, zwölf Quadratmeter. Wir waren zu fünft. Jeden Abend saßen wir in der Küche, rauchten alles Mögliche, tranken Bier und verbesserten die Welt. Wir hängten weiße Tücher aus den Fenstern gegen den Irakkrieg, wir wollten nach Nicaragua zu den Sandinisten, in den australischen Busch oder nach Asien. Wir kämpften für den Frieden, gegen die Raketenstationierung der Amis in Mutlangen, gegen den Konsum, und vor allem schworen wir uns, niemals spießig zu werden. Einfamilienhäuser im Speckgürtel von Stuttgart, nörgelnde Teenies, totgelaufene Ehen oder ein Job bei einem Automobilzulieferer kamen in unseren Visionen nicht vor. In unseren Visionen ging es bunt, alternativ und turbulent zu. Und vor allem glücklich. Nicht glücklich zu werden, das war völlig ausgeschlossen.
Ich hielt vor dem Haus, fuhr aber nicht in die Einfahrt, sondern blieb mit laufendem Motor auf der Straße stehen. Aus dem Nachbargarten stiegen graue Rauchschwaden auf, Klaus hatte die Grillkohle schon angezündet. Er winkte mir mit dem Föhn zu, ein paar Leute standen mit Gläsern oder Bierflaschen in der Hand herum, winkten ebenfalls und grinsten. Ich wusste schon vorher, worüber man reden würde. Wetter, Urlaub, Smartphones, Flüchtlinge. Ich drückte auf die Fernbedienung für die Garage, und das Tor schwang auf.
Jan. Du fährst jetzt sofort in die Einfahrt, hörst du? Erst in die Einfahrt und dann in die Garage. Dann steigst du aus, vergisst den französischen Rotwein nicht, den du heute Mittag bei Rewe gekauft hast, gehst in Haus, sagst Christine höflich hallo und versuchst, nicht mit ihr zu streiten, hörst du, obwohl sie die Rotweinsorte kritisieren wird, und dann tauschst du – aber hopp, hopp – deinen Anzug gegen die olivgrünen Bermudas, ein T-Shirt und die Sneakers, die Christine für dich gekauft hat, obwohl du am liebsten Jeans tragen und barfuß laufen würdest, und vergiss bloß nicht, dir mit dem Kamm durch die Haare zu fahren, und dann schaust du kurz nach den Mädchen und versuchst, nicht mit ihnen zu streiten, und dann gehst du mit Christine und dem Rotwein zu den Nachbarn, ohne zu streiten. Hörst du, Jan? Du fährst jetzt in die Einfahrt!
Ich blieb, wo ich war, mit laufendem Motor auf der Straße. Das Handy klingelte. Die Haustür ging auf. Christine stand in der Tür, das Telefon am Ohr, und machte mit der freien Hand eine auffordernde Bewegung in meine Richtung. Auffordernd und vorwurfsvoll.
Ich stellte das Handy ab. Dann fuhr ich in unsere Einfahrt, rollte rückwärts wieder heraus, und ohne einen weiteren Blick auf Christine oder die Nachbarn zu werfen, fuhr ich gemächlich zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Als ich nach rechts abbog, konnte ich für eine Zehntelsekunde Christine im Rückspiegel erkennen. Sie war auf die Straße gelaufen und blickte mir fassungslos hinterher, den Arm mit dem Handy in der Hand steil nach oben gereckt. Mir fiel ein Bild aus dem Lateinunterricht ein: Die Rachegöttin Tisiphone schwingt die Fackel des Wahnsinns. Dann verschwand Christine aus meinem Blickfeld.
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Günther war ja eine stadtbekannte Persönlichkeit in Stuttgart, obwohl er ein Reigschmeckter war, und sein Tod löste entsprechende Reaktionen aus. Die Todesanzeigen in der Stuttgarter Zeitung füllten anderthalb Seiten. Baufirmen, Handwerksunternehmen, der Tennisclub, die IHK und die CDU, sogar die Stadt Stuttgart, weil Günther in der Stadt so viel gebaut hatte. »Mit großer Betroffenheit … völlig unerwartet … unser hochgeschätzter Partner Günther Engel … wir werden ihn sehr vermissen …« Blumen und Beileidskarten trafen ein. Hunderte von Menschen kamen zur Beerdigung auf dem Pragfriedhof. Sie legten riesige Kränze nieder, sie schüttelten mir die Hände, sie murmelten etwas von »Herzlichem Beileid« oder »Es war für uns alle ein Schock« und »Wir bleiben natürlich in Kontakt«.
Dann hörte ich nie mehr von ihnen.
Die schlimmste Zeit kam nach der Beerdigung. Obwohl Günther so wenig zu Hause gewesen war, war ich doch um ihn gekreist wie die Erde um die Sonne. Irgendwann würde ich mich um die Firma kümmern müssen, aber es gab ja den Geschäftsführer, und er hatte mir versichert, dass es keinen akuten Handlungsbedarf gab. »Alles wird in Herrn Engels Sinne weiterlaufen, das verspreche ich Ihnen. Kommen Sie wieder auf die Beine nach dem Schock, Frau Engel, dann sehen wir weiter.« Ich hatte meine vielen Ehrenämter, und natürlich wäre es mir nicht im Traum eingefallen, diese aufzugeben, aber mir machte nichts mehr Freude, nicht einmal mehr meine Bridge-Gruppe für die Senioren im Haus am Killesberg. Ich ging auch immer seltener zum Gottesdienst. Normalerweise ging ich sonntags in die Brenzkirche, aber ausgerechnet jetzt, wo ich den Glauben so dringend gebraucht hätte, gab er mir keinen Halt. Alles war so leer und sinnlos, das große Haus machte es nicht besser. Lea schob ihren Besuch immer weiter hinaus, ständig kam etwas dazwischen.
»Sie gefallen mir gar nicht«, sagte Dr. Dillinger, mein Hausarzt. »Ich verschreibe Ihnen jetzt etwas gegen die Depression.« Depression, wieso gebrauchte er dieses Wort? Andere Leute hatten Depressionen, aber doch nicht ich. Ich hatte keine Depression. Ich trauerte. War das nicht völlig normal, nach vierundvierzig Ehejahren?
Heiderose drängte mich, Günthers Sachen auszusortieren. »Ich kann dir doch dabei helfen. Du musst dich von Ballast befreien, danach wird es dir bessergehen.« Ich wimmelte sie immer wieder ab. Ich war noch nicht so weit. Manchmal öffnete ich Günthers Kleiderschränke und strich über seine Anzüge, teure Anzüge von Boss, die wir gemeinsam im Fabrikverkauf in Metzingen gekauft hatten, um fast die Hälfte reduziert. Günther guckte nicht so auf den Preis, aber ich war der Meinung, es gab keinen Grund, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen, auch wenn wir genug davon hatten. Ich konnte mich nicht von den Anzügen trennen, ich nahm sie einzeln heraus und versuchte mich zu erinnern, zu welchem besonders festlichen Anlass Günther welchen Anzug getragen hatte.
Ich steckte in einem tiefen, dunklen Loch, und zum Herauskriechen fehlte mir die Kraft.
Eines Samstagabends Ende Juli saß ich im Wohnzimmer. Es war noch immer sehr heiß. Es war so ein Abend, an dem wir eine Einladung gegeben hätten. Günther hätte Schweinesteaks vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein gegrillt, die ich in der Markthalle besorgt hätte, dazu das knusprige italienische Landbrot von Di Gennaro, Amila hätte Kartoffelsalat gemacht, und Lily, die halbwüchsige Tochter unserer Nachbarin, hätte für ein paar Euro die Stunde Günthers französischen Lieblings-Champagner und Häppchen gereicht. Langsam kroch die Dämmerung ins Wohnzimmer, unten in der Stadt gingen die Lichter an, und ich weinte und dachte an Günther. Ich weinte und fragte mich, wie mein Leben ohne ihn weitergehen würde, wie ich all die endlosen Stunden, Tage, Wochen und Monate überstehen sollte, die vor mir lagen, allein. Ich war sechsundsiebzig Jahre alt und kerngesund, es sah nicht so aus, als würde ich demnächst sterben. Hier und jetzt brauchte ich einen Neuanfang, wenn ich nicht verrückt werden wollte, hier und jetzt würde ich damit beginnen, Günthers Sachen auszumisten. Ich begann in seinem Arbeitszimmer. Und so fand ich die Briefe.
Sabrina
Stuttgart, Pfaffenwald
Ich brettere mit dem Mountainbike durch den Wald. Panik, Panik, Panik. Der Schweiß rinnt mir zwischen den Schulterblättern hinunter, ich zerfließe, dabei ist die größte Hitze des Tages vorbei, und ich trage nur ein ärmelloses Funktionsshirt und eine kurze Hose. Bloß heim. Alles abwaschen. Wo bin ich überhaupt? Da unten, die Bärenseen. Dieses schreckliche Durcheinander in meinem Kopf, es ist kaum auszuhalten, es dröhnt und plärrt nur so, ich kann mich gar nicht auf den Weg konzentrieren. Der Einzige, der das Durcheinander sortieren und das Dröhnen und Plärren zum Verstummen bringen kann, ist Oliver, er kann in meinen Kopf gucken wie in ein aufgeschlagenes Buch. Fünf Minuten, es wird höchstens fünf Minuten dauern, dann weiß Oliver, was mit mir los ist, ohne dass ich auch nur den Mund aufmache. Aber ausgerechnet Oliver ist jetzt der Letzte, der mir helfen kann.
Die Abfahrt runter zu den Bärenseen ist steil, der kürzeste Weg nach Hause. Nach Hause will ich, so schnell wie möglich. Ich fühl mich so schmutzig. Duschen, was essen, nichts mehr denken und vor allem nicht ans Telefon gehen. Oliver eine SMS schicken. Hab Migräne, muss gleich ins Bett, meld mich morgen, Kuss, Sabrina. Blöd nur, dass ich nie Migräne habe.
Ich klingele wie wild, dabei ist Radfahren hier eigentlich verboten. Fußgänger und Jogger machen genervt Platz. Warum holpert das plötzlich dermaßen, die Strecke ist doch gar nicht so uneben! Ich springe ab, der Hinterreifen ist platt. Na toll. Ich fluche, direkt neben einer Mutter mit Kinderwagen, laut, ausgiebig und so dreckig ich nur kann. Danach geht’s mir besser. Die Mutter sieht mich strafend an. Dabei ist das Kind gerade mal ein paar Monate alt und versteht sowieso nichts. Natürlich hab ich kein Flickzeug dabei. Ich wollt ja nur eine Runde Mountainbiken, sonst nichts. Nach Vaihingen zur Uni zu fahren war nicht geplant, Oliver, ehrlich, das musst du mir glauben! Kein Radfahrer weit und breit. Rad zum Parkplatz schieben, noch mehr Schweiß. Vielleicht ist hier jemand mit Flickzeug? Die Autos stehen dicht an dicht, ist ja auch kein Wunder an einem warmen Sommerabend, ein paar Läufer machen Dehnübungen, Spaziergänger schlendern Richtung See, Radfahrer Fehlanzeige. Alles und alle so normal. Bloß ich nicht. Bloß ich mit den ganzen Spaghetti im Kopf.
Ich lehne das Bike an einen Baum und laufe die Reihe der Autos ab. Große, schicke Autos ohne Ende, schließlich sind wir in Stuttgart. Großes, schickes Auto, dessen Fahrer, ohne mit der Wimper zu zucken, ein eingesautes Mountainbike einladen würde, kein einziges. Dabei will ich nur noch heim. Mich verkriechen. Ein paar Tabletten mehr nehmen als sonst. Da, zwischen einem Mercedes und einem SUV eine Familienkutsche, ein Renault Kangoo. Nicht übertrieben sauber und groß genug, um ohne Umbauten ein Fahrrad hinten reinzupacken. Und mit Stuttgarter Kennzeichen! Sitzt da nicht sogar jemand drin? Zurück zum Rad sprinten, dann mit dem Rad wieder zum Auto. Am Steuer sitzt ein Typ im Anzug, raucht zum Fenster raus und starrt ins Leere. Nicht mehr ganz jung. Sieht nicht so aus, als ob er sich fürs Joggen interessiert.
»Hallo.«
»Ja?« Er fährt zusammen und kriegt einen Hustenanfall. Offensichtlich hab ich ihn gerade von woanders zurückgeholt. Ich kenn das gut. Ich bin auch oft da, wo woanders ist.
»Sorry, ich wollt Sie nicht erschrecken. Sie fahren nicht zufällig demnächst runter in den Stuttgarter Süden? Ich muss zum Marienplatz, und mein Mountainbike hat einen Platten.«
»Marienplatz.« Jetzt guckt er mich an, als ob ich ihn gefragt hätte, ob er mich nach Timbuktu mitnehmen könnte.
»Ja, genau. Wissen Sie, wo das ist?«
»Natürlich weiß ich, wo das ist.« Er klingt genervt. Dann nimmt er einen letzten Zug aus der Zigarette, hustet noch mal, schnippt die Kippe aus dem Fenster, was ich jetzt nicht so doll finde, springt aus dem Auto, nimmt mir ohne ein Wort das Rad ab, geht um das Auto herum, öffnet die Heckklappe und legt das Rad mit einem einzigen, geübten Handgriff hinein. Dann kommt er zurück. Er hat sich die Anzughose mit Fahrradschmiere eingesaut. Er scheint es nicht zu bemerken. Ich sag nichts, ich bin bloß erleichtert.
»Steigen Sie ein.«
»Das ist supernett. Vielen Dank.« Ich kletter auf den Beifahrersitz und reiche ihm eine Packung Gauloises, die auf dem Sitz liegt. Es riecht nach Rauch. Igitt. Auf dem Rücksitz liegen ein paar Handtücher und Bikiniteile.
»Meine erste Zigarette seit fünfzehn Jahren«, kommentiert der Typ düster, legt den Rückwärtsgang ein, stößt ein Stück zurück und wartet auf eine Lücke im dichten Verkehr.
»Wohnen Sie auch im Stuttgarter Süden?«, frage ich. Irgendwas müssen wir ja reden. Er schüttelt den Kopf.
»Nein. Ich wohne in Vaihingen.« Er fädelt sich in den Verkehr ein.
»Aber dann ist das doch die falsche Richtung!«
»Macht nichts. Ich habe gerade nichts zu tun.« Ich zucke zusammen. Also das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Er sieht meinen Blick. Zum ersten Mal lächelt er.
»Keine Sorge. Ich bin ziemlich harmlos.« Rein vom Aussehen hätte ich ihn jetzt auch nicht als gefährlich eingeschätzt. Er ist so um die fünfzig. Bierbauch, noch überschaubar, Haare, sehr überschaubar. Er sieht aus wie ein netter Langweiler. Oder lieber ein langweiliger Netter? In meinem Kopf streiten sich die Stimmen, was besser passt. Schnauze dadrin, sag ich.
»Wie bitte?«
»Ach, nichts«, antworte ich hastig. Ich hab mich echt nicht im Griff.
Er fährt aus dem Kreisverkehr heraus und den Berg hinunter.
»Wieso haben Sie nichts zu tun? Ich meine, es geht mich natürlich nichts an … aber das Auto sieht so aus, als ob in Vaihingen Frau und Tochter auf Sie warten.« Halt die Klappe, Sabrina, denke ich. Warum mischst du dich in das Leben anderer Leute ein? Kümmer dich lieber um deinen eigenen Kram! Aber das ist es ja gerade. Es ist wie in der Schule. Wenn ich mich um die Kinder kümmere, verstummen die Stimmen in meinem Kopf.
»Richtig getippt.« Er seufzt. »Wenn Sie’s genau wissen wollen: Ich sollte jetzt eigentlich bei den Nachbarn zum Grillen sein, mit meiner Frau. Als ich zu Hause ankam, hab ich einen Koller gekriegt und bin einfach abgehauen.«
»Kurzschlussreaktion. Das kann doch jedem mal passieren!«, erkläre ich, superduper enthusiastisch. »Und jetzt tun Sie eine gute Tat und fahren mich heim. Sie könnten einen kleinen Spaziergang machen und Ihren Kopf auslüften, oder Sie trinken ein Bierchen am Marienplatz, und dann stoßen Sie ein bisschen verspätet zum Grillen dazu, und alles ist wieder gut.« Ich wirke total normal. Der Kerl muss denken, ich bin normal!
Er schüttelt den Kopf. »Ich werde nicht heimfahren. Ich haue für ein paar Tage ab. Ich brauche Abstand. Ich muss nachdenken.«
»Sie hauen ab? Einfach so?«
»Einfach so.«
»Wow.« Abhauen. Prima Idee. Wenn es bloß so einfach wäre. »Und Ihre Frau und das Kind? Und müssen Sie morgen nicht arbeiten?«
Er zuckt mit den Schultern. »Die werden alle mal ein paar Tage ohne mich klarkommen müssen. Meine Frau, meine zwei pubertierenden Töchter und die Arbeit.«
»Und wo wollen Sie hin?«
»Keine Ahnung. Also das mit dem Abhauen hab ich mir grad erst überlegt, als Sie an die Scheibe geklopft haben. Die Idee ist noch … sagen wir, ziemlich frisch.« Er sieht ein bisschen verlegen aus.
»In den Süden! Ans Meer! Abends irgendwo Fisch essen, mit Blick auf einen schnuckeligen Hafen, in einer urigen Pension übernachten, morgens in einer Bar frühstücken … und nach ein paar Tagen kommen Sie zurück, mit frisch aufgeladenen Batterien!«
Jetzt muss er grinsen. Bestimmt merkt er nicht, dass ich verrückt bin.
»Nett, dass Sie sich so reinhängen. Bloß, Süden ist nicht so meins. Vor allem nicht im Sommer! Mir ist es ja schon in Stuttgart zu heiß. Eigentlich wollte ich Richtung Norden. Vielleicht sogar bis zum Nordkap.«
»Im Anzug zum Nordkap?«
»Metzingen, Boss, Fabrikverkauf. Morgen besorge ich mir ein paar Outdoorklamotten.«
»Weiß Ihre Frau Bescheid? Dass Sie nicht nach Hause kommen, meine ich?« Schnauze, Schnauze, Sabrina, das geht dich doch nichts an! Das ist ein erwachsener Mann, kein türkisches Kind in deiner Klasse! Er schweigt. Wir fahren jetzt durch den Tunnel. Es ist nicht mehr weit bis zum Marienplatz. Es hätte ruhig ein bisschen weiter sein können.
»Wo soll ich Sie rauslassen?«
»Wo Sie am besten halten und das Rad ausladen können. Ich wohne in der Tübinger Straße.« Wir fahren aus dem Tunnel, er biegt nach links ab, dann fährt er nach rechts und ein Stückchen geradeaus und hält. Ohne es zu wissen, hat er direkt vor meinem Haus geparkt, auf der anderen Straßenseite. Ich ducke mich tief in den Sitz. Oliver schließt gerade meine Haustür auf. Das ist nicht so einfach, denn er trägt in der einen Hand einen eingewickelten Blumenstrauß und in der anderen eine Tüte mit Lebensmitteln. Er hat gesagt, er würde heute lange in der Schule bleiben, wegen der Lehrpläne für den Herbst, und dann in seiner eigenen Wohnung übernachten. Offensichtlich hat er seine Pläne geändert. Wieso bloß? Oliver weicht nie von dem ab, was er sagt (ganz im Gegenteil zu mir), von Überraschungen hält er überhaupt nichts (ganz im Gegenteil zu mir). Und wieso Blumen? O shit. Vor genau einem Jahr haben wir uns in der Schule kennengelernt, da hab ich mich vorgestellt. Auch das noch! Wenn ich jetzt aussteige, dann muss ich Oliver, der mit Blumen auf mich wartet, gestehen, dass ich mit dem evangelischen Relilehrer im Bett war, der auch noch sein bester Freund ist, und nicht weiß, ob ich ihn liebe. Also Oliver. Dass ich Kai nicht liebe, weiß ich. Das ist doch schon mal was! Auch wenn es für Oliver vielleicht anders aussieht. Aber wenn ich Kai nicht liebe, wieso war ich dann mit ihm im Bett? Wieso tue ich Oliver das an? Und der Sex war nicht einmal gut. Um ehrlich zu sein, er war beschissen. Die Panik wird jetzt schlimmer. Ich brauche meine Tabletten. Dringend.
Wir stehen schon eine ganze Weile. Der Mann scheint eine ziemliche Geduld zu haben. Jetzt sieht er mich an, fragend.
»Ist es hier okay?«
»Super. Eigentlich. Könnten Sie vielleicht noch ein paar Meter weiterfahren?«
Er fährt ein kleines Stückchen weiter und hält. Ich schließe die Augen und versuche, ruhig in den Bauch zu atmen, so, wie wir es im Yogakurs in meinem Fitnessstudio immer üben. Erst tief in den Bauch, dann weiter in die Brust und bis zu den Schlüsselbeinen. Der Atem bleibt irgendwo unterwegs hängen, und ich muss husten. Passiert mir im Yogakurs auch immer. Ich gucke in den Rückspiegel. Oliver ist im Haus verschwunden.
»Alles in Ordnung? Wollen Sie hier raus? Ist Ihnen nicht gut?«
»Ich will gar nicht raus. Nur kurz das Rad ausladen. Nehmen Sie mich ein Stückchen mit, Richtung Nordkap?«
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
»Engel …«
»Mama, endlich! Was ist los, bist du krank? Wieso gehst du nicht ans Telefon? Ich rufe jetzt schon zum fünften Mal an! Hast du unser Sonntagstelefonat vergessen? Ich hab gedacht, dir sei was passiert, ich war kurz davor, die Polizei zu alarmieren!«
»Es tut mir leid, Lea. Ich … ich hab’s völlig vergessen … wie spät ist es?«
»Mama, es ist zwölf Uhr am Sonntagmorgen, seit drei Stunden versuche ich, dich zu erreichen, was ist los? Du weinst doch nicht, oder? Wieso weinst du? Was ist passiert?«
»Ich … ich kann nicht darüber reden … es ist zu schrecklich …«
»Mama, bitte! Du sagst mir jetzt, was los ist, und zwar sofort!«
»Bitte, Lea, zwing mich nicht …«
»Sag mir wenigstens, um was es geht! Bist du krank? Hast du Krebs?«
»Es geht nicht um mich, es geht … um deinen Vater …«
»O mein Gott.«
»… aber ich glaube, es ist besser, ich behalte es für mich …«
»Du weißt es. Du hast es herausgefunden …«
»Was soll das heißen … hast du es etwa … du hast es gewusst?«
»Es tut mir so schrecklich leid, Mama. Wir haben gehofft, dass du es nie erfährst.«
»Wir? Aber … wer ist wir?«
»Wir Kinder eben.«
»Ihr wusstet Bescheid? Ihr wusstet alle Bescheid? Elias, Daniel und du?«
»Ja. Und unsere Partner natürlich.«
»Die auch?«
»Du kannst ja wohl kaum erwarten, dass man so was mit sich allein ausmacht!«
»Das ist so … so demütigend …«
»Mama. Es war so offensichtlich! Direkt vor deiner Nase! Aber du warst so blind, du wolltest es einfach nicht sehen. Da hielten wir es für besser, dir nichts zu sagen. Wir wollten dir nicht weh tun, das war der einzige Grund, glaub mir!«
»Ihr habt es gewusst, und ihr habt mir nichts gesagt? Zehn Jahre lang?«
»Also, so lang wissen wir es noch nicht. Sieben, acht Jahre höchstens. Und wir haben Vater immer wieder beschworen, damit aufzuhören … und er hat es immer wieder hoch und heilig versprochen, und wir haben ihm geglaubt.«
»Ihr habt mich betrogen. Ihr alle, nicht nur Günther. Meine Kinder wussten alle Bescheid. Und wer noch?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es noch mehr Leuten aufgefallen. Amila meinte jedenfalls, sie könne es schlecht abschätzen.«
»Amila? Amila weiß es auch? Und der Briefträger?«
»Mama, nicht weinen, bitte! Wir wollten dir doch nur den Schmerz ersparen. Du hast Vater immer auf ein Podest gestellt, du wolltest seine Schwächen nicht sehen! Ich meine, wie viel Geschäftsessen kann ein Mensch in der Woche haben? Trotzdem hast du nie auch nur den allerleisesten Verdacht gehabt. Warum sollten wir dir diese Illusion wegnehmen und dich unglücklich machen? Mama, leg nicht auf! Mama … Mama?«
Jan
Raststätte Wunnenstein
»Ist ja nett, dass du ans Telefon gehst. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Kannst du mir vielleicht verraten, was diese Aktion sollte? Warum blamierst du mich dermaßen vor den Nachbarn? Und dann stellst du das Handy ab?«
»Es tut mir leid, Christine.«
»Kommst du jetzt vielleicht mal langsam nach Hause? Wo treibst du dich überhaupt rum?«
»An der Raststätte Wunnenstein.«
»Bitte wo? Was machst du da? Bier trinken? Musst du dafür bis fast nach Heilbronn fahren? Hätt’s da nicht die Bahnhofskneipe in Vaihingen getan?«
»Ich brauche ein paar Tage Abstand.«
»Was soll das heißen, ein paar Tage?«
»Na, ganz einfach. Ich komme erst mal nicht nach Hause, ich fahre ein paar Tage weg.«
»Du fährst weg, mit dem Auto? Unserem Auto? Einfach so? Du kommst heute nicht mehr heim? Und wie bringe ich Nele morgen zum Handballturnier?«
»Ich kündige an, dass ich ein paar Tage wegfahre, und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist das Handballturnier morgen, sonst nichts?«
»Soll ich etwa sagen, super Idee? Wieso haust du einfach ab?«
»Weil ich total frustriert bin, verdammt noch mal!«
»Und ob ich frustriert bin, interessiert dich das vielleicht? Weil ich mich ständig mit den Mädels rumschlage, während du gemütlich im Büro sitzt! Und wenn du jetzt abhaust, hängt noch viel mehr an mir! Wie stellst du dir das vor? Und was ist überhaupt mit deiner Arbeit?«
»Ich melde mich krank.«
»Und was ist mit mir?«
»Nicht weinen, Christine. Bitte, nicht weinen. Ich brauche einfach ein paar Tage Abstand. Nichts weiter. Dann komme ich zurück, wir reden, und alles wird wieder gut.«
»Nichts wird gut. Da ist doch eine andere Frau im Spiel! Der Klassiker. Midlife-Crisis. Du hast dich in eine Jüngere verliebt, kurz vor deinem fünfzigsten Geburtstag. Wie oft hatten wir das in letzter Zeit im Freundeskreis? Sei wenigstens ehrlich!«
»Da ist keine andere Frau. Wirklich nicht, Christine!«
»Bist du allein?«
»Natürlich! Total allein! Christine, bitte, gib mir einfach ein paar Tage Zeit. Nur ein paar Tage!«
»Sag mir wenigstens, wo du hinfährst!«
»Ich … ich weiß es noch nicht.«
»Das ist so was von egoistisch. Ich habe dafür null Verständnis, aber absolut null!«
»Ich melde mich wieder.«
»Jan. Jan, warte! Leg nicht auf! Jan … Jan?«
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Amila hatte mir immer von den Fernbussen vorgeschwärmt, sie fuhr damit zu ihrer Tochter nach Berlin. »Billig und bequem!« Sie kaufte die Fahrkarten in einem Reisebüro auf der Königstraße, weil sie sich mit dem Internet nicht auskannte, da ging es ihr genauso wie mir. Nach ein paar Tagen in Schockstarre nahm ich am Mittwoch früh den 44er Bus hinunter zum Hauptbahnhof, ging zum Reisebüro und kaufte für den nächsten Morgen einen Fahrschein, Abfahrt Zuffenhausen acht Uhr. Ich fuhr sofort zurück nach Hause und gab Amila ohne weitere Erklärungen ein paar Tage frei.
»Wann kommen Sie wieder, Frau Engel?«
»Ich weiß es nicht. Ich rufe Sie an, sobald ich zurück bin.«
»Sagen Sie mir wenigstens, wo Sie hinfahren! Sie haben doch nicht einmal ein Handy, wie soll ich Sie denn erreichen, wenn etwas ist!« Amila klang beinahe verzweifelt.
»Nein, Amila, das möchte ich nicht. Es wird schon nichts sein. Ich mache die Alarmanlage an.«
»Und der Garten? Es ist doch so heiß. Die Rosen gehen kaputt, und der Rasen. Jemand muss gießen!« Amila fragte nicht, ob Heiderose zum Gießen kam. Dabei hatte Heiderose immer gegossen, wenn wir verreisten. Bestimmt hatte Lea Amila angerufen. Sie war den ganzen Morgen ungewöhnlich still gewesen. Jetzt wusste sie, dass ich sie für ihren Verrat bestrafte, weil ich ihr nicht sagte, wo ich hinfuhr. In all den Jahren hatte es nie auch nur eine einzige Unstimmigkeit zwischen Amila und mir gegeben. Ein Vertrauensverhältnis. Das hatte ich jedenfalls bis gestern geglaubt.
Sabrina
Raststätte Wunnenstein
lieber olli liebster olli es tut mir so leid ich hätt es dir gern selber gesagt und nicht dass du es von kai erfährst bitte bitte verzeih mir es ist einfach so passiert und hat nichts zu bedeuten ich liebe kai nicht aber ich brauch abstand nur ein paar tage mach dir keine sorgen mir gehts gut echt ich mag doch nur dich aber ich muss ein bisschen nachdenken ich meld mich wieder sabrina
Luise
Stuttgart, Feuerbacher Heide, Villa Engel
Das Taxi kam um sieben Uhr. Ich schaltete die Alarmanlage ein, schloss alles sehr sorgfältig ab und stieg ins Taxi, ohne mich noch einmal umzudrehen. Ich hatte ein seltsames Gefühl, fast wie eine Vorahnung. Nicht so, als ob ich nur ein paar Tage verreiste, sondern so, als ob in meinem Leben ein neues Kapitel beginnen würde. Mir war mulmig zumute. Am Busbahnsteig in Zuffenhausen stand ein giftgrünes Ungetüm, drum herum standen Leute mit Gepäck und warteten. Als der Taxifahrer meinen Koffer zum Bus trug, starrten mich die Leute an, erstaunt und belustigt. Da wurde mir erst klar, dass man hier mitfuhr, um Geld zu sparen. Das Taxi hatte fast so viel gekostet wie die Fahrkarte! Außerdem fiel ich in meinem schwarzen Kostüm völlig aus dem Rahmen. Die meisten Fahrgäste waren jung und trugen Jeans und Kapuzenpullis oder T-Shirts und kurze Hosen. Das war auch viel vernünftiger. Obwohl es erst halb acht war, war es schon sehr heiß. Der Taxifahrer stellte den Koffer ab und verschwand eilig. Um mich herum schoben die jungen Leute hektisch ihr Gepäck in den Bauch des Busses. Offensichtlich machte man das hier selbst. Mühsam verstaute ich meinen Koffer, niemand kam mir zu Hilfe, und ich mochte auch nicht fragen. Einen Augenblick lang dachte ich nervös an das Bargeld zwischen meinem Formhöschen und dem Kulturbeutel. Vielleicht hätte ich es doch lieber bei mir behalten sollen?
Mittlerweile hatte sich am Einstieg des Busses eine Menschentraube gebildet. Ich stellte mich hinten an, kam aber nicht voran, weil sich ständig Fahrgäste von der Seite vordrängelten. Endlich scannte der Busfahrer mein Ticket mit seinem Handy ein. Es kam mir unglaublich modern vor. »Freie Platzwahl«, erklärte er.
Ich fand noch einen einzelnen Fensterplatz und hoffte, dass ich allein bleiben würde, weil mir nicht nach Unterhaltung war, aber nach ein paar Minuten tauchte eine junge Frau mit einem Geigenkasten auf.
»Ist hier noch frei?«
Ich nickte. Sie verstaute den Geigenkasten in der Gepäckablage und ließ sich auf den Sitz am Gang fallen.
»Ganz schön viel los für die Uhrzeit«, sagte sie.
»Sind Sie Musikerin?«
Sie nickte.
»Ich spiele Bratsche in einem Streichquartett, wir geben heute Abend ein Konzert in Würzburg. Um elf ist Probe, ich hoffe, wir sind pünktlich.«
»Wie interessant! Was spielen Sie heute Abend?« Sie erzählte vom Konzert, von ihrer Liebe zu Brahms, von ihrer Tätigkeit an einer Musikschule und davon, wie mühsam es war, als freiberufliche Musikerin mit Auswärtsterminen einen Sohn allein zu erziehen. Das Gespräch floss locker dahin; ich war erstaunt, wie leicht es mir fiel. Ich hatte selten Kontakt zu fremden Leuten. Vor allem aber erstaunte mich, dass sich diese junge Frau offensichtlich gern mit mir unterhielt. Überhaupt war es angenehm entspannt im Bus.
»Und Sie, wo fahren Sie hin?«
»Hamburg.«
»Ganz allein? In Ihrem Alter?« Sie wurde rot. »Entschuldigen Sie. War nicht so gemeint. Aber Sie sehen nicht aus wie jemand, der regelmäßig Fernbus fährt.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ja, ich bin allein unterwegs. Mein Mann ist kürzlich verstorben.« Automatisch stiegen mir die Tränen in die Augen. Wieso eigentlich? Das Schwein. Spontan legte sie mir die Hand auf den Arm.
»Deshalb die schwarze Kleidung. Das tut mir sehr leid.«
»Eigentlich sollte ich froh sein. Er hat mich mit meiner besten Freundin betrogen, jahrelang.« Sie starrte mich mit offenem Mund an. »Ich habe es gerade erst herausgefunden.«
»Und Sie haben nichts geahnt?« Ich schüttelte den Kopf. Und dann erzählte ich ihr alles. Es brach aus mir heraus, als hätte jemand eine Schleuse geöffnet. Wie ich in Günthers Arbeitszimmer, seinem Allerheiligsten, das nur Amila zum Putzen betreten durfte, die Briefe gefunden hatte, die Heiderose ein Jahrzehnt lang geschrieben hatte, Seite um Seite, ordentlich gestapelt und chronologisch sortiert wie Geschäftsunterlagen; sie musste sie an Günthers Büro adressiert haben. Der älteste Brief war zehn Jahre alt, darin offenbarte Heiderose, dass sie seit Jahren unsterblich in Günther verliebt sei und nicht länger schweigen könne, auch wenn es sich um den Mann ihrer besten Freundin handle. Unmittelbar darauf hatte eine Affäre begonnen, die bis zu Günthers Tod andauerte, der letzte Brief war zwei Tage vor seinem Herzinfarkt datiert, und der Tonfall war noch genauso leidenschaftlich und inbrünstig wie in den ersten Briefen. Günther und Heiderose! Mir wurde beim Lesen schlecht. Heiderose rekapitulierte die Liebesnächte mit Günther wie in einem billigen Groschenroman. Dabei war Heiderose dick, und Günther hatte immer großen Wert auf meine schlanke Linie gelegt, und mich sofort darauf hingewiesen, wenn ich mal ein Pfund zu viel hatte!
Sie trafen sich in einer Wohnung im Hallschlag, nicht gerade die beste Gegend von Stuttgart, aber dort bestand weder für Günther noch für Heiderose die Gefahr, erkannt zu werden. Von den zahlreichen Geschäftsessen, die Günther angeblich an den Abenden absolvierte, hatte es nur einen Teil gegeben. Heiderose, meine beste Freundin aus Kindertagen, Freundin der Familie, Patin von Elias, Heiderose, die mich nachts im Katharinenhospital abgeholt hatte, Heiderose, die mir in den Tagen nach Günthers Tod beigestanden war, stets gefasst. Erst am Grab hatte sie geweint, hemmungslos, aber schließlich war sie seit Jahrzehnten mit Günther befreundet, und ich war zu sehr mit mir selber beschäftigt gewesen, um mir etwas dabei zu denken.
Am frühen Sonntagmorgen, ein paar Stunden nach dem Fund der Briefe, immer noch unter Schock, rief ich Heiderose an und stellte sie zur Rede. Aber Heiderose schämte sich nicht einmal.
»Verstehst du nun, warum ich dir beim Ausmisten helfen wollte? Ich wollte dir den Schmerz ersparen. Ich hätte die Briefe verschwinden lassen, wenn ich sie vor dir gefunden hätte. Ich dachte mir, dass sie im Arbeitszimmer sind.«
»Ihr habt mich jahrelang belogen, Günther und du«, weinte ich in den Hörer. »Mein Mann und meine beste Freundin!«
»Er hat dich trotz allem nie verlassen. Obwohl ihr keinen Sex mehr hattet.«
»Aber wir waren doch glücklich! Auch ohne … Sex! Sex spielt in einer langjährigen Ehe keine Rolle mehr! Da geht es um Vertrauen und Treue!« Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich das Wort Sex laut aussprach.
»Luise«, flüsterte Heiderose. »Günther liebte Sex. Er war der sinnlichste, leidenschaftlichste Mann, den ich kannte. Glaubst du im Ernst, ein Mann kann jahre-, um nicht zu sagen jahrzehntelang ohne Sex auskommen?«
»Jahrzehntelang«, schluchzte ich. »Das ist doch total übertrieben!«
»Ist es nicht. Du hattest zum letzten Mal Sex mit Günther vor fünf Jahren, nach der Feier zu seinem siebzigsten Geburtstag. Ihr wart beide betrunken, was bei dir die Ausnahme und bei Günther die Regel war. Wir Gäste waren schon gegangen, da bist du in deiner langen Abendrobe in den Pool gefallen, und Günther hat dich herausgefischt. Dann wart ihr beide so albern, dass ihr auf den Fliesen des Pools Sex hattet. Einmal Sex in zehn Jahren, das hat Günther mir gesagt, und hinterher war es euch beiden peinlich. Ihm war es sogar mir gegenüber peinlich.«
»Das ist gelogen«, flüsterte ich. »Er hat dich angelogen, wir hatten viel öfter Sex. Und schämst du dich denn überhaupt nicht?«
»Nein, ich schäme mich nicht. Günther war der Mann meines Lebens, und mir war mein eigenes Glück wichtiger als deins, das gebe ich ganz offen zu. Und ich habe ihn auch glücklich gemacht und bin immer deine Freundin geblieben, obwohl ich schrecklich eifersüchtig war, weil du die offizielle Frau an seiner Seite warst und ich ihn immer nur heimlich treffen konnte. Ich habe ihn nie gebeten, sich scheiden zu lassen. Weshalb also sollte ich mich schämen?«
Wir hielten in Würzburg auf dem Busbahnhof. Das Mädchen mit der Geige hatte mir voller Mitgefühl zugehört. Die Sache mit dem Sex behielt ich natürlich für mich, so etwas konnte man doch nicht mit einem wildfremden Menschen besprechen.