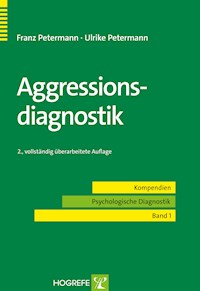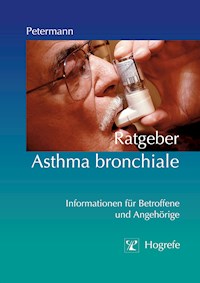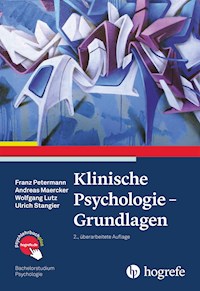
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Bachelorstudium Psychologie
- Sprache: Deutsch
Das Lehrbuch bietet eine kompakte und gut verständliche Einführung in die Grundlagen der Klinischen Psychologie. Die Klinische Psychologie ist das wichtigste Anwendungsgebiet der Psychologie. Mit ihren Modellvorstellungen greift sie einerseits auf zahlreiche Ergebnisse psychologischer Grundlagendisziplinen zurück, andererseits vermittelt sie das notwendige Wissen für die darauf aufbauenden beruflichen Tätigkeitsfelder u. a. in Krankenhäusern, Praxen und Rehabilitationskliniken. Dieses Lehrbuch vermittelt anhand ausgewählter Beispiele die dafür erforderlichen Grundlagen. Darüber hinaus wird auf Basiskonzepte der Klinischen Psychologie eingegangen, so z. B. auf die Grundlagen der Klassifikation psychischer Störungen, Störungsmodelle, die klinische Diagnostik sowie Aussagen zum Behandlungsbedarf bei psychischen Störungen. Ebenso werden Fragen der Epidemiologie und Versorgungsforschung diskutiert. Zahlreiche Kästen mit Beispielen, Tabellen und Abbildungen strukturieren den Text, Verständnisfragen dienen der optimalen Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Franz Petermann
Andreas Maercker
Wolfgang Lutz
Ulrich Stangier
Klinische Psychologie – Grundlagen
2., überarbeitete Auflage
Bachelorstudium Psychologie
Klinische Psychologie – Grundlagen
Prof. Dr. Franz Petermann, Prof. Dr. Andreas Maercker, Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Prof. Dr. Ulrich Stangier
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Eva Bamberg, Prof. Dr. Hans-Werner Bierhoff, Prof. Dr. Alexander Grob, Prof. Dr. Franz Petermann
Prof. Dr. Franz Petermann, geb. 1953. Seit 1991 Lehrstuhl für Klinische Psychologie und seit 1996 Direktor des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker, geb. 1960. Seit 2005 Ordinarius für Psychopathologie und Klinische Intervention an der Universität Zürich.
Prof. Dr. Wolfgang Lutz, geb. 1966. Seit 2007 Leiter der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Trier.
Prof. Dr. Ulrich Stangier, geb. 1958. Seit 2008 Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Frankfurt.
Informationen und Zusatzmaterialien zu diesem Buch finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images/Sebastien Cote
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2018
© 2011 und 2018 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2783-6; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2783-7)
ISBN 978-3-8017-2783-3
http://doi.org/10.1026/02783-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Modelle der Klinischen Psychologie
1.1 Klinische Psychologie: ihre Bereiche und Nachbardisziplinen
1.2 Störung und Gesundheit als psychologische Konstrukte
1.2.1 Psychische Störung
1.2.2 Psychische Gesundheit, Ressourcen und psychische Stärken
1.3 Grundmodelle der Störungslehre
1.3.1 Historische und fachspezifische Modelle
1.3.2 Integrative Störungsmodelle
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 2 Lern- und sozialpsychologische Grundlagen
2.1 Klassisches Konditionieren
2.1.1 Grundlagen der klassischen Konditionierung
2.1.2 Voraussetzungen der klassischen Konditionierung
2.1.3 Klinische Anwendungen der klassischen Konditionierung
2.2 Operantes Konditionieren
2.2.1 Grundlagen der operanten Konditionierung
2.2.2 Voraussetzungen der operanten Konditionierung
2.2.3 Klinische Anwendungen der operanten Konditionierung
2.3 Kognitive und sozial-kognitive Lerntheorien
2.3.1 Lernen durch Einsicht
2.3.2 Die sozial-kognitive Lerntheorie
2.3.3 Klinische Anwendungen
2.4 Soziale Kognition und Attribution
2.4.1 Einstellungen
2.4.2 Selbstkonzept und Selbstwert
2.4.3 Selbstaufmerksamkeit
2.4.4 Selbstwirksamkeit
2.4.5 Attributionstheorien und erlernte Hilflosigkeit
2.5 Sozialer Einfluss
2.5.1 Soziale Unterstützung
2.5.2 Stigma und Etikettierung
2.5.3 Der Einfluss der Medien
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 3 Kognitionspsychologische Grundlagen
3.1 Kognitive Modelle der Depression
3.2 Kognitive Modelle der Panikstörung
3.3 Kognitive Modelle der Sozialen Angststörung
3.4 Kognitive Modelle der Posttraumatischen Belastungsstörung
3.5 Depression versus Angst: Unterscheiden sich die Kognitionen?
3.6 Umsetzung in die klinische Praxis
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 4 Entwicklungspsychopathologische Grundlagen
4.1 Aufgabenfelder und Methoden der Entwicklungspsychopathologie
4.2 Die bio-psycho-soziale Sichtweise
4.3 Entwicklungspfade
4.4 Grundbegriffe der Entwicklungspsychopathologie
4.5 Ergebnisse der Entwicklungspsychopathologie
4.5.1 Lebensspannenmodell der ADHS
4.5.2 Komorbidität von Angststörungen und Depressionen im Kindes- und Jugendalter
4.6 Nutzen entwicklungspsychopathologischer Modelle für die klinische Praxis
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 5 Vom Symptom zur Diagnose: Allgemeine Grundlagen und Beispiele
5.1 Der diagnostische Prozess
5.2 Symptom, Syndrom und Diagnose
5.3 Kategoriale versus dimensionale Diagnostik
5.4 Diagnose- bzw. Klassifikationssysteme
5.5 Klassifikationssysteme positiver Eigenschaften und Ressourcen
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 6 Klassifikation psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen
6.1 Psychische Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter
6.1.1 Definition
6.1.2 Vorstellungen zum Störungskonzept
6.2 Klassifikation psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen
6.2.1 Kategoriale Klassifikationssysteme psychischer Störungen des Kindes- und Jugendalters
6.2.2 Dimensionale Klassifikationssysteme psychischer Störungen des Kindes- und Jugendalters
6.2.3 Klassifikation psychischer Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-11 und DSM-5
6.3 Klassifikation von Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung
6.3.1 Intellektuelle Beeinträchtigungen
6.3.2 Entwicklungsbezogene Störungen der Sprache und des Sprechens
6.3.3 Autismus-Spektrum-Störung
6.3.4 Lernstörungen
6.3.5 Motorische Störungen
6.3.6 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
6.4 Klassifikation von Verhaltensstörungen
6.4.1 Störungen des Sozialverhaltens
6.4.2 Angst- und furchtbezogene Störungen
6.4.3 Trauma- und belastungsbezogene Störungen
6.5 Ausscheidungsstörungen
6.6 Fütter- und Essstörungen
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 7 Klassifikation psychischer Störungen bei Erwachsenen
7.1 Zur Einteilung psychischer Störungen
7.2 Schizophrene Psychosen
7.3 Affektive Störungen
7.3.1 Bipolare Störung
7.3.2 Depressive Störungen
7.4 Angststörungen
7.4.1 Panikstörung (mit oder ohne Agoraphobie)
7.4.2 Generalisierte Angststörung (GAS)
7.4.3 Soziale Phobie
7.4.4 Spezifische Phobie und weitere Angststörungen
7.5 Belastungsstörungen
7.5.1 Posttraumatische Belastungsstörung
7.5.2 Anpassungsstörungen
7.6 Zwangsstörungen
7.7 Somatoforme Störungen
7.8 Demenzen
7.9 Sucht- und Abhängigkeitsstörungen
7.9.1 Substanzkonsumstörungen
7.9.2 Verhaltenssüchte
7.10 Persönlichkeitsstörungen
7.11 Weitere psychische Funktionsstörungen
7.11.1 Essstörungen
7.11.2 Schlafstörungen
7.11.3 Sexuelle Störungen
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 8 Klinische Diagnostik: Anamnese, Exploration, psychometrische Ansätze
8.1 Einführung
8.2 Grundprinzip der Diagnostik: Multimodalität
8.2.1 Datenebenen
8.2.2 Datenquellen
8.2.3 Untersuchungsverfahren
8.2.4 Konstrukte/Funktionsbereiche
8.3 Indikationsstellung
8.3.1 Der Erstkontakt
8.3.2 Störungsdiagnostik
8.3.3 Interpersonale und Persönlichkeitsdiagnostik
8.3.4 Funktionale Problemanalyse/Bedingungsanalysen
8.3.5 Ressourcendiagnostik
8.3.6 Motivations- und Zielanalysen
8.3.7 Indikationsentscheidung/Therapieplanung
8.4 Verlaufsdiagnostik und Therapieevaluation
8.4.1 Therapiebegleitende Diagnostik
8.4.2 Abschlussdiagnostik
8.4.3 Methoden der Therapieevaluation
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 9 Epidemiologie und Versorgungsforschung
9.1 Epidemiologie
9.1.1 Ein historisches Beispiel
9.1.2 Epidemiologische Begriffe
9.1.3 Zentrale Betrachtungsweisen in der epidemiologischen Forschung
9.1.4 Epidemiologische Untersuchungsdesigns
9.2 Versorgungsforschung
9.3 Qualitätssicherung
Zusammenfassung
Fragen
Anhang
Literatur
Glossar
Sachregister
|11|Vorwort
Die Klinische Psychologie stellt seit Jahrzehnten das wichtigste Anwendungsgebiet der Psychologie dar. Vielfach wird Klinische Psychologie dabei mit Psychotherapie gleichgesetzt. Eine solche Gleichsetzung entspricht weder dem Kenntnisstand der Klinischen Psychologie, noch den Perspektiven in der klinischen Praxis. Die Klinische Psychologie beschäftigt sich zwar mit der Entstehung, der Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen, darüber hinaus stehen jedoch auch die psychosozialen Folgen körperlicher Krankheiten – vor allem durch die medizinischen Behandlungserfolge – im Mittelpunkt des Interesses. Darüber hinaus sind, neben der Psychotherapie, auch andere Interventionsformen von Bedeutung, wie etwa die unterschiedlichen Formen von Beratung und präventiven Maßnahmen.
Die Themen der Klinischen Psychologie in dieser Bachelor-Buchreihe wurden in zwei Bände gegliedert:
Grundlagen der Klinischen Psychologie, wobei vor allem Forschungsmethoden, Fragen der Klassifikation sowie Diagnostik in ihren Bezügen zu den Grundlagenfächern der Psychologie (Lern- und Sozialpsychologie, Entwicklungs- und Kognitionspsychologie) dargestellt werden.
Der zweite Band erläutert wichtige Interventionsmethoden der Klinischen Psychologie, wobei Themen der Psychotherapie eine besondere Rolle einnehmen, aber auch Gebiete wie Prävention und Rehabilitation ausgeführt werden.
Im Bachelor-Studium sollen die Grundlagen und die Anwendungsgebiete der Klinischen Psychologie behandelt werden. Eine Vertiefung des Faches erfolgt in der Regel im Rahmen eines Master-Studienganges Klinische Psychologie, der schon weitgehend im deutschsprachigen Raum – in unterschiedlicher Differenziertheit – angeboten wird. In Deutschland bildet ein Master-Studium die Voraussetzung für eine postgraduale Psychotherapieausbildung (mit dem Ziel der Approbation). Fundierte Kenntnisse im Fach Klinische Psychologie sind Basis eines solchen Ausbildungsweges.
Bei der Gestaltung der beiden Bachelor-Bände haben wir uns als Autorengruppe zusammengefunden, in der jedes Mitglied sehr unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte – teilweise über viele Jahrzehnte – aufweist. Von dieser Unterschiedlichkeit der Perspektiven leben beide Bände! Der erste Band, der mit dieser Publikation in einer zweiten Auflage vorliegt, wurde federführend vom Erstautor gestaltet, wobei folgende Mitarbeiterinnen des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen die Ausarbeitungen unterstützten: Dr. Sylvia Helbig-Lang (heute Universität Hamburg), Dr. Julia Jaščenoka und Dr. Franziska Ulrich. In umfassender Weise unterstützte uns Paul Röhr, derzeit Student des Studienganges M. Sc. Klinische Psychologie der Universität Bremen, im Rahmen der Ausarbeitun|12|gen, der Bearbeitung des Sachregisters sowie bei der Erstellung des endgültigen Manuskriptes.
Wir als Autorenteam danken dem Hogrefe Verlag für die Betreuung unseres Buches. Unserem Leserpublikum wünschen wir eine gewinnbringende Lektüre und einen erfolgreichen Verlauf des Studiums.
Bremen, im März 2018
Franz Petermann –
für das Autorenteam
|13|Kapitel 1Modelle der Klinischen Psychologie
Andreas Maercker
|14|Die Klinische Psychologie befasst sich mit psychischen Störungen und psychischen Aspekten körperlicher Erkrankungen. Sie lässt sich in Grundlagen- und Anwendungsbereiche einteilen. Der zentrale Grundlagenbereich ist die Störungslehre (Psychopathologie, engl. Abnormal Psychology), während die wichtigsten Anwendungsbereiche die klinisch-psychologische Diagnostik, die Beratung (engl. Counselling) und die Psychotherapie sind. Zu Beginn Ihrer Lektüre wird die Störungslehre bzw. Psychopathologie im Mittelpunkt stehen.
1.1 Klinische Psychologie: ihre Bereiche und Nachbardisziplinen
In fruchtbarer Kooperation mit Nachbarfächern erreichte die Klinische Psychologie vielerlei Fortschritte. Dabei spielten folgende Teilgebiete der Psychologie eine Rolle: Allgemeine Psychologie (Lern- und kognitionspsychologische Grundlagen, vgl. auch Kapitel 2 und 3), Neuro- bzw. Biologische Psychologie (physiologische und neurowissenschaftliche Grundlagen), Entwicklungspsychologie (lebensspannenpsychologische Grundlagen und die sog. Entwicklungspsychopathologie, vgl. auch Kapitel 4) sowie Sozialpsychologie (interpersonelle Aspekte, vgl. auch Kapitel 2). Differentielle Psychologie und Klinische Psychologie haben gemeinsam, individuelle Unterschiede in einzelnen psychologischen Merkmalen und in den relativ überdauernden Persönlichkeitseigenschaften zu beschreiben und zu erklären. Dies grenzt sie von anderen psychologischen Fächern, welche meist Gemeinsamkeiten von Verhaltensmerkmalen in den Mittelpunkt stellen, ab.
Mit der Psychiatrie, dem medizinischen Fach, das sich mit psychischen Störungen befasst, hat die Psychologie für die Bereiche der Störungslehre und klinischen Interventionen viele Gemeinsamkeiten. Einzig die medikamentöse Behandlung durch Psychopharmaka ist in den meisten Ländern den Psychiatern vorbehalten (Ausnahmen sind einige US-Bundesstaaten und teilweise die Niederlande). Das Fachgebiet der Medizinischen Psychologie widmet sich vornehmlich den psychischen Aspekten körperlicher Erkrankungen und wird den Medizinern während der Ausbildung gelehrt. Die Verhaltensmedizin ist ein interdisziplinär psychologisch-medizinisches Forschungs- und Praxisfeld, welches aus der Psychosomatik hervorgegangen ist und sich vor allem mit dem Zusammenspiel zwischen psychischen und körperlichen Prozessen bei Störungen und Erkrankungen beschäftigt.
|15|1.2 Störung und Gesundheit als psychologische Konstrukte
1.2.1 Psychische Störung
Für die Klinische Psychologie ist das Konstrukt „psychische Störung“ zentral. Damit werden sowohl psychische Leidenszustände, welche die Betroffenen in sich selbst verspüren, als auch psychische Problemkonstellationen bezeichnet, deren Auswirkungen vielleicht nur die Umwelt, und nicht die Betroffenen selbst feststellen. Trotz der verbreiteten Erwartung, dass psychische Störungen eindeutig vom normalen psychischen Funktionieren abgrenzbar sein sollten, ist die Abgrenzung nicht eindeutig wissenschaftlich definierbar. Es gibt keine feststehende Entität psychischer Störungen, sondern ihre Definitionen werden jeweils nach dem aktuellen Stand der sozialen Normen, der grundlagenwissenschaftlichen Forschung und dem Stand der Praxis gestellt. Psychische Störungen sind damit methodisch betrachtet Konstrukte, auf welche sich die Gesellschaft und Experten nach bestem Wissen und Gewissen geeinigt haben.
Merke
Gemäß dem heutigen sprachlichen Fachgebrauch wird meist von psychischen Störungen und seltener von psychischen Krankheiten gesprochen. Mit diesem Sprachgebrauch soll darauf hingewiesen werden, dass psychische Störungen nicht ausschließlich durch somatisch-biologische Ursachen zustande kommen, wie körperliche Erkrankungen. Psychische Beeinträchtigungen (Störungen) erklären sich neben biologischen Ätiologiefaktoren vielmehr auch durch psychische und soziale Ursachen. Zudem hatte man sich erhofft, dass der Störungsbegriff für die Betroffenen weniger stigmatisierend ist als der Krankheitsbegriff, wobei die Bezeichnung allein das Stigmatisierungsproblem nicht genügend verändern kann.
Die Abgrenzung zwischen „krank“ und „gesund“ bzw. „gestört“ und „normal“ ist ein grundlegendes Problem für die Klinische Psychologie und die Psychiatrie, weil es viele Konsequenzen nach sich zieht.
Konsequenzen der „Normal-abnormal“-Unterscheidung
Beispiel 1: Menschen mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl haben sich in der Geschichte häufig gegen die herrschenden Verhältnisse aufgelehnt. In einigen totalitären Diktaturen können das |16|Auflehnen und begleitende nonkonformistische Verhaltensweisen in Aussehen und Kleidung dazu führen, dass die Aktivisten psychisch pathologisiert werden. Beispielsweise wurden in der ehemaligen Sowjetunion politisch Andersdenkende als Schizophrene in psychiatrische Kliniken zwangseingewiesen mit der Begründung, dass ihre Gedankeninhalte und Verhaltensweisen stark abnorm wären. In den 1980er Jahren gab es deshalb eine internationale Debatte, dass psychische Störungsdiagnosen nicht politisch missbraucht werden sollen (van Voren, 2010).
Beispiel 2:Cross-dressing oder Transvestismus gelten bzw. galten bis in unsere Zeit eigentlich als psychische Störung; jedenfalls werden sie in den Listen mit psychischen Störungen bis heute aufgeführt, allerdings nicht mehr in der neuesten Version der Internationalen Krankheitsklassifikation, ICD-11, der Weltgesundheitsorganisation. Das Phänomen ist definiert als Tragen von „gegengeschlechtlicher“ Kleidung. Es reicht vom gelegentlichen Tragen dieser Kleidung, über das ausschließliche Tragen der „gegengeschlechtlichen“ Unterwäsche bis hin zu schrillen Varianten der Dragqueens oder Dragkings, in denen kleidungsbezogene Geschlechtsmerkmale besonders ausgeschmückt werden. Es gibt außer einer Normerwartung keinen wichtigen Grund, dieses Phänomen zu pathologisieren, insbesondere da es nicht mit psychischen Leidenszuständen verbunden ist. Die Entpathologisierung brauchte dennoch lange Zeit und ist bis heute noch nicht vollständig erreicht.
Psychische Störungen, verstanden als Konstrukte, sind daher nur in ihrem jeweiligen Bezugssystem von Normen sinnvoll anwendbar (zum Normenbegriff siehe Sozialpsychologie-Lehrbücher). Deshalb ist nötig zu klären, welche Normen jeweils bestimmen, was eine psychische Störung ist bzw. was mit abnormalem Verhalten gemeint ist. Für die Definition psychischer Störungen sind folgende unterschiedliche Normentypen relevant:
Typen von Normen
Die subjektive Norm. Hier geht es um das Abweichen von der Norm der eigenen Befindlichkeit. Beispiel: Jemand leidet oder fühlt sich stark eingeschränkt. Dieser Normentyp ist schwer zu objektivieren und reicht in der Regel nicht als alleiniges Bezugssystem aus.
Die statistische Norm. Dabei steht die Abweichung von der Norm der Häufigkeitsverteilung im Mittelpunkt, zusätzlich sind Schwellenwerte festzulegen, ab wann ein Zustand abnormal ist. Dieser Normentyp schafft das Problem, dass Häufigkeitsverteilungen in zwei Richtungen variieren, z. B. sehr hoher oder sehr niedriger IQ bzw. für den Alkoholkonsum übermäßiges oder sehr geringes (!) Trinken.
|17|Die Ideal- oder Funktionsnorm. Damit wird angenommen, dass es eindeutiges ideales psychisches Funktionieren gibt. Ein beispielhaftes Problem dieser Normenart ist die Homosexualität: Sie müsste als Störung angesehen werden, wenn als alleinige Funktion der Sexualität die Fortpflanzung angesehen wird. Die heutige Sexualwissenschaft geht allerdings davon aus, dass Sexualität auch kommunikative und Lust-Aspekte mit einschließt, was dazu führt, Homosexualität nicht als Störung zu bezeichnen.
Die soziale Norm. Psychische Störungen werden dabei als ein Abweichen von gesellschaftlichen Konventionen oder Regeln betrachtet. Dieser Normentyp war die Grundlage der Pathologisierung von Andersdenkenden in Diktaturen. Der Normentyp ist weiterhin sehr durch kulturelle Unterschiede geprägt: Wenn z. B. jemand aus dem Nichts heraus Stimmen hört, deutet das in modernen Kulturen auf Schizophrenie hin, kann aber in anderen Kulturkreisen als Zeichen göttlicher Eingebung betrachtet werden.
Diese Normentypen können – wie beschrieben – jeweils nur relative Hinweise zur Feststellung von psychischen Störungen benutzt werden. Festzuhalten ist zudem, dass „Normalität“ oder „normal sein“ nicht unbedingt ein idealer und anzustrebender Zustand ist. Eine persönliche Überangepasstheit an Normen kann häufig auch mit Beeinträchtigungen und Leidenszuständen einhergehen – wie z. B. Untersuchungen zum Zusammenhang von Perfektionismus und verschiedenen psychischen Störungen (vgl. z. B. Depressionen, Zwangsstörung, Essstörungen) zeigen (Egan, Wade & Shafran, 2011).
Dennoch ist eine annäherungsweise Definition für psychische Störungen möglich, welche zweckmäßig mehrere Kriterien beinhaltet:
Eine psychische Störung ist vorhanden, wenn
psychisches Leid („Leidensdruck“) auf Seiten der Betroffenen vorhanden ist,
erhebliche psychische Fehlanpassung im Erleben oder Verhalten besteht, wobei der Kontakt zur Realität oder die Fähigkeit zur Selbstkontrolle andauernd verloren gegangen ist,
Veränderungen im Erleben und Verhalten nicht nur eine verständliche und kulturell übliche Reaktion auf ein Ereignis sind, wie z. B. eine normale Trauerreaktion bei Verlust eines geliebten Menschen,
ein spezifisch definiertes Störungskonzept aus dem Wissensbestand der Klinischen Psychologie und Psychiatrie bzw. von Experten der Weltgesundheitsorganisation zutrifft (dieser Aspekt dient zur Absicherung gegenüber dem Missbrauch des Störungsbegriffs).
|18|1.2.2 Psychische Gesundheit, Ressourcen und psychische Stärken
Ebenso komplex wie die Definition von psychischen Störungen ist eine Definition des Konstrukts „psychische Gesundheit“. Genauso wie das Störungskonstrukt ist auch das Gesundheitskonstrukt beobachter- und normabhängig; entsprechende Definitionen hängen z. B. davon ab, ob sie von Krankenversicherungen oder Wissenschaftlern festgelegt werden. Zwar wird die Gesundheit in der Psychologie im Teilgebiet der Gesundheitspsychologie thematisiert, dennoch wird der gesamten Psychologie, und insbesondere der Klinischen Psychologie, in den letzten Jahrzehnten wohl zu Recht vorgeworfen, dass sie sich nur auf negative oder leidbesetzte Themen konzentrieren würde und positive Phänomene vernachlässige.
Gesundheit wurde bereits 1948 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert als „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Die WHO hat 1986 eine weiterführende Definition verabschiedet, wonach Gesundheit definiert wird als „a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities.“ Verschiedene Autoren aus dem Bereich der Psychologie haben zudem inhaltliche Kriterien für psychische Gesundheit vorgeschlagen, z. B. Liebe, Selbstachtung, Freiheit und Verbundenheit (Seligman, 2002).
Ein zentraler Bestandteil des Gesundheitskonstrukts ist der Ressourcenbegriff. Als Ressourcen versteht man innere Potenziale eines Menschen (z. B. Fähigkeiten, Erfahrungen, Talente, Neigungen und Stärken) und äußere Bedingungen (z. B. Freunde, Familie, Finanzen), die zwar vorhanden, aber manchmal einem selbst nicht bewusst sind. Der Ressourcenbegriff ist besonders gut geeignet, um das gleichzeitige Nebeneinander von Störungen bzw. Behinderungen und positiven Fähigkeiten bzw. Stärken zu beschreiben. Wenn die Komplexität menschlichen Erlebens und Verhaltens erfasst werden soll, dann ist es angebracht, nicht nur nach Störungen, sondern auch nach individuellen Merkmalen psychischer Gesundheit (d. h. Ressourcen) zu suchen. Diese komplementäre Sichtweise zeigt sich ganz offensichtlich auch in der Tatsache, dass einige Menschen mit psychischen Störungen erfolgreiche Künstler waren bzw. sein können (z. B. Künstler mit depressiven Störungen: Vincent van Gogh, Hermann Hesse, Marilyn Monroe, Eric Clapton).
|19|Beispiel: Haben Depressive weniger Illusionen?
Seit den klassischen Studien von Alloy und Abramson (1979) fanden sich viele Belege dafür, dass depressive Personen eine realistischere Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten haben, als diejenigen, welche nicht depressiv sind. Ein einfaches Experiment dazu (Allan et al., 2007): Probanden müssen von Zeit zu Zeit eine Taste drücken, gleichzeitig sehen sie, dass ab und zu eine Glühbirne angeht. Bei manchen Probanden geht die Lampe in zufälligen Abständen an, der Tastendruck hat keinerlei Einfluss darauf. Dabei kontrollieren Versuchsleiter, ob das Drücken der Taste tatsächlich einen Einfluss auf das Leuchten des Lämpchens hat, und wenn ja, wie groß dieser Zusammenhang ist.
Nicht depressive Patienten schätzen nach einem solchen Experiment ihren eigenen Einfluss auf das Leuchten des Lämpchens regelmäßig zu hoch ein. Selbst wenn es gar keinen Zusammenhang geben sollte, glauben viele, ihr Tastendruck hätte zumindest gelegentlich zum Aufleuchten beigetragen. Sie erinnern sich gewissermaßen bevorzugt daran, wenn ihr Tastendruck mit dem Lichtschein zusammenfiel. Depressive Menschen dagegen sind in ihren Einschätzungen über den Zusammenhang erstaunlich genau – sie bilden sich nicht ein, vermeintlich etwas beeinflussen zu können.
Die Selbstüberschätzung von Gesunden in dieser und ähnlichen Versuchsanordnungen wurde als Phänomen der positiven oder selbstwertdienlichen Illusionen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der kognitiven Dissonanzreduktion steht (vgl. auch Sozialpsychologie-Lehrbücher).
Psychische Stärken:Peterson und Seligman (2004) haben eine Systematik von psychischen Stärken (im Sinne von Ressourcen) vorgelegt, welche sie in einer Serie psychologischer Studien voneinander abgegrenzt hatten:
Weisheit und Wissen: Kreativität, Neugier, Offenheit, Freude am Lernen.
Mut: Zivilcourage, Beharrlichkeit, Vitalität.
Menschlichkeit: Liebe, Freundlichkeit, soziale Intelligenz.
Gerechtigkeit: Fairness, Autorität, Solidarität.
Mäßigung: Ausgeglichenheit, Bescheidenheit, Vergebung, Umsicht, Selbstkontrolle.
Transzendenz: Schönheitssinn, Bewunderungsfähigkeit, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor, Spiritualität.
Seligman entwickelte in den ersten Jahrzehnten seiner Forscherlaufbahn ein bekannt gewordenes Modell für depressive Störungen: Das |20|Modell der erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 1972; vgl. Kapitel 2). Seit den 1990er Jahren widmete er sich der Erforschung der psychischen Gesundheit im Rahmen der Positiven Psychologie (Seligman, 2002).
1.3 Grundmodelle der Störungslehre
Bis heute gibt es offene Probleme in der Wissenschaft und klinischen Praxis, welches die Kernbestandteile bzw. die (Haupt-)Ursachen vieler psychischer Störungen sind. Zudem gibt es darüber nicht selten unterschiedliche Ansichten, z. B. auch zwischen verschiedenen Forschungsansätzen und beteiligten Berufsgruppen (z. B. Psychiatern, Psychologen, Sozialwissenschaftlern). Wie hier dargestellt wird, werden die wissenschaftlichen Anschauungen der Störungslehre immer komplexer.
1.3.1 Historische und fachspezifische Modelle
Psychische Störungen wurden in der Geschichte – und werden noch heute in traditionellen Gesellschaften – meist als Phänomene einer dämonischen Besessenheit angesehen. Bestimmte Geister oder Teufel hatten von einer Person Besitz ergriffen und diese z. B. in Panik, Schrecken, Schwermut oder Wahnsinn versetzt (Leibrand & Wettley, 1990).
Der wissenschaftliche Ansatz der „psychiatrischen Krankheitslehre“ beginnt erst im 19. Jahrhundert als Spätfolge des Zeitalters der Aufklärung, parallel zur Entstehung der Psychologie als Wissenschaft sowie der Hirnanatomie. Die ersten Psychiater nahmen als Ursachen für psychische Störungen bestimmte Hirnpathologien an. Ein bekannt gewordener Ausspruch Wilhelm Griesingers (1817–1868, tätig in Zürich und Berlin) drückt diese Grundeinstellung aus: „Geisteskrankheiten sind Hirnkrankheiten“.
Emil Kraepelin (1856–1926)
Kraepelin entwickelte die Grundzüge der bis heute gültigen Klassifikation psychischer Störungen (vgl. Kapitel 7). Seine wissenschaftliche Arbeit orientierte sich grundsätzlich an hirnpathologischen Annahmen, wobei er zusätzlich psychologische Konzepte nutzte. Als studierter Mediziner hatte er eine Zeit lang bei Wilhelm Wundt gearbeitet, dem Mitbegründer der wissenschaftlichen Psychologie. Kraepelin teilte die schwersten psychischen Störungen in zwei Hauptgruppen ein: Die Dementia praecox (heute: Schizophrene Psychose) und das Manisch-depressive Irresein (heute: Bipolare Störung). Der Wert des Kraepelinschen Klassifikationsmodells bestand darin, dass man ein|21|deutige Kriterien nutzen und Wahrscheinlichkeitsaussagen über den Verlauf der Störungen machen konnte.
Im 19. Jahrhundert kam neben dem hirnpathologischen ein zweiter Ansatz zur Erforschung psychischer Störungen auf: Der sogenannte psychogenetische Ansatz. Dabei wurde Emotionen, Kognitionen, Motiven, Willensprozessen und inneren Konflikten zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet. Das betraf vor allem sogenannte nervöse Erkrankungen, die von Kraepelin nur randständig einbezogen wurden, wie etwa die damals so bezeichneten Hysterien, Hypochondrien oder Neurasthenien („Nervenschwäche“). Entscheidende Impulse für die Konzeptbildung zu diesen Störungen gingen von Sigmund Freud aus. Freud und die ihm verbundenen französischen Forscher Jean-Marie Charcot (1825–1893) und Pierre Janet (1859–1947) untersuchten die Hysterie, Neurasthenie und andere Störungen anhand psychogenetischer Modelle; d. h. die Störungsursachen wurden vornehmlich in der Biografie der betroffenen Personen – und nicht in der Hirnpathologie – vermutet.
Sigmund Freud (1856–1939)
Fotograf: akg-images © picture-alliance/akg
Sigmund Freud (1856–1939) war Physiologe und Arzt in Wien, bevor er sich der „Seelenerforschung“ zuwandte. Durch seine Ideen und Modelle wurde er zu einem der weltweit einflussreichsten Theoretiker seiner Zeit. Bis heute lösen seine Annahmen auch außerhalb der Psychologie intellektuelle Kontroversen aus. Freud hat der Störungslehre und der Psychotherapie viele weitreichende Impulse gegeben. Sein sogenanntes topografisches Modell (1915) unterscheidet zwischen dem Unbewussten, Vorbewussten und Bewussten als psychische Funktionen und bringt diese mit verschiedenen Störungsursachen in Zusammenhang. Sein sogenanntes Instanzenmodell (1923) trennt zwischen Über-Ich, Ich und Es, welche sich jeweils durch ihre Beziehungen zu Trieben und Willensprozessen unterscheiden. Störungen können demnach aus Konflikten zwischen diesen drei Instanzen entstehen. Sein genereller Einfluss auf die Entwicklung der Psychotherapie ist unumstritten, wenn auch die von ihm spezifisch entwickelte „psychoanalytische Kur“ (später: Psychoanalyse) in ihrer ursprünglichen Form bis heute immer mehr an Verbreitung verlor (vgl. Rammsayer & Weber, 2016).
Die Auseinandersetzung zwischen hirnpathologischen und psychogenetischen Ansätzen in der Störungslehre dauerte über weite Strecken des 20. Jahrhunderts an. Man findet sie auch heute noch – mit veränderten Begriffen – als Auseinandersetzung zwischen dem sogenannten traditionell medizinischen und den psychologischen Modellen für psychische Störungen und ihre Behandlung.
Das traditionelle medizinische Krankheitsmodell wird zwar nur von wenigen Theoretikern vertreten, stellt aber in der Praxisanwendung |22|ein bis heute immer noch häufig anzutreffendes Grundmodell für die Einschätzung psychischer Störungen dar (Nesse & Stein, 2012). Seine Kennzeichen sind:
Kranksein wird auf einen primär anatomischen, physiologischen oder biochemischen Defekt zurückgeführt (welcher möglicherweise noch nicht entdeckt und bekannt ist).
Dieser Defekt ist organischer (körperlicher) Art.
Der Defekt liegt in der Person (d. h. nicht im zwischenmenschlichen Beziehungsnetz bzw. der Gesellschaft).
Dem Defekt liegen kausal mikroskopische Ursachen bzw. Ursachenmuster zugrunde (z. B. genetische Veränderungen).
Therapeutisch werden Medikamente (Psychopharmaka) oder sogenannte somatische Verfahren (z. B. Lichttherapie, Elektrokrampftherapie, Transkranielle Magnetstimulation, Psychochirurgie) bevorzugt.
Abbildung 1: Traditionelles medizinisches Modell (nach Wittchen et al., 1998)
Neurobiologische Modelle der psychischen Störungen entstammen der medizinischen und biopsychologischen Grundlagenforschung. Sie sind besonders dann von Interesse, wenn sich bei psychischen Störungen genetische, endokrinologische oder hirnstrukturelle Veränderungen zeigen (vgl. Güntürkün, 2012). Die neurobiologischen Modelle setzen meist an den veränderten Grundprozessen der einzelnen Störungen an, z. B.
|23|Gedächtnisveränderungen (antero-und retrograde Amnesie) beim Korsakoff-Syndrom,
Beeinträchtigungen des Präfrontalhirns (Läsionen) bei Persönlichkeitsveränderungen,
Wahrnehmungs- und kognitive Veränderungen (z. B. Aufmerksamkeits- und neurokognitive Defizite) bei schizophrenen Psychosen,
Emotionsregulationsveränderungen (z. B. verringerte Herzraten-Variabilität) bei depressiven Störungen,
Stresshormonveränderungen (z. B. verringerte Kortisolspiegel) bei trauma- und belastungsbezogenen Störungen.
Die störungsbezogenen neurobiologischen Modelle werden intensiv erforscht, meist in psychiatrischen Forschungseinrichtungen. Häufig gibt es zu einer Störung verschiedene und teilweise auch konkurrierende Ansätze (z. B. bei depressiven Störungen), die einerseits durch Ungleichgewichte von Neurotransmittern und andererseits als gestörte physiologische Signalübertragungen in bestimmten Hirnkreisläufen (engl. brain circuits) erklärt werden. Um bestimmte neurobiologische Einzelbefunde nicht als alleinige bzw. isolierte Hauptursache überzubewerten, hat eine Initiative des US-National Institutes of Mental Health ein umfassendes konzeptuelles Netzwerk zur Erforschung psychischer Funktionen und Störungen erarbeitet. Diese „Research Domain Criteria“ (RDoC) beabsichtigen, für neurobiologische Einzelbefunde die Domänen und Analyseeinheiten zu beschreiben, wobei auch psychologische Grundfunktionen berücksichtigt werden. Es werden fünf Domänen beschrieben: negative Valenzsysteme, positive Valenzsysteme, kognitive Systeme, Systeme sozialer Prozesse und Erregung-regulatorische Systeme. Die sieben Analyseeinheiten sind: Gene, Moleküle, Zellen, Neurale Circuits, Physiologie, Verhalten und Selbstbericht (siehe Walter, 2017). Das RDoC-Modell wurde u. a. für seinen nur sehr schwachen Bezug zur klinischen Praxis der Diagnose bzw. Therapie kritisiert und die gegenwärtig noch mangelnde Validität seiner Grundelemente (Domänen, Analyseeinheiten) beanstandet. Trotz dieser Kritikpunkte ist das Modell der zurzeit am besten ausgebildete Rahmen für eine multidisziplinär-neurowissenschaftliche Erforschung psychischer Störungen mit dem Ziel, biologisches Wissen über Ursachen und Risikofaktoren psychischer Krankheiten zu systematisieren.
Im Gegensatz zum medizinischen und zum neurobiologischen Modell sind die psychologischen Modelle für psychische Störungen und Behandlungen primär auf die psychologischen und sozialen Faktoren bezogen. Die beiden einflussreichsten Modelle sind das psychodynamische und das lerntheoretische Grundmodell.
|24|Im psychodynamischen Grundmodell, das insbesondere auf der Psychoanalyse Sigmund Freuds beruht, stehen folgende Aussagen im Mittelpunkt:
Kranksein wird primär auf eine frühkindliche (innerhalb der ersten drei Lebensjahre stattgefundene) Konfliktsituation zurückgeführt, die nachfolgend verdrängt wurde.
Im späteren Leben führen die unbewussten Konsequenzen dieses Konflikts und die Art und Ausprägung der psychischen Verdrängung zu den psychischen Störungen.
Die Störung ist damit in der Person begründet (d. h. nicht im aktuellen zwischenmenschlichen Beziehungsnetz bzw. der Gesellschaft).
Therapeutisch wird in der klassischen Psychoanalyse an der Aufhebung früherer Verdrängungen gearbeitet. Daraus abgeleitete neuere psychodynamische Therapieansätze bearbeiten daneben auch aktuelle Konflikte und psychische Defizite, die im Zusammenhang mit den frühkindlichen Konflikterfahrungen stehen.
Das lerntheoretische Grundmodell, das im engen Zusammenhang mit psychologischen Modellen entstanden ist, hat folgende Grundannahmen (vgl. Kapitel 2):
Psychische Störungen (sowie sozial delinquentes Verhalten) werden vornehmlich durch Lernerfahrungen und soziale Einflüsse erklärt, die in der Kindheit beginnen oder neu in der gesamten Lebensspanne dazu kommen können.
Es werden bestimmte Lernformen unterschieden, z. B. Konditionierung, operantes Lernen, Lernen am Modell, Lernen durch Einsicht.
Die Störung wird damit primär als intrapsychischer Prozess erklärt, wobei biologischen und Umweltfaktoren eine interaktive Rolle zugebilligt wird.
Die Therapien lassen sich in ihrer Grundform aus den verschiedenen Lernarten ableiten: z. B. Gegenkonditionieren, operante Verfahren (Verstärken, Kontingenzverträge), Training sozialer Kompetenzen, kognitive Umstrukturierung.
1.3.2 Integrative Störungsmodelle
Systematische Begriffe der Störungslehre
Die Ätiologie ist die Lehre von den Störungs- bzw. Krankheitsursachen.
Die Pathogenese beschreibt die Entstehung und Entwicklung einer Störung im Verlauf mit allen daran beteiligten Faktoren.
|25|Die Ätiopathogenese umfasst die Gesamtheit aller Faktoren, die zur Ursache, Entstehung und Entwicklung einer Störung beitragen.
Prädisposition/Disposition ist der Fachausdruck für die genetisch bedingte Veranlagung oder Empfänglichkeit (Vulnerabilität) für bestimmte Störungen.
Auslösende und aufrechterhaltende Faktoren: Auslösende Faktoren tragen zum erstmaligen Auftreten einer psychischen Störung bei, während aufrechterhaltende Faktoren veranlassen können, dass eine psychische Störung bestehen bleibt und nicht wieder abklingt. So können beispielsweise spezifische biologische Konstellationen auslösende Faktoren sein (z. B. Hyperventilation resultiert in Panikzuständen), während psychische Folgeerscheinungen aufrechterhaltende Faktoren sind (z. B. Erwartungsangst trägt zur Chronifizierung der Panikstörung bei).
Salutogenese ist ein noch vergleichsweise neuer Begriff, der die Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit umfasst, insbesondere nach bzw. trotz Schädigungen oder Stresseinwirkung.
Das bisherige Wissen zur Ätiologie, Patho- und Salutogenese legt nahe, dass integrative Modelle zur Beschreibung psychischer Störungen am besten geeignet sind. Sie bieten den geeignetsten Rahmen, die jeweiligen Störungen in ihrer Komplexität angemessen zu verstehen und voreilige Schlüsse in Bezug auf die Störungserklärung sowie die erforderliche Intervention zu vermeiden. Wichtige Impulse für diese umfassende Sichtweise resultieren aus:
dem bio-psycho-sozialen Modell und
dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (auch Diathese-Stress-Modell).
Das bio-psycho-soziale Modell besagt, dass biologische, psychologische und soziale Faktoren grundsätzlich einen gleichrangigen Wert für das Verständnis psychischer Störungen haben. Störungen und Gesundheit bilden sich in einem dynamischen Wechselspiel zwischen diesen drei Polen heraus.
Biologisch-medizinische sowie psychologische Faktoren wurden bereits im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung der Klinischen Psychologie erwähnt. Die sozialen oder Umweltfaktoren lassen sich unterteilen in (vgl. auch Kapitel 2):
Interpersonelle Faktoren: Beispielsweise familiäre, Gleichaltrigen- (peer-) oder berufliche Einflüsse.
Kulturabhängigkeit bzw. ethnische Zugehörigkeit: Zum Beispiel individualistische oder kollektivistische Wertorientierungen einer Gesellschaft.
|26|Umweltfaktoren: Beispielsweise Hunger, Krieg, Katastrophen oder sozialer Stress.
Soziale Faktoren: Soziale Ungleichheit, sozioökonomischer Status oder soziale Rollen.
Abbildung 2 fasst die wichtigsten Aspekte der drei Faktoren des bio-psycho-sozialen Modells zusammen.
Abbildung 2: Das bio-psycho-soziale Modell
Für die Planung einer Intervention und Prävention impliziert das bio-psycho-soziale Modell, dass alle drei Faktoren berücksichtigt werden müssen. Bei einer Depressionstherapie wäre demnach zu prüfen, in welchem der drei Bereiche zuerst interveniert werden muss bzw. was während einer Therapie kombiniert werden sollte: Der soziale oder Umweltfaktor bei einer extremen Arbeitsbelastung kann durch berufliche Interventionen verändert werden, zudem ist – in Bezug auf biologische Faktoren – der Einsatz von Psychopharmaka zu prüfen sowie – bzgl. psychischer Faktoren – zu überlegen, welche Form von Psychotherapie wann und wie lange angeboten werden soll.
Das bio-psycho-soziale Modell weist mehrere Begrenzungen auf. So ist es ausreichend spezifisch, wenn nur einer einzelnen psychischen Störung(-sgruppe) auf den Grund gegangen wird. Dabei fehlt jedoch der Aspekt der Störungsspezifität, d. h. jede Störung bzw. Störungsgruppe ist durch jeweils unterschiedliche Faktorenmuster erklärbar. Die schizophrene Psychose wird beispielsweise entscheidend durch |27|biologische Veränderungen verursacht (welche teilweise noch nicht bekannt sind), dagegen werden Belastungsstörungen entscheidend durch negative Umwelteinflüsse geprägt (vgl. Kapitel 6 und 7). Weiterhin fehlen beim bio-psycho-sozialen Modell zeitliche und dynamische Aspekte, welche eine Störungsentwicklung in der Lebensspanne erklären.
Abbildung 3 zeigt eine Spezifizierung des bio-psycho-sozialen Modells in Bezug auf eine depressive Störung, bei welcher zudem Lebensspannen-Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Kasten).
DasVulnerabilitäts-Stress-Modell oder Diathese-Stress-Modell ergänzt das bio-psycho-soziale Modell um Zeitverlaufs- und dynamische Aspekte. Vulnerabilität (von lateinisch vulnus, Wunde) wird dabei verstanden als jeweils gegebener Grad der „Verletzlichkeit“ einer Person. Diathese (griechisch Auseinanderstellen, Zustand) bezeichnet den Grad der „Empfänglichkeit“ einer Person für eine bestimmte Störung.
Vulnerabilitäten kommen zustande durch angeborene oder erworbene biologische Einflüsse (z. B. genetisch, hirnanatomisch, endokrinologisch), durch psychologische Einflüsse aus früheren Lebensphasen (z. B. problematische Familienkonstellation) sowie durch ungünstige soziale und Umwelteinflüsse (z. B. Armut, soziale Benachteiligung). In der Lebensphase, in welcher sich eine Störung herausbildet, wirken dann die Stressoren, die wiederum in biologische (z. B. eine somatische Erkrankung), psychische (z. B. ein oder mehrere kritische Lebensereignisse) sowie soziale oder Umweltfaktoren (z. B. Umstrukturierung der Arbeitswelt) unterteilt werden können.
Der dynamische Kern des Vulnerabilitäts-Stress-Modells besteht in der Vorstellung von einer „Schwellenüberschreitung“ bis hin zu einer psychischen Störung. Diese ist bei höherer Vulnerabilität schneller erreicht und benötigt nur kleine Stressoreffekte, während bei geringer Vulnerabilität größere Stressoren dazu kommen müssen, um die Störungsschwelle zu überschreiten (vgl. Abb. 4). Für verschiedene Lebensphasen wird zudem angenommen, dass sie verschiedene Schwellenwerte haben. So können Demenzen bekanntlich im Alter auftreten: Die dazu gehörige Vulnerabilität liegt zwar hauptsächlich im genetischen Bereich, hängt aber auch mit den psychosozialen Ressourcen einer Person zusammen – und gleichzeitig wird der Zeitpunkt für eine klinische Demenzerkrankung durch Stressoren mitbestimmt (Forstmeier & Maercker, 2008).
Abbildung 4: Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Eine Erweiterung des allgemeinen Vulnerabilitäts-Stress-Konzepts um den Ressourcenaspekt hat Becker (1997) vorgeschlagen: Das Neuauftreten psychischer Störungen – oder die Inzidenz (definiert als Neuauftretensrate pro Zeitraum und betrachteter Population; vgl. Kapitel 9) – wird demnach zusätzlich durch psychische Kompetenzen und förderliche Umweltbedingungen bestimmt.
Abbildung 5: Genese von Störungen – Inzidenzformel nach Becker (1997)
Seine Hauptbegrenzung hat das Vulnerabilitäts-Stress-Modell in der Tatsache, dass es kein störungsspezifisches Modell ist. Es muss jeweils für die untersuchten Störungen mit spezifischen Vulnerabilitäts-, Risiko-, Stressor- und Ressourcenfaktoren gefüllt werden bzw. mithilfe dieser spezifischen Faktoren in ein störungsbezogenes Modell integriert werden.
Das bio-psycho-soziale sowie das Vulnerabilitäts-Stress-Modell lieferten dennoch zweifelsohne bedeutende Impulse für die Klinische Psychologie. Es ist zu erwarten, dass die Psychologie mit allen ihren |30|Subdisziplinen und deren fortgeschrittenen Methoden für die Störungslehre weitere Beiträge liefert, z. B.:
die Entwicklungspsychopathologie und Lebensspannenpsychologie u. a. mit Längsschnittstudien (vgl. Kapitel 4),
die Differentielle und Persönlichkeitspsychologie u. a. mit ambulanten Assessmentmethoden,
die Sozial- und Arbeitspsychologie, u. a. mit Kommunikations- und Organisationsanalysen,
die Kulturvergleichende Psychologie, u. a. mit der Untersuchung von Kulturdimensionen.
Da sich psychische Störungen und das mit ihnen individuell verbundene Leiden für die Betroffenen auf der seelischen Ebene abspielen, wird die Psychologie weiterhin die entscheidenden Beiträge zur Erforschung von Erkrankungen und mentaler Gesundheit leisten.
Zusammenfassung
Die Klinische Psychologie umfasst die Störungslehre (Psychopathologie), die klinisch-psychologische Diagnostik, die Beratung und die Psychotherapie. Grundlegend für das Fach ist es, die Begriffe von psychischer Normalität/Gesundheit und Störung/Krankheit gegeneinander abzugrenzen. Diese Abgrenzung erfolgt anhand von Normvorstellungen. Psychische Störungen und psychische Gesundheit sind zu definierende psychologische Konstrukte.
Ressourcen und psychische Stärken sind komplementäre Aspekte der Störungslehre und klinisch-psychologischen Diagnostik.
Die Entwicklung der Störungslehre war eng mit der Psychiatrie verbunden. Historisch gesehen, wurde die hirnpathologische Sichtweise durch die psychogenetische Perspektive ergänzt. Wichtigste Vertreterin der psychogenetischen Sichtweise war damals die Psychoanalyse. Heute existieren mehrere Grundmodelle der Störungslehre nebeneinander: Die einflussreichsten sind das medizinische, das psychodynamische und das lerntheoretische Modell.
Für die Beschreibung und Erforschung psychischer Störungen ist heute das bio-psycho-soziale Modell grundlegend, das durch einen jeweiligen störungsspezifischen Fokus ergänzt wird. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell bzw. Diathese-Stress-Modell ergänzt das bio-psycho-soziale Modell um Zeitverlaufs- und dynamische Aspekte. Es wird wiederum komplettiert durch die Einbeziehung des Ressourcenaspekts.
|31|Fragen
Kennzeichnen Sie den Gegenstandsbereich der Klinischen Psychologie und grenzen Sie ihn von der Psychiatrie und Medizinischen Psychologie ab.
Welche Gründe lassen sich anführen, weswegen heute bevorzugt von „psychischer Störung“ anstelle von „psychischer Krankheit“ gesprochen wird?
Nennen Sie die Normenaspekte, die zur Unterscheidung von „gesund“ und „krank“ bzw. „gestört“ und „normal“ herangezogen werden.
Was beschreibt der Begriff „Ressourcen“ in der Klinischen Psychologie?
Kennzeichnen Sie das medizinische Krankheitsmodell psychischer Störungen und diskutieren Sie seine Begrenzungen.
Erläutern Sie am Beispiel der schweren Depression das bio-psycho-soziale Modell in seinen Grundsätzen.
Definieren und erläutern Sie das Vulnerabilitäts-Stress- oder Diathese-Stress-Modell.
Lösungshinweise finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
|33|Kapitel 2Lern- und sozialpsychologische Grundlagen
Franz Petermann und Ulrich Stangier
|34|„Lernen“ ist ein vielfältiges und komplexes Konzept, das verschiedene Lernvorgänge gleichermaßen beschreibt und gegeneinander abgrenzt:
Begriffsklärung: Lernen
Lernen kann als relativ dauerhafte Veränderung im Verhalten oder den Verhaltenspotenzialen eines Lebenswesens in Bezug auf eine bestimmte Situation beschrieben werden, die auf wiederholter Erfahrung mit dieser Situation beruht (vgl. Petermann & Petermann, 2018).
Wesentlich bei Lernprozessen ist die relative Stabilität der Veränderung, wobei Lernen von kurzfristigen Veränderungen abgegrenzt werden kann, die z. B. durch Ermüdung entstehen. Gleichzeitig ist Lernen anders als biologisch determinierte Veränderungen wie Reifungs- oder Alterungsprozesse durchaus reversibel: Alles, was wir uns durch Lernen aneignen, können wir unter bestimmten Bedingungen auch wieder verlernen. In den folgenden drei Abschnitten wird ein Überblick über die wichtigsten Formen des Lernens gegeben, die für die Klinische Psychologie von Bedeutung sind.