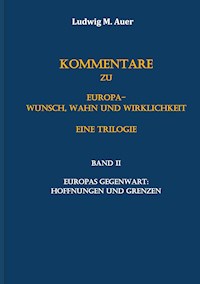
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Europa - Wunsch, Wahn und Wirklichkeit
- Sprache: Deutsch
Dieser Ergänzungsband beinhaltet 18 Kommentare zu Themen in Band II der Trilogie, der den Erwartungen, Verheißungen und Herausforderungen der Europäer und ihrer Union gewidmet ist. Zu den Themen zählen verschiedene Problemkreise im Zusammenhang mit Kultur, Multikulturalismus und Zivilisation sowie Rassismus und Hass im Vergleich zu Fremdenscheu und Revierverteidigung, einigen der Hintergründe der sozialen Konflikte innerhalb der EU und der Völker ihrer Nachbarschaft und der Welt. Bei der Besprechung der Migrationskrise erweisen sich die Probleme der Ursprungs- und Transitländer als untrennbar mit deren Geschichte der Kolonisation durch europäische Länder. Auch die Corona-Pandemie als weitere Krise der Gegenwart wird kritisch kommentiert, ebenso wie Brexit, kapitalistische Marktwirtschaft, Euro-Islam und die Beziehung zu Russland als weitere destabilisierende Faktoren für eine langfristig überlebensfähige Europäische Union.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Kommentare dienen als Ergänzung zum Text des Bandes „Europa. Wunsch, Wahn und Wirklichkeit. Band II: Hoffnungen und Grenzen. Dort sind die Hinweise auf diese Kommentare als Literaturhinweise vermerkt und mit einer Laufnummer versehen, z.B.K21
Anmerkungen zum Text
Mit einem Sternzeichen * markierte Textstellen sind vom Autor übersetzte fremdsprachige Originalzitate.
Hochgestellte Zahlen mit vorangestelltem “A”, z.B. Demokratie A39 stehen für Anmerkungen in Band I oder II, jeweils angeführt.
Hochgestellte Zeichen „M&D“,z.B. M&D, S.26 weist auf Text in meinem Buch „Mensch und Demokratie“, LIT-Verlag 2021 hin, mit entsprechendem Seitenhinweis.
Verweise wie z.B. „S. 104f“, gelten für zwei oder bei „S.104ff“ für mehrere Seiten.
Literaturzitate
„PW“ steht für Portal für Literaturwissenschaft; die einzelnen Artikel können unter https://www.pw-portal.de/die-krise-der-europaeischenunion/ abgerufen werden.
Bei manchen Literaturzitaten , die einen Verweis auf ein im Internet verfügbares Dokument enthalten, ist aus Platzgründen das „http://ww.“ oder die äquivalente Anfangsbenennung wie „https://“ weggelassen.
Inhalt
K1 Zusammenfassende Rückschau auf die Geschichte
Migration und Kultur
Die islamische Welt und Europa
Multikulturalität in der Geschichte
Toleranz
Eine Kultur für die ganze Welt – durch Handel?
K2 Weitere Gedanken zu Kultur
Zum Begriff “Kultur“
Wie sich Kultur aus Natur entwickelt
Kultur oder Zivilisation?
Kultur und Kulturgeschichte
Kultur und Religion
Der Mensch und sein Gott – Gott und seine Menschen
K3 Europa – Kulturfamilie, - raum, Kulturkreis – oder kulturlos?
Kultur und Kulturkreis
Geht der europäische Kulturkreis jetzt unter?
Verschmelzen Kulturen?
Europa und die Religionen
Was bleibt?
Keine Kultur ohne instinktive Gemeinsamkeit und Identität – und Identifikation
K4 Zu Zivilisation vs. Kultur bei Huntington
K5 Kritik an Huntingtons These des „Clash of Civilizations“
Gibt es eine Alternative zur Huntington-These?
Die Universalismus-Debatte
Ideologie, Hegemonie und Zukunft
Modernisierung vs. Verwestlichung
Der Expertenstreit um die Zukunft der Welt
K6 Reckwitz’s Hyperkultur
K7 Kritik der „Multikulturalität“
Multikulturelle Welt und multikulturelle Gesellschaft - Ein Missverständnis vorab
Kultur, Transkultur, Multikultur: Folgen versuchter Vermischung _
Kultur: gelebte Geschichte, könnte sie Fremden zugänglich sein?
K8 Zu Territorialität und Xenophobie
Territorialanspruch
Heimat und Nation, Territorialisierung und Abwehr
Xenophobie: Fremdenfurcht - Fremdenhass und Rassismus
Das „Wir-Gefühl“ - seine Innen- und seine Außenseite
Vom Vertrauten zum Fremden: zwischen Angst und Neugier
K9 Meghan und ihr braver Harry: Zur Rassismus-Debatte
K10 Kommentar zur Münchner Rede Putins 2007
K11 Die kapitalistische Welt-Alleinherrschaft
Amazon und die Weltherrschaft
K12 Der fatale Fehler der Engländer
Herr vergib ihnen, obwohl sie langsam wissen sollten, was sie tun
K13 Fluch aus dem Hades. Opfer der Corona-Pandemie
Man hatte nichts aus den vorangegangenen Pandemien gelernt
Corona, Korruption und Kapital – Herr über Leben und Tod:
Informationschaos
Corona und die doppelte Doppelbödigkeit
Statt evidenzbasierter Politik
K14 Aufklärung und Islam
K15 Die Situation in den Ursprungsländern der Migration
Syrien
Libanon
Palästina
Ägypten
Libyen
Tunesien
Marokko
K16 Medien, Manipulation und Macht
Die totalitäre Macht der Unterhaltungs“industrie“ im „Freien Westen“
K17 Brüssel und die Macht der EU
K18 Die aufgeklärte Welt? – Ein Epilog zur Gegenwart
Index
K1 Zusammenfassende Rückschau auf die Geschichte1
Migration und Kultur
In Band I hatten wir Völker und Volksstämme auf ihrem Weg nach und von und in Europa begleitet und rekonstruiert, woher sie kamen, wo sie blieben, wie sie miteinander umgingen. In der Überschau formt nun die Geschichte ein Bild der Völker, das dem Einzelmenschen als flexiblem, intelligentem Ausbeuter seiner Umwelt entspricht, mitunter beginnend beim Nächststehenden, und das schon seit Anbeginn:
Nach der Geschichte der Hebräer in Ägypten deportierten die Assyrer und Babylonier im 8. bzw. 6. Jh. v. Chr. erneut die führende Schicht des Volkes und bedienten sich ihres Wissens. Für die Hellenen waren alle besiegten Nachbarn Sklaven. Rom war gegenüber eigensinnigen Kulturen wie Karthagern, Kelten und Israeliten radikal: nur die vollkommene Zerstörung der Kultur und Versklavung der Bevölkerung kam in Frage. Caesar unterwarf und erlegte Bedingungen auf; bei Widerstand wurde vernichtet bis in die Wurzeln der Kultur – die Ermordung der Druiden auf der Insel Anglesey ist ein Beispiel. Rom lebte für sich selbst, überzeugte Manche der Ausgebeuteten durch seine Macht und Größe, ließ die Anderen in ihren Kulturen leben bleiben, solange sie gehorchten und zahlten.
Der historisch nur aus der Reaktion seines Umfeldes nachweisbare Jesus von Nazareth mit seinem Appell an Nachsicht mit der unüberwindlichen Fehlbarkeit des Fleisches aus der Sicht des lebenslang um die Dominanz ringenden Geistes erwirkte eine Zeitenwende, löste damit aber eine radikal- fundamentalistische Jagd des Glaubens auf verbotenes Wissen aus – Menschen verbrannten mit Büchern, Rom sank der neuen Macht in die Arme.
Die Franken waren mit Feuer und Schwert bemüht um Vereinheitlichung der Zivilisationen und Kulturen aus gallo-römischem, germanischem und slawischem Erbe – mit Karl dem Großen als Repräsentant und Lichtträger für die heutige Union. Der Nachholbedarf an Bildung der Einwanderer auf nicht-römischen Boden dauerte über mehrere Jahrhunderte; und man blieb einander feind und fremd zwischen West und Ost, Nord und Süd im Reich. Sogar im poströmischen Einflussbereich selbst war das Bildungsniveau durch die radikale Beseitigung allen paganen Wissens durch die Christen derart gesunken, dass die Karolingische Renaissance bei den meisten Priestern wieder damit beginnen musste.
Die kulturelle Vielfalt nach der Völkerwanderung in Europa ist zuerst durch die territoriale Abgrenzung der eingewanderten Volksgruppen entstanden, die von Anbeginn eine weitgehende genetische Homogenität beibehielten. Ihre Ballung innerhalb der heutigen Staatsgrenzen ist in Band II, Abb. 1 deutlich erkennbar. Der unterschiedliche Volkscharakter der heutigen Nationalstaaten lässt sich aus biologisch-anthropologischer Sicht auf deren unterschiedliches Mischungsverhältnis zurückführen, das sich aus den machtpolitischen Abgrenzungen quer durch solche ursprünglichen Territorien und auch durch Migrationen ergab. Alle diese Einwanderer entstammen jedoch dem gleichen Großraum der östlichen Steppen, beginnend am „Fruchtbaren Halbmond“, mit gemeinsamen Sprachwurzeln und ähnlichen archaischen Kulturformen. Deshalb ist Europa bis heute ein Kulturkreis mit dem einzigartigen Charakter seiner Nationen geblieben. Noch heute erkennt man uralte Volksgruppen an ihrer Eigenart, mitunter ihrer Segregation: versprengte Reste der von den Römern verdrängten Kelten im Baskenland und in Irland machen bis in unsere Tage Schlagzeilen, genetische Untersuchungen in Wales bestätigen ihre bis heute bewahrte genetische Eigenheit. Budapest und Paris, Stockholm und Rom, London und St. Petersburg, ihre Architektur und ihre Menschen haben ihre Eigenheiten, sind aber alle unverkennbar europäisch.
Die nüchterne Beobachtung dieser Entwicklung ohne ideologische Tönung weist auf ein Geschehen hin, das der genetischen Evolution und der aus ihr hervorgegangenen Artenvielfalt ähnelt: aus zusammenlebenden Verbänden wurden territorial abgegrenzte Großverbände mit Führungshierarchie, eigener Sprachentwicklung und Kultur. Sie tauschen sich in begrenztem Umfang aus, fließen aber nicht zusammen. Im Kulturkreis Europa überwiegen dennoch die Ähnlichkeiten vor den Unterschieden.
Friedliche und erzwungene Christianisierung hielten sich während der Völkerwanderung und danach bis über die Zeit Karls des Großen und König Stephans von Ungarn hinaus die Waage. Danach brach mit dem Hochmittelalter ein für unser heutiges Verständnis dunkles Zeitalter an, religiös-fundamentalistisch und intolerant, dogmatisch bis zur Lächerlichkeit, aber auch mörderisch herrschsüchtiger Gottesstaat, in dessen Mitte die Gehorsamen ein stilles Leben führen konnten, soweit sie nicht Militärdienst leisten mussten, und solange nicht Hungersnot und Seuchen die Welt zu einer Hölle machten, die schließlich den Glauben an diesen ordnenden und schützenden Gott tief erschütterten. Auch der Kampf zwischen kirchlicher und kaiserlicher Macht um die Vorherrschaft trug zu diesem Verlust an Glaubwürdigkeit bei.
Die islamische Welt und Europa
Die islamische Welt war zur Zeit ihrer maximalen Expansion im späten 7. und frühen 8. Jh. noch gar keine eigene Kultur – es war vielmehr eine aus einer christlichen Sekte hervorgegangene Religion im Stadium der Entwicklung, in einer kulturell äußerst vielfältigen geographischen Region zwischen Spanien und Indien. Toleranz bestand vielfach darin, aus Elementen eben erst eroberter Kulturen Anteile für eine in Entstehung befindliche eigene abzuleiten, beginnend mit der persischen, dann der byzantinischen. Die ersten Moscheen entstanden durch Umwandlung byzantinischer Basilika-Bauten mit ihren Kuppeln und Säulenhallen, wie der Kathedrale von Damaskus: sie war sogar für fast 100 Jahre noch gemeinsames Gebetshaus für Christen und Muslime. Die Mauren Spaniens machten Juden und Christen zu Bürgern zweiter Klasse, die besteuert, nur in Ausnahmefällen teilintegriert, in ihrer eigenen privaten Kultur – zwar meist in Frieden - jedoch segregiert leben durften. Vielen Menschen, die damals im Rang von Sklaven lebten, erging es besser als heute Jenen, die von Projekten zur Identifikation von versklavten Menschen trotz Satellitenüberwachung nicht erkannt werden.
Die Araber und osmanischen Muslime verachteten stets alles Europäische, wie in Band I anhand von Einzelschicksalen geschildert. Respekt und Anerkennung beschränkten sich auf die Hüter nützlichen Wissens und diplomatische Wanderer zwischen den Welten. In Städten und Landstrichen mit gemischt-kultureller Bevölkerung wie in den Weltstädten Alexandria, Jerusalem und Aleppo, oder am Balkan, verkehrten Anhänger unterschiedlicher Religionen zwar oft friedlich nebeneinander, lebten aber in getrennten Bereichen und schlachteten einander bei jeglicher Imbalanz der Macht im Laufe einer nun weit über tausendjährigen Geschichte regelmäßig ab.
Ich stelle mir vor, dass Kaiser Konstantin und seine Streitmacht im Jahr 312 n. Chr. auf dem Weg von Trier zur Milvischen Brücke in Rom durchaus ähnlich gesinnt waren mit dem Staurogramm (Bd. I, S. 379, A184) auf Schilden und Fahnen, wie es die muslimischen Eroberer von Kairo, Cordoba, Jerusalem und Ktesiphon, Susa und Persepolis waren: beseelt von einer neuen Kraft. Der Halbmond kann es allerdings auf deren Schilden noch nicht gewesen sein, denn der war das Wahrzeichen des alten Byzantion und kam erst 1453 bei der Eroberung Konstantinopels zum Islam.
Im Gegensatz zur Situation des Islam im 7. und 8. Jh. und des Christentums im 4. Jh. hat das Europa des 20. Jh. eine über 1000-jährige Geschichte kultureller Entwicklung hinter sich: blickt man in diese Geschichte zurück, so wird klar, dass es keine Tradition des tatsächlichen Zusammenlebens in einer multikulturellen Gesellschaft gibt, sondern nur eine lange Geschichte der Abwehr fremder Kulturen, von Abweichlern von der katholischen Zentralgewalt, zuletzt nur noch des eifersüchtigen Kampfes um Vormacht, sei sie religiös oder säkular. Toleranz war Thema von Philosophen untereinander oder im Diskurs mit den Herrschern ihrer Zeit. Erste Versuche waren seit den späten Jahren des 18. Jh. unterwegs. Als jedoch Mitte des 19. Jh. das Volk aufstand, um seine Interessen selbst in die Hand zu nehmen, zerfiel das europäische Machtmonopol der Monarchenfamilien. Zum aberen Mal im Karussell der Geschichte der Macht konnten sich im politischen Chaos Diktaturen etablieren, die viele dutzende Millionen Menschen das Leben kosteten.
Multikulturalität in der Geschichte
Juden in der Diaspora blieben bis ins 19. Jh. ausgeschlossen, in Ghettos oder als Außenseiter der Gesellschaft toleriert, stets der Gefahr neuer Übergriffe ausgesetzt. Nicht einmal deutsch-deutsche, nicht zu reden von innereuropäischer, Migration lieferte Beispiele nur kurzfristiger Integration; im Vordergrund stand das Verhalten der angestammten Bevölkerung, geprägt von Ausgrenzung, Erniedrigung und Benachteiligung der Immigranten, bis sich die Neuankömmlinge mühsam selbst integrierten oder im Laufe mehrerer Generationen in der Gastbevölkerung aufgingen.
Auch in den USA hat sich nie eine gemeinsame Kultur entwickelt. Sie leben in einer gemeinsamen Staatsordnung, leben aber nach unterschiedlichen kulturellen Gewohnheiten oder als Opfer von Rassismus, entweder als Neu-Europäer, als Lateinamerikaner, als Afro -Amerikaner, Mitglieder anderer Kulturen wie der chinesischen oder anderer, oder ohne jede Kultur im Gemeinschaftsgefühl amerikanischer Nationalität und deren zivilisatorischem Gefüge.
Aus dem Studium von Migration und Kultur im Rahmen von Band I konnte sich demnach nur bestätigen, dass es kein Beispiel für eine „multikulturelle“ Gesellschaft in der Geschichte im Sinne von Zusammenleben in einer Gemeinschaft trotz unterschiedlicher Herkunfts- und gelebter Kulturen gab, weil in dieser Erwartung von vornherein ein grundlegender Widerspruch liegt, eine irrige Hoffnung. Ausnahme ist gelegentliche, meist teilweise, religiöse Toleranz zu einem bestimmten Preis, in Form von barer Münze oder von Wissen bzw. Dienstleistung, wie im maurischen Spanien. Zu den Ausnahmefällen wie Jerusalem mit seiner über 1500-jährigen Geschichte von „Multikulturalität“ hatte ich gemeint: „Wenn es einen Ort gibt, der das ‘Zusammenfließen von Kulturen‘ bestätigen kann, es müsste Jerusalem sein“. Die wirkliche Situation ist allseits bekannt. Stets bedingte das „Dazukommen“ fremder Lebensgewohnheiten in eine bestehende Kultur die gegenseitige Ablehnung und Segregation.
Sogar bloße Multi-Ethnizität in einer übergeordneten Zivilgesellschaft ist ein sehr fragiles Phänomen, das als labiles Gleichgewicht dort existieren kann, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen oder Ethnien ohne jegliche Bevorzugung einer Seite innerhalb eines gemeinsamen Ordnungssystems leben, oder anderer Umstände wegen. Dieses Gleichgewicht geht verloren, sobald eine von zwei Interventionen geschieht: erstens: die politische Macht bevorzugt - und wenn auch nur andeutungsweise – eine der Parteien. Zweitens: eine der Parteien verhält sich missionarisch, dominant oder segregatorisch in einer Weise, die in das gemeinsame Ordnungssystem eingreift, indem sie besondere Regeln für sich selbst fordert, und damit selbst Anspruch auf Bevorzugung erhebt.
In den europäischen Kolonien der Neuzeit gab es alle Varianten des umgekehrten Vorgangs, des Ausgrenzens der unterdrückten, besiegten Einheimischen. Betreffend die Religion als Begleitphänomen der Kolonisierung stellt man alle möglichen Varianten fest, von der langjährigen merkantilen Kontaktnahme ohne direkte Missionierung am einen, bis zur mörderischen Zwangs-Christianisierung am anderen Ende der Skala.
Toleranz
Nicht selten vergisst man bei der Diskussion von Multikulturalität, dass Toleranz auch davon abhängt, wie lange und wie fest verankert eine Kultur ist, wenn sie mit einer anderen konfrontiert wird, wie unerschütterlich, oder wie geschüttelt: Das Römische Reich war zur Zeit seiner massivsten Gefährdung durch herandrängende Völker aus Ost und Nord in seinem Inneren gerade selbst in einem fundamentalen Umbau begriffen: seine heidnische kulturelle Kraft war dahin, Rom riss selbst seine Tempel nieder oder legte sie still, schloss seine Bibliotheken, verbat die Lektüre seiner Literaten und Wissenschafter. Das Christentum, neues Symbol der Macht, feierte seinen Antritt mit Bücherverbrennungen. Rom schloss selbst die Tore der Antike, seiner eigenen Welt. Der Kampf mit anderen Kulturen war vorbei. Die Führer des Christentums begannen, eine neue Welt in Europa zu formen, fundamentalistisch intolerant bis in die eigenen Reihen, entschlossen, einen Gottesstaat zu beherrschen.
Perioden der gegenseitigen Toleranz auf Distanz wechselten sich in der Menschheitsgeschichte stets mit Zeiten gegenseitiger Verfolgung ab. Episoden toleranter Parallelgesellschaften waren meist mit dem Namen von Herrschern oder Dynastien verbunden – auf einige Beispiele davon habe ich aus dem Lauf der europäischen und levantinischen Geschichte hingewiesen; sie alle zeigen, dass Toleranz von oben stets nur teilweise erfolgreich war, wenn überhaupt: Umayyaden-Kalifat in Cordoba, Theoderich, König der Ostgoten; Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation; König Georg III. von England im Jahr 1780, Sultan Abdülmecid des Osmanenreiches im Jahr 1850. Wann immer das Volk zu sprechen begann, kam es trotz herrscherlicher Edikte zu fremdenfeindlichen Übergriffen und Pogromen.
Bis heute ist die Situation unverändert: die Menschen haben keine Erfahrung, keine Übung im Umgang mit Toleranz. Immigranten sind daher einem besonders hohen Widerstandsniveau ausgesetzt; Segregation und Exklusion sind daher ausgeprägt wie eh. Die biologischen Hintergründe des Zusammenlebens von Sippen, Stämmen und Völkern habe ich an anderer Stelle angesprochen.M&D, Kap.2
Allenfalls wird diskutiert, ob nicht Europa, der Westen insgesamt, heute in einer ähnlichen Situation ist wie Rom im 4. Jh.: die innere Kraft dahin, die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass eine neue, äußere Kraft die Führung in andere Zeiten übernehmen könnte – eine solche „externe“ Kraft hält die Welt seit 2020 in Bann; als Kraft der Natur ist sie mitnichten neu, denn Seuchen gibt es seit Menschengedenken; geändert haben sich lediglich Gewahrsein und Umgang damit (den Satz vor dem Bindestrich hatte ich bereits 2018 geschrieben). Oder kann man hoffen, dass das Ausmaß von Bedrohung schon heute ausreicht, um aus neuem Gemeinschaftsgefühl neue Kraft für eine neue europäische Gemeinschaft zu schöpfen? Die Anzeichen sind undeutlich.
Eine Kultur für die ganze Welt – durch Handel?
Der hoffnungsfrohe Spruch „Wer Handel miteinander treibt, der schießt nicht aufeinander“ 2 traf zwar auf die Normannen bzw. Wikinger nicht zu, aber wer Handel treibt, Waren tauscht, tauscht Kulturgüter, tauscht Kultur – sie fließen nicht zusammen, aber sie tauschen sich aus:
Kulturen fließen nicht zusammen, schon gar nicht in Multikultur; sie grenzen sich voneinander ab, aber nehmen voneinander in einer ursprünglichen Form von Kommunikation, sie „tauschen sich aus“. Kulturen entstanden aus gemeinsamen Ursprüngen und entwickelten sich wie die Artenvielfalt des Lebens. Sprache, Religion, tradierte Sozialordnung, Kulturen also, haben zwar gemeinsame Ursprünge. Wie jedoch Menschengruppen verschiedene Winkel der Welt besiedelten und sich dort der Umwelt anzupassen begannen, entwickelten sie daraus eigene Formen wie Vögel auf einer Insel, deren Schnäbel sich den dort wachsenden Früchten anpassen. Treffen sie später wieder aufeinander, grenzen sie sich zunächst voneinander ab, verteidigen ihr Territorium. Sie beeinflussen und „befruchten“ einander zwar, entwickeln sich aber im Laufe der Zeit dennoch auseinander in dem Sinn, dass sie sich individuell ausdifferenzieren in unterschiedliche Richtungen. Sie begegnen uns heute in einem bunten Bild als Kulturkreise, Subkulturen, Nationen, Ein- oder Vielvölkerstaaten und separatistische Regionen. Was die ferne Zukunft aus der derzeitigen zivilisatorischen Globalisierung aus Kultur machen wird, lässt sich für mein Dafürhalten in keine auch nur annähernd konkrete positive Prognose fassen.
Ideologien wie Kommunismus und weltumspannende Gottesstaaten im Zusammenbruch von Sowjet-Russland, dem China von Mao Tse Tung und im Wirbel des Arabischen Frühlings sind derzeit im Westen nicht gefragt. Demokratie mit den Streitereien von Parteien und zunehmender Auflehnung gegen die resultierende Despotie der jeweiligen – oft zufällig entstandenen und nachgerade austauschbaren - Mehrheit begegnet uns auf nationaler Ebene wie auch dort, wo wir auf der Suche nach der gefühlten Gemeinsamkeit sind: in Europa. Werden wir sie noch in unserer Gegenwart finden?
Was die Entwicklung der Demokratie selbst anbelangt, so könnten sich Leser fragen, warum sie in diesem Überblick der sozio-kulturellen Entwicklung kaum erwähnt wurde – denn in der Tat ist sie das Ergebnis eines sozialpolitischen Prozesses, dessen sich Europa und die westliche Welt als Schöpfer rühmt: ich erachtete die Bedeutung davon groß genug für deren Besprechung in einem vollkommen separaten Band.M&D
Was sich in Europa entwickelte, kam als Kolonialismus über Nord- und weite Teile Südamerikas, Australien, Neuseeland und viele Inseln im Indischen und Pazifischen Ozean - und prägt seither die Menschenkultur dort: von Alaska bis Feuerland spiegeln die heute gebräuchlichen Sprachen die damalige Landnahme: englisch und minimale Anteile eines verballhornten Französisch, ab Mexiko gefolgt von spanisch oder portugiesisch – einige Berg- und Städtenamen erinnern noch an die Sprachen der ausgelöschten Indianerkulturen. Die Amerikas sind nun ein überwiegend christlicher Kontinent. Seit einigen Jahrzehnten bemühen sich indigene Restpopulationen um Respekt vor ihrem damaligen Status.
Fast fünftausend Jahre zuvor war inetwa derselbe Prozess den damaligen Europäern mit den indo-europäischen Invasoren aus der Steppe widerfahren. Damals hatten die Invasoren noch im Haus der Alt-Europäer gewohnt, ihre Bauernkultur genutzt und andere zivilisatorische Errungenschaften; aber sie hatten Pferd und Wagen mitgebracht. Die Römer hatten im Kulturhaus der Griechen gewohnt, deren Tempel und Götter übernommen, sich sogar selbst als griechischer Abstammung bezeichnet. Die Invasoren der Völkerwanderung wurden – teils mit Feuer und Schwert - in die kulturelle Welt des christlichen Rom hineinerzogen; ihre Herkunft verrät sich am resultierenden Sprachmix (z.B. franko-lateinisch) und an einigen in das Kirchenjahr hineingewobenen alten Bräuchen.
Der globale Kolonialismus der europäischen Neuzeit erscheint als die bisher fast härteste und brutalste Verdrängung und Vernichtung indigener Kulturen. Sie resultierte in der 2. Hälfte des 20. Jhs. in einen universalen Anspruch auf die Definition von Recht und Moral, festgeschrieben in den Regeln der Vereinten Nationen. Im Chaos der Gegenwart finden sich nun auch Facetten von Betretenheit, Scham und Verantwortungsgefühl, Einsicht in Verpflichtung Europas und seines Westens gegenüber dem Rest der Welt. Europa, das in der Renaissance neugeborene, prägt den Großteil der Welt mit seinem universalistischen Anspruch auf allgemeingültiges Verständnis von Recht und Ethos, von Moral und Sitte – in Einem jedoch importiert es sein schizoides Verhalten zwischen Sollen und Möchten, abgewickelt in einem mehrbödigen, teils verdunkelten System – Recht gehört allzu oft nicht sich selbst, sondern der Macht, oder kriminellen Ausbeutern einer liberalen Gesellschaft, die zu träge ist, sich zur Wehr zu setzen. Dazwischen aber, immer dort, wo gerade keine Macht eines nationalen Einheitsstaates regierte, entwickelte Europa „die stärkste geistige Kraftquelle unseres Planeten“ 3 - im Griechenland des perikleischen Zeitalters, im Italien der Renaissance, im Deutschland des ausgehenden 18. Jhs. Schöpfungen der Geisteskraft, einerseits Produkte regionaler Kultur, wirken aber gleichzeitig zwischen den nationalen Eitelkeiten, bilden die Verbindungsebene im Kulturkreis, die stärker und beständiger ist als die zerstörerisch-zerstückelnden und raffenden Machtbestrebungen der Dynastien, Clans und Banden. Je größer und innerlich sicherer ein Machtkoloss wird, so könnte man zusammenfassen, desto träger wird der Kollektivgeist, aus dem allein große Geister große Gedanken schöpfen können.
1 Einzelne Satzfolgen habe ich aus Band I hierher übernommen.
2 U. Menzel, Globalisierung versus Fragmentierung, Suhrkamp 2002, S. 49.
K2 Weitere Gedanken zu Kultur
Zum Begriff “Kultur“
Der Begriff Kultur steht für eine Momentaufnahme im Prozess der kulturellen Evolution; letztere entwickelt sich wie die genetische Evolution; nur ist die kulturelle Folge einer undurchschaubaren Verwebung von Massenverhalten und individuellem „Denken“ als Phänomen des Nach-Denkens und Be-Denkens der Ergebnisse der kosmischen und der genetischen Evolution, eine Rekonstruktion der Ereignisse in Gedanken, Fragen, Nachfragen, Nachforschen. Geologie, Paläo-Anthropologie bestehen in diesem Nachfragen und Nachdenken über die Ereignisse anhand beobachtbarer Phänomene, also Zusammenhangs- und Zusammengehörigkeitsanalyse. Dieses Forschen ist ein Zusammengehörigkeits-Finden, das dem Nach-Denken entspricht. Die Zusammengehörigkeiten selbst hängen ab von der entsprechenden Erkenntnis im Denkprozess, sind also ein Konstrukt des bewussten Denkprozesses. Geheimnisvoller sind die Phänomene menschlichen Massenverhaltens, in die jene individuellen Erkenntnisse einfließen in den Prozess der kulturellen Evolution:
Wie sich Kultur aus Natur entwickelt
Wie „Natur“ ist auch „Kultur“ ein evolutionärer Prozess, einer, der sich in und über Generationen fortspinnt, als Mode und Zeitgeist,4 der sich den jeweiligen, sich ändernden, Umweltbedingungen anpasst: passiv in der biologischen Evolution, aktiv in der kulturellen. Inwieweit unsere aktiven Anpassungsprozesse, diese intellektuellen Leistungen, erst recht wieder nur dem biologischen Diktat folgen, wissen wir (noch) nicht genau – ein Hauch vom Odem der „Natur“, eine Pandemie von tödlichen Viren, und der kulturellen Evolution könnte ein jähes Ende gesetzt sein. Jedenfalls hat uns diese besondere Gabe des Gewahrwerdens des eigenen Gewahrseins auch eine Welt der Ideen beschert, der Vorstellungen und Ahnungen von dem, was die Wahrheit sein mag hinter alledem, was wir wahrnehmen können. So entwickelt sich über die Jahrtausende die menschliche Erkenntniswelt, Konstrukt und Annäherung an die wirkliche Wirklichkeit. Wir nennen es Wissen, Kennen und Können, weitergegeben von Generation zu Generation, oder neu konstruiert von der einen, wieder zerstört von der nächsten und ersetzt durch eine neue, immer virtuelle, immer konstruierte Welt, erdacht aus einfacher Beobachtung, oder ersonnen aus diesem Gewölk von Vorstellungen und Erwartungen, die uns einfallen angesichts der Welt um uns, und kollektive Verhaltensmuster hervorrufen.
Was aber ist denn nun „Kultur“, zum Beispiel zum Unterschied von „Zivilisation“?
Kultur oder Zivilisation?
Im Gespräch zwischen Kulturfremden fallen außer der Kleidung zuerst die überraschenden Unterschiede im Verhalten auf: der Inder, der den Kopf – wenn auch unnachahmlich sonderbar – schüttelt, wenn er „Ja“ meint; der Japaner, der „ja“ sagt, wenn er „nein“ meint; der Tibeter, der zur Begrüßung die Zunge herausstreckt; Gesten, die unverständlich alarmierende Spontanreaktionen oder Verunsicherung beim Gegenüber hervorrufen, wenn deren Bedeutungen dem kulturfremden Gegenüber unbekannt sind oder ihn reflexartig reagieren machen, nur eben auf andere Weise, als der Gestikulierer dies erwartet hätte.
Im Umherwandern auf Erden ist es die Betörung der Sinne, die sich an nichts Gewohntem mehr festhalten können, die Klarheit schafft: der Anblick von Gebäuden wie aus einem märchenhaften Traum, der Duft der Luft, die Melodie der Sprache und der Musik, ihr Rhythmus, der sich auf das fremde Gewoge der Bewegungen der Menschen auf der Straße überträgt zu einem wundersam fremden Ganzen. Sie machen ohne Sprache verstehen, was Kultur ist, und erinnern an die eigene, am Unterschied. Meine kürzeste Erklärung: Zivilisation ist die praktische Ordnung des Gemeinschaftslebens einer Kultur. Wo die beiden einander weit überlappen, ist Kultur jener Anteil, der Wirklichkeit und Miteinander transzendiert und das spontane „so Sein“ repräsentiert. Beim Versuch, die Begriffe aus einer Nationen- übergreifenden Sicht zu definieren, vor allem nicht nur aus der eines einzelnen Sprachbereichs, z.B. angesichts des westlichen oder europäischen Kulturkreises, stößt man schon in der inner-westlichen Diskussion zwischen dem deutsch-sprachigen und dem englisch-sprachigen Bereich auf unterschiedliches Verständnis zwischen den Begriffen „Kultur“ und „Zivilisation“: Huntington springt in „Kampf der Kulturen“ wiederholt zwischen den Begriffen und erzeugt den Eindruck, als verwendete er die Begriffe so, wie es aus Sicht der USA günstiger scheint;5 weitere Kritik dazu steht hier unter Kommentar K4.
Kultur und Kulturgeschichte
Der Begriff „Kultur“ bezeichnet insofern von vornherein in mehrfacher Hinsicht die Befassung mit „Geschichte“, als „Kultur“ selbst bereits der gegenwärtige Ausdruck tradierter kollektiver Erkenntnis ist, also Berufung auf Geschichte.
Darüber hinaus kann sie sich – auch vergleichend - mit vergangenen Kulturen befassen, deren Eigenheiten sich nun wieder in zeitlicher Umkehr auch in den gegenwärtigen Ausdrucksformen von Kulturen verbergen (und künftige mitbedingen), gerade so wie körperlich einmal ausgebildete Formen aus der Evolution nicht verschwinden, sondern sich nur umformen oder teilweise zurückbilden können.
Kultur und Religion
Menschen gleicher Kultur,





























