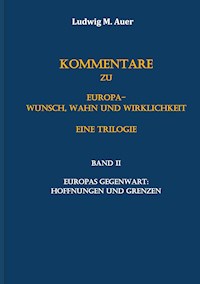Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Ergänzungsband beinhaltet 37 Kommentare zu Themen im Buch Mensch und Demokratie, z.B. zum Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft; zur Position von uns Einzelnen in der liberalen Demokratie; zu Demokratie-Theorien und ihrer politischen Philosophie; zum Verhältnis zwischen Großmächten wie USA und China zur Demokratie und ihren Werten; zur fraglichen Langlebigkeit von Demokratie aufgrund ihrer intrinsischen Schwächen; zur Bedeutung von Ethik und Erziehung als Überlebensstrategie für Demokratie; zu Strategien gegen Machtmissbrauch; zum Vorschlag einer neuen Form direkter Demokratie, einer "Volks-Epistokratie" mit der Möglichkeit zur Beteiligung aller Bürger an evidenzbasierten politischen Entscheidungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Kommentare dienen als Ergänzung zum Text des Bandes „Mensch und Demokratie. Streitschrift für eine globale Sozial-Ethik. Dort sind die Hinweise auf diese Kommentare als Literaturhinweise vermerkt und mit einer Laufnummer versehen, z.B.E21
Inhalt
E1 Erziehung bei Aristoteles
E2 Demokratie - und die USA
E3 Wahl und Abwahl von Politikern: Chance oder Gefahr für Demokratie?
E4 Wer sind die Hauptschuldigen an der Umweltkrise?
E5 John Locke’s „state of nature“
E6 Rousseau’s Sozialkontrakt
E7 Die Sozialwahl-Theorie und ihre Risiken
E8 Brennan’s politischer Philosophie im Lichte der Human-Ethologie
E9 Hirnfunktion, Verhalten - und Politik
E10 Canetti, Masse, Macht und Paranoia
E11 Individuum, Gesellschaft und Kultur bei Sigmund Freud
E12 Ur-Vertrauen und soziale Bindungen
E13 Zur politischen Philosophie der Gleichheit
E14 Von der ökonomischen Theorie zu Liberalismus und Neo-Pluralismus..
E15 Kants kategorischer Imperativ
E16 Herbert Marcuse, die Demokratie und ihr sado-masochist. Syndrom
E17 Die westlichen Demokratien – und China
E18 Papst Franziskus‘ Kampf gegen das technokratische Paradigma
E19 Repräsentative Demokratie, die Quadratur des Kreises
E20 Migration und Rechtsstaatlichkeit
E21 Pressefreiheit und Manipulation in der liberalen Demokratie
E22 Kritik der Sozial-Epistemologie
E23 Kritik der deliberativen Demokratie
E24 Das Ende der alten Welt
E25 Der ideale Staat?
E26 Poppers „Offene Gesellschaft
E27 Fluch aus dem Hades
E28 Leidenschaft und Erbsünde bei Konrad Lorenz
E29 Gleichheit, Menschenwürde und -rechte bei Jürgen Habermas
E30 Negative und positive Freiheit
E31 Herkömmliche vs. Neue Subsidiarität
E32 „Economic survival of the fittest“: Von Moral und Wirtschaftsmacht
E33 Über die moralische Verpflichtung zur, und den Glauben an, Erziehung
E34 Erziehung und Gesellschaft – Demokratie auf dem Weg zu sich selbst
E35 Volks-Epistokratie
E36 Übereinkunft: Die Antithese zum Diktat der Mehrheit
E37 Aggression und Macht
Sachregister
E1 Erziehung bei Aristoteles
Die Inhalte der Erziehung zum Bürger sind in der „Nikomachischen Ethik“ von Aristoteles verankert. Er unterscheidet dabei Belehrung (Wissensvermittlung als verstandesmäßige Tugenden) von der Einführung in die ethischen Tugenden durch Gewöhnung und Sozialisation. Damit zielt er auf eine Formung der menschlichen Charaktereigenschaften. Als Basis für seine Ethik wählte er dabei das Mittelmaß zwischen extremen Ausprägungen wie z.B. Gerechtigkeit als Mitte zwischen Unrechtleiden und Unrechttun, Besonnenheit als Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit.1 Dabei reicht es nicht, festzustellen, dass der Mensch ein „sprach- und vernunftbegabtes Lebewesen, sowie … ein politisches Lebewesen [ist], das seinen Sinn und Zweck … nicht in sich selbst, sondern nur in der Interaktion und Kooperation mit seinesgleichen finden kann …“.2 Wenngleich die Erkenntnis an sich essentiell für eine gelingende Gemeinschaftlichkeit ist, so kann es auch nicht ausreichen, den Lebenssinn zu definieren als ein „im kollektiven Handeln, in der Gemeinschaft, der Kommunikation und Interaktion mit anderen, die … ihren Zweck in sich selbst trägt …“. Denn Gemeinschaftlichkeit ist nicht einfach ein Drang des vernunftbegabten Wesens mit dem Ziel eines „sinnerfüllten Lebens“, sondern ein a priori für die Menschwerdung,3 die untrennbar mit dem Spracherwerb und verbalem Denken verbunden ist.
Das Problem mit diesem Vorschlag des Aristoteles besteht aber vor allem in dem alles entscheidenden Henne-Ei-Problem: Aristoteles spricht zwar auch von der „Verwirklichung und Anwendung der Tugend, die durch „die Natur, die Gewöhnung und die Vernunft [bedingt sei]. Zwar sind einzelne zur Tüchtigkeit erforderliche Charaktereigenschaften durch die Erbanlagen festgelegt, doch müssen die meisten erst durch Sozialisation und Lernprozesse aktiv erworben werden. Ihrer Entfaltung hat die Erziehung in der Polis zu dienen“.4 Für eine erfolgreiche „Gewöhnung und Sozialisation“ muss aber zuerst eine solche imitations- und eingewöhnungswürdige Gesellschaft nach Aristoteles‘ Vorstellung existieren, in die ein Nachkomme hineinwachsen kann. Wenn Erziehung dazu dienen soll, das Sozialverhalten zu bessern, hat die jeweilige Gesellschaft ein Problem. Außerdem wird man, betreffend die Inhalte der Erziehung nicht umhinkommen, zuerst zu definieren, welche der typischen Eigenschaften der Natur des Menschen asozial sind, also dem Erziehungsziel der Sozialisation – und auch dem eigentlichen Wunsch und Drang der zu Erziehenden zum Zusammenleben – zuwiderlaufen. Erst dann ist man in der Lage, Gewöhnung und Vernunft entsprechend zu beeinflussen, um asoziales Verhalten durch Erziehung erfolgreich verhindern zu können. Für diese Erziehung wird es auch nicht reichen, einen sozial-kompatiblen „Soll-Menschen“ durch Zwang und Drill zu erzeugen. Vielmehr wird man sich um die Einsicht des Menschen in seine asozialen Tendenzen bemühen müssen, um zu erreichen, dass er sich seinerseits tatsächlich um deren Selbstkontrolle bemühen will. (Als einleuchtende Begründung schlage ich in Kapitel 3 vor, bei der Beurteilung des reziproken Altruismus als moralischem Prinzip durchaus das opportunistische Element darin hervorzuheben. Als entsprechende Methoden zur Selbstkontrolle schlage ich dort „Neu-Orientieren“ bzw. „Ausmanövrieren“ vor). Zwar spricht auch Aristoteles in der „Nikomachischen Ethik“ von „Tausch-Gerechtigkeit“,5 also einer Form von „miteinander-Auskommen“ auf reziproker Basis, jedoch nicht von jener Ethik, die später in ähnlicher Form als „Reziprozität“ und „reziproker Altruismus“ eingeführt wurde.
Das Henne-Ei-Problem bleibt jedoch für jegliche Versuche ungelöst, bei denen innerhalb kurzer Zeit die Umgestaltung der Gesellschaft angestrebt wird: an dieser Stelle erkennt Aristoteles einerseits den einzigen funktionierenden Erziehungsweg, der diktiert, dass auch nach einer Belehrung und Einsicht eine Phase der Gewöhnung und Sozialisation folgen muss. Gleichzeitig beschreibt er damit das notwendige Versagen solcher Erziehung in eine bessere Gesellschaft: der junge Mensch wird belehrt, wie er sein und werden sollte, damit eine Gemeinschaft besser funktioniere; dann aber gewöhnt er sich an die alten, bestehenden Verhaltensgewohnheiten seiner Vorgeneration – nichts ändert sich als Folge der „kulturellen Erbsünde“ (siehe E28).
1 K. Roth, Aristoteles, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 48.
2 Aristoteles, Politik I, 1253a2f und III, 1278b19ff, zit. bei K. Roth, Aristoteles, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 48.
3 L.M. Auer, https://ereigniszeit.com/2017/10/26/die-menschwerdung/
4 ebd.
E2 Demokratie - und die USA
Die Demokratie der USA war – und ist bis heute - eine Timokratie. Jahrzehntelang der Weltpolizist für Frieden und Freiheit, wird der Super-Staat auch heute nicht als eine vollwertige Demokratie angesehen.6: schon anfangs hatten nur Männer von Ansehen und Besitz das Wahlrecht; heute werden großteils nur Millionäre zu Repräsentanten des Volkes.7 Die Unabhängigkeit der USA vom Mutterland Großbritannien begann als Republik unter Ausschluss des eigenen Volkes. Die Gründerväter gingen “vom vollkommenen Ausschluss der Bevölkerung in ihrer Funktion als Gemeinschaft von jeglicher Teilnahme [an der Regierung] ”aus.* 8 “Wie Alexander Hamilton und James Madison in Federalist No. 63 klar ausdrückten, sollte die amerikanische Republik im wesentlichen – so ihre besondere Betonung – ‘vom vollkommenen Ausschluss der Bevölkerung in ihrer Funktion als Gemeinschaft von jeglicher Teilnahme [an der Regierung] [gekennzeichnet sein]‘ ”.*9
Die Meinung der frühen Politiker der USA von Demokratie war nicht hoch: George Madison, Governor von Kentucky und Cousin von Präsident James Madison, nannte Demokratie “ … die übelste Form von Regierung ... ebenso kurzlebig wie gewalttätig, wenn sie endet .” 10 John Adams, der zweite Präsident der USA, meinte, dass “Demokratie nie lange besteht. Sie nutzt sich bald ab, erschöpft und vernichtet sich selbst“.*11 Der vierte Präsident, James Madison, zog entschieden die Schaffung einer Republik vor und verabscheute die Demokratie.
In Artikel 10 der Federalist-Papers steht: „Eine Republik, womit ich ein Regierungssystem meine, in dem das Konzept der Repräsentation verwirklicht ist, eröffnet ganz andere Perspektiven und bietet das Heilmittel, nach dem wir suchen … Die beiden entscheidenden Unterschiede zwischen einer Demokratie und einer Republik sind: erstens, die Delegierung der Herrschaftsgewalt an eine kleine Zahl von den Übrigen gewählter Bürger in letzterer, zweitens, eine größere Anzahl von Bürgern und ein größeres Territorium, auf das die Republik ausgedehnt werden kann“. 12 Eher unfreiwillig war “Das Verfassungsmodell der Federalists [ ] demokratisch, weil es die Regierung frei, im Rahmen der berechtigten männlichen weißen Bevölkerung, nur zum Teil von Eigentums- oder Steuerqualifikation eingeschränkter Wahlbevölkerung bestimmen ließ und den Regierungswechsel, erstmalig 1800/01 im Übergang von den Federalists zu den Jeffersonian Republicans, in einem friedlichen, konstitutionellen Rahmen ermöglichte. Das war ... zugleich auch ... der Beginn der Parteiendemokratie“.13 So sehr die Entwicklung letztlich demokratisch gewesen sein mag, so sehr war sie gleichzeitig der Beginn von Polarisierung und damit a priori autodestruktiv.
Madison attackierte die biologische Gegebenheit unvermeidlicher Clanbildung in jeder Gesellschaft sehr direkt, nannte sie „factions“ und sprach von ihnen als etwas nachgerade kriminellem, jedenfalls asozialem, mit den Worten “Unter einer „faction“ verstehe ich eine Gruppe von Bürgern, ... die durch gemeinsamen Impuls und Leidenschaft vereint und angetrieben, sich gegen die Rechte anderer Bürger oder gar auf Dauer gegen die Interessen der Gemeinschaft stellen“.*14 Madison erkannte, dass “faction”, also die Bildung von Clans und Gangs, zu den essentiellen Vorgängen im Leben zählen, bereits im Tierreich, und stellt fest, dass „die latenten Ursachen der „factions“ in die Natur des Menschen eingewoben [sind]“.* 15 Er erkennt auch, dass „menschliche Vernunft anfällig“ ist im Sinne von Verhaltensmustern wie „common sense“ und „unbelehrbaren Lehrmeistern“.16 In Madison’s Worten ist eine Republik, die er anstatt einer Demokratie vorschlägt, “eine politische Ordnung, in welcher die Regierung an eine kleine Gruppe von Bürgern delegiert wird, die vom Rest der Bevölkerung gewählt werden”.* 17 In diesem Sinn sind alle unsere heutigen Demokratien Republiken, für die “repräsentativ” nichts anderes bedeutet als die Regierung an die Führung einer politischen Partei oder Koalition zu übertragen. Demgegenüber suchten die Anti-Federalists zu verhindern, dass die Souveränität der einzelnen Republiken an einen neuen Super-Staat verlorenging und die Macht in der Zentrale von einer neuen Clique von Repräsentanten übernommen würde, die dort ihre Repräsentierten vergessen – ähnlich wie die heutigen EU-Mitgliedsstaaten. Letztlich blieben die Anti-Federalists mit ihrer rückwärtsgewandten Vorstellung von kleinen, homogenen Gemeinschaften nach klassischem Vorbild unterlegen; die Federalists setzten sich mit ihrem pragmatischeren Vorschlag durch, mit dem man auf alte Tugenden verzichtete und auf die ordnende Kraft von Gesetzen baute: „Denn dort kann sich der Bürgerstatus auf die periodische Stimmabgabe oder auch auf simples Desinteresse beschränken“.18
Grayling 19 meint, dass die Verfassung der USA eher “republikanisch” als “demokratisch” sei, indem sie aus einer Mischung von “gewählten, indirekt gewählten und ernannten Körperschaften [besteht], die untereinander “die öffentlichen Ansichten verfeinern” und dadurch zwei Präsidentschaften später die “Demokratie Jefferson’s (Jeffersonian democracy)“ von der populistischeren „Demokratie Jackson’s (“Jacksonian democracy)“ abgrenzen”* würden. Letztlich fasst er zusammen mit der Frage “ob diese Lösung des Dilemmas in dieser Form vertretbar ist - des Dilemmas, inwieweit die Zustimmung und Autorisierung durch die Wählerschaft als tatsächlich gegeben angenommen werden kann in einem System, dessen Strukturen sie pasteurisieren würden (einige würden es kastrieren nennen)”.* 20
5 Aristoteles, Nikomachische Ethik V, 4, 1130a15ff, und Politik I, 1256b40ff, zit. bei K. Roth, Aristoteles, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 48.
6 P. Horst et al., Die USA – eine scheiternde Demokratie?, Campus Verlag 2018
7 A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 76.
8 Zitat aus dem Federalist Paper Nr. 65, zit. von Y. Mounk, The People vs. Democracy. Why our freedom is in danger, and how to save it. Harvard Univ. Press 2018, S. 55.
9 Y. Mounk, The People vs. Democracy. Why our freedom is in danger, and how to save it. Harvard Univ. Press 2018, S. 55.
10 George Madison, ref. A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 80, zit.3
11 A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 80, zit.4.
12 Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Die Federalist-Artikel, Art. 10, zit. von D. Jörke, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 143.
13 H. Vorländer, Demokratie, Verlag Beck 2010 ( 2003), S. 66f.
14 A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 83.
15 ebd, S. 84.
16 L.M. Auer, Mensch und Demokratie. Streitschrift für eine globale Sozial-Ethik, LIT-Verlag 2021, S. 70ff.
17 A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 86.
E3 Wahl und Abwahl von Politikern: Chance oder Gefahr für die Demokratie?
Christiano 21 weist auf die Gefahren hin, sich in unkritischer Überzeugtheit und träger Selbstzufriedenheit treiben zu lassen, ohnehin „Demokratie zu haben“, wenn er “… Schumpeters Ansicht [zitiert, der zufolge] die Bürger zur Vermeidung eines größeren Desasters eine Rolle zu spielen haben. Wenn Politiker in einer für jedermann erkennbar problematischen Weise handeln, können die Bürger sich dagegen auflehnen. Damit schützt die Demokratie auch in ihrer reduzierten Version die Bürger vor den schlimmsten Politikern”.* Das Argument entspricht jenem von Karl Popper 22 und William Riker,23 wonach man Regierungen durch Abwahl wieder loswerden könne. Eben diese theoretische Ansicht ist in unseren Tagen durch rezente Erfahrungen zunichte gemacht: die Wahl eines Kandidaten führt eher zur Polarisierung in einem Land, als dass das gesamte Volk sich gemeinsam gegen eine falsche Wahl stellen würde, weil eben ein Teil der Bevölkerung diesen Politiker befürworten kann. Überdies nützt die Abwahl-Option in vielen Fällen nicht gegen unerwünschte Politiker-Entscheidungen: denn ehe das Volk erfolgreich reagieren kann, ist einerseits die Entscheidung längst umgesetzt, und andererseits kann ein politischer Führer nachfolgen, der zwar die Entscheidung des Vorgängers rückgängig macht, aber erneut unerwünscht entscheidet.
Da die Bürger einen Diktator demokratisch wählen können – aus der Geschichte kennen wir hierzu Beispiele und den Ausgang der Episoden - fragt sich, ob Schumpeter tatsächlich das Risiko eingehen wollte, dass eine Demokratie derartige Erfahrungen wiederholte; Popper warnt an diesem Punkt sogar vor einem wohlmeinenden Diktator: “Eine der Schwierigkeiten, mit denen ein wohlmeinender Diktator konfrontiert ist, besteht darin, herauszufinden, ob seine guten Absichten auch mit den Erfolgen übereinstimmen (wie dies schon de Tocqueville vor über einhundert Jahren klar gesehen hat). Die Schwierigkeit erwächst aus der Tatsache, dass autoritäre Führung Kritik unterdrückt; daher wird der wohlwollende Diktator nur schwer von Beschwerden hören ... “.*24 Aus der Sicht tatsächlicher Gegebenheiten ist das Problem eher, ob diese guten Absichten – wessen auch immer, des Monarchen, Diktators oder der Demokraten – mit der verfügbaren Evidenz übereinstimmen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. „Gute Absichten“ sind nicht gut genug, solange sie nicht der kritischen Evidenzanalyse unterzogen wurden und standhalten. Das zweite Problem ist, dass Kritik von Gruppen der Bevölkerung kommen könnte, die keine guten Absichten haben oder nur einen Teil der gesamten Interessen repräsentieren. Man wird an dieser Stelle an die Lage von Kaiser Karl V. im 16. Jahrhundert erinnert, als er die Fürsten des Reiches von der dringenden Notwendigkeit zu überzeugen versuchte, den Südosten vor der Aggression des Osmanischen Reiches zu schützen: sie aber sahen lediglich ihre momentanen regionalen Interessen und waren an gemeinsamen militärischen Aktionen nicht interessiert.
Und es gibt noch einen dritten Aspekt: heute kehrt sich die Situation um, weil regionalistische oder Interessengruppen-basierte Kritik und Unzufriedenheit aus dem Volk ehrliches politisches Bemühen in der demokratischen Politik lähmen. Kritik wird zu Konfrontation zwischen den Parteien, die schließlich in einem kalten Krieg 25 zum politischen Stillstand führt. Aus Angst vor Abwahl tritt lähmende Inaktivität der Politiker ein, oder hohler Aktivismus.
18 D. Jörke, Anti-Federalists, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 153.
19 A.C. Grayling, Democracy and its crisis, Oneworld 2017, S. 81.
20 ebd, S. 83.
21 Tom Christiano, Democracy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, REF. 82.
22 Karl Popper, Essay Zur Theorie der Demokratie. Der Spiegel 32/1987. 03.08.1987.
23 H. Buchstein, Anthony Downs, in P. Massing, G. Breit, H. Buchstein Hrsg., Demokratie-Theorien, Wochenschau Verlag 2017, S. 234.
E4 Wer sind die Hauptschuldigen an der Umweltkrise – die Politik, die Zivilgesellschaft oder die Ökolokraten?
Während ich in „Mensch und Demokratie“ den Mangel an Erziehung als eine der Hauptursachen des Versagens von Demokratie als langfristig stabilem politischem System skizziere, entwickelt sich die Umweltkrise als eine ihrer entscheidenden Folgen: gleich ob man sie als „a priori-Fehler“ oder „Fehler im Webeplan“ demokratischer Ideologie bezeichnet, die Väter der Demokratie haben sie mit ihren eigentlichen Zielen wie eine Krankheit mit eingeschleppt, mit ihren staatlichen Institutionen konnten sie diese Folgen nicht vermeiden. Im Gegenteil.
Diese modernen liberalen Demokratien sind damit von vornherein - und bleiben ohne Wandel – außerstande, die selbstvernichtenden Prozesse erfolgreich einzudämmen, geschweige denn, die anderen Kulturkreise der Welt von den überlegenen Qualitäten der Demokratie zu überzeugen: ihre Bürger, die gerademal an die 20 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sind die Hauptverursacher einer außer Kontrolle geratenen Umweltverseuchung. Das Bekenntnis zum Liberalismus erzwang nachgerade die freie kapitalistische Ausbeutung der Umwelt zu Hause und in den früheren Kolonien, rücksichtslos gegen die Tier- und Pflanzenwelt, und damit gegen sich selbst.
Zum größten pharisäischen Selbstbetrug der westlich orientierten demokratischen Welt zählt, dass sie China – und für viele chemische Erzeugnisse auch Indien - zur Produktionsstätte ihrer Güter werden lässt, diese Länder jedoch gleichzeitig auf populistische Weise dafür verantwortlich macht, zu den Ländern mit der größten Schadstoffemission geworden zu sein, allen voran China. Diese Darstellung ist nämlich in zweifacher Hinsicht irreführend: denn die Berechnung der Schadstoffemission pro Kopf, also von jedem von uns Bürgern in den Ländern der Welt, ergibt ein vollkommen anderes Bild: Lässt man die pro-Kopf-Hauptverbraucher weltweit, die arabischen Staaten, beiseite, dann führen Kanada, USA und Australien die Rangliste der größten Umweltsünder an; mit einigem Abstand folgen Südkorea, Japan und Deutschland. Diese Feststellung genügt jedoch bei weitem noch nicht, denn es kommt noch deutlich schlimmer: ein perfider Betrug und Selbstbetrug kommt zutage, wenn man bei der Berechnung ein Verbraucherprinzip einführt, indem man die chinesischen Schadstoffemissionen jenen Ländern zurechnet, die chinesische Produkte importieren. China, mit etwa 30% Anteil an der globalen Umweltverpestung der größte Luftverschmutzer (gefolgt von USA, Indien, Russland, Japan und Deutschland), steht jedoch mit seiner pro-Kopf Emission weltweit an 40. Stelle, also weit hinter allen westlichen Demokratien, den Käufern.26, 27 Für eine tatsächlich faire Gegenüberstellung müsste also diese pro-Kopf Berechnung der Umweltbelastung durch die Industrie im eigenen Land auch noch gegen die Exporte und Importe aufgerechnet werden. Mit großem Abstand „Importweltmeister“ sind die USA, gefolgt von Großbritannien, Indien und Japan.28 Berechnet man nun die pro-Kopf Umweltverschmutzung nach dem Prinzip des tatsächlichen Konsums – einschließlich jener Güter, die ein Land in einem anderen Land produzieren ließ, sowie auch abzüglich jener, die ein Land produzierte und exportierte – dann stehen unter den großen Ländern der Welt die USA einsam an der Spitze mit 28 Tonnen CO2-Ausstoß pro Bürger und Jahr, Deutschland bei 18, Russland bei 14, China bei 8 und Indien bei 3; die EU-Staaten verursachen tatsächlich etwa 30% mehr Umweltverschmutzung als die internen Zahlen der einzelnen Länder bisher auswiesen (Daten aus 2011).31, 32 Nähme man lediglich die Handelsbilanz als isolierte Basis für diese Form der Konsumenten-orientierten Aufrechnung nach dem Verursacherprinzip, dann stünde statt den USA Großbritannien mit seiner weltgrößten negativen pro-Kopf Handelsbilanz von minus 3015 US$ an der Spitze der Länder der Welt, gefolgt von USA mit minus 2623 und Frankreich mit minus 1384 US$.29 Richtig ist zwar auch, dass diesem Zustand die positiven Bilanzen von Deutschland mit +3600 US$, von Südkorea mit +1700 und von Japan mit +1400 pro Bürger und Jahr entgegenstehen;30 entscheidend ist jedoch, dass China mit einer pro-Kopf Bilanz von +117 $ zu Buche steht und Indien mit minus 114 $. In jedem Fall bleiben demnach bei fairer Betrachtung die westlichen Länder als Hauptverbraucher die Hauptverursacher der zunehmend bedrohlichen Umweltverpestung. Westliche Medien zeigen hingegen vordergründig die Umweltsünden von Entwicklungs- und Schwellenländern. Erste zaghafte Hinweise sind zu hören auf das, was in Wirklichkeit die dringendste Hauptmeldung unserer Tage sein sollte: die Bürger der westlichen Industrieländer müssen sich einschränken; die Energiewende muss in den westlichen Demokratien beginnen; der Trick mit dem Auslagern Umweltverschmutzender Industrie fällt auf sie, die Verursacher, zurück, als Umweltkrise, die zur Katastrophe zu werden droht. 3132,
Das dampfend-gleißende Licht unter der gläsernen Glocke der Zivilisation überstrahlt den Blick auf die Umgebung, ihre Herkunft, ihre Mutter, die Natur. Im Halbdunkel draußen häufen sich die Müllberge erstickend über Land und Meer. Wie durch eine Schallmauer getrennt, gestikulieren und brüllen Aktivisten, bewegt Greta Thunberg kaum erkennbar ihre Lippen; nur ihre Transparente bleiben lange genug auf den Bildschirmen für die Wenigen unter den zappenden Zombies, die besorgt innehalten. Schon drängen die nächsten Bilder von Sehnsucht-lockender Werbung und erregendem Infotainment nach, überrollt der ohrenbetäubende Alltagslärm der Sachzwang-getriebenen Wahnsinnigen die stille Wirklichkeit vor dem Sturm. Wenn der dann die Glaswand zertrümmert und wegfegt, steht der Mensch in seiner Wüste.
Greta Thunberg und die Politik
Es gibt keine beunruhigendere Dokumentation der Demaskierung politischer Macht in der westlichen Welt, als die Gruppenphotos mit Greta Thunberg, dem schwedischen Teenager, Photos, aufgenommen, während das eben dem Kindesalter entwachsende Mädchen den Politikern in einfachen Worten deren Untätigkeit, Mutlosigkeit und Schwäche vorhält. Da werden Politiker und andere Prominente vorgeführt, so, als wären sie derart herabgekommen, dass sie sich keiner Gelegenheit zu entziehen vermögen, dort öffentlich mit aufzutreten, wo alle Welt soeben neugierig hinschaut, nur um eben gesehen zu werden. Platon beschrieb diese Szene vor 2500 Jahren.A24 Es gibt kein signifikanteres Phänomen der Gegenwart als die Aktionen von Kindern und Jugendlichen, die gefilmt und kommentiert werden, während die verantwortlichen Erwachsenen die Umweltverpestung unvermindert weiter betreiben, gerade so, als redeten ihre Kinder von einem anderen Planeten aus einem Kindermärchen. Wenige bemerken, dass erst diese Bewegung von Kindern und Jugendlichen eine breite öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema Umweltkrise bewirkt; niemand hat bisher den Grund für diesen Erfolg erklärt. Man ist zu befangen, zu betreten, ihn einzugestehen: sie haben nichts zu verlieren außer ihrer Zukunft, diese Nachkommen – alle betretenen Zuschauer hingegen haben einen Grund dafür, warum sie bisher geschwiegen haben und weiter schweigen, weitermachen: die Einen, weil sie (aus Sachzwängen) (gerne) viel fliegen (müssen), die Anderen, weil sie sich keine beruflichen Aussichten verbauen wollen (man denke nur an Politiker, die schon lange den Mut hätten aufbringen sollen, unpopuläre Maßnahmen zum Umweltschutz durchzusetzen, oder an Ökonomen und Politologen, die nicht aufhörten, die pharisäische Unaufrichtigkeit ihrer Politiker zu kritisieren, weil sie die Konsum-basierte Berechnung der pro-Kopf CO2-Bilanz konsequent unter dem Teppich halten – die Mehrzahl der Nutznießer des derzeitigen Wohlstandes versteckt sich gerne hinter ihrer politischen Repräsentanz, die den Aufruf zu ihrem Programm machen, diesen Wohlstand auf Kosten von Umwelt und Dritter Welt aufrechtzuerhalten (siehe Anm.A212). Wieder Andere möchten nicht darauf verzichten, trotzdem hin und wieder mal so richtig Gas geben zu können, oder wenigstens, sich angesichts all dessen, was da angeblich so alles an Unwetter und sonstiger Aggression auf uns zugerollt kommt, sich schon jetzt wie in einem Panzerfahrzeug geschützt zu fühlen. Werden die Kinder dieser Zuschauer sich demnächst weigern, von ihren Eltern per “SUV” in die Schule gefahren zu werden?
Ökolokraten: die Manager der Umweltkatastrophe
Diese Manager sind Angestellte globaler Industrien, die ihrerseits Politiker zur Informationsweitergabe instrumentalisieren. Diese Information muss ein klein wenig davon beinhalten, das wie Aufrichtigkeit wirkt, mit Slogans wie: in der Tat bewegen wir uns nahe an einer Umweltkatastrophe, aber die Situation ist kontrollierbar, und zwar auf folgende Weise: ihr Leute, das Volk, die Kunden, ihr seid für die Umweltverschmutzung verantwortlich, beispielsweise den Plastikteppich auf den Ozeanen – es ist also nicht nur nicht die Industrie, die tatsächlich für die Verbreitung von jährlich Millionen Tonnen von Plastik verantwortlich wäre, die Industrie darf in diesem Zusammenhang sogar nicht einmal genannt werden, sie ist vielmehr zu schützen und aus der Debatte herauszuhalten. Dies gilt in gleicher Weise für den Abfall aus der Chemischen Industrie, für Atommüll, für den CO2 Ausstoß von allen möglichen weiteren Produktionsstätten der Industrie und sonstigen Aktivitäten (Luftfahrt ist hier ein Hauptsünder). Die Politik managed die ökologische Krise, trotz ihrer Geiselhaft in der Industrie – oder nicht?
Selbstverständlich nicht. Von der Industrie sanft bedroht mit dem Argument der Job-Sicherheit kann sie umso leichter einer Meinung mit ihren Wählern sein, dass harte Maßnahmen zum Schutz der Biosphäre – der Grundlage für unser Überleben - nicht zumutbar wären: nicht zumutbar für die Bürger, denn sie, damit sind wir gemeint, müssten ja ihre Lebensgewohnheiten ändern. Auch nicht für die Politiker, denn sie würden ihre Positionen riskieren, wenn sie unpopuläre Maßnahmen ankündigten. Vor allem darf man nicht vergessen, dass sich solche Maßnahmen schon allein deshalb nicht durchsetzten, weil solche mutigen Politiker kurzfristig durch andere, „vernünftige“, ersetzt würden.
Politiker treffen sich auf Großkongressen, um dort Maßnahmen zuzustimmen (z.B. Agenda 2030, Pariser Klima-Abkommen), an die sich dann niemand in dem dringend erforderlichen Umfang hält. Als Marionetten der Wirtschaft spielen die liberaldemokratischen Politiker das Spiel der rationalen Irrationalität bis zum bitteren Ende, weil irgendein surrealer Sachzwang zu diktieren scheint, dass es sich hierbei um die einzige realistische Lösung handle – eine ähnlich wahnsinnige Wirklichkeit erlebte meine Generation im Kalten Krieg mit der von Demokraten mitbezahlten Schaffung eines x-fachen atomaren Overkills. Als typisches Beispiel für die Gegenwart dient wieder der Plastikmüll: an die 9 Milliarden Tonnen davon sind mittlerweile über den Erdball verteilt, weitere 800 Millionen Tonnen kommen jedes Jahr dazu; aber effektive Maßnahmen seitens der Politik sind nicht sichtbar – stumm und erwartungsvoll, aber machtlos, blickt sie auf die Industrie. Dort wird wieder mit Ökolokratie geantwortet: mit Zahlen, die beweisen sollen, dass die Situation jährlich besser werde. Die Zivilluftfahrt ist hierfür ein Beispiel: die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Triebwerken wurde regelmäßig überholt von der Zunahme von Flugzeugen und Passagierzahlen;33 milliardenschwere Finanzhilfen für die Luftfahrtindustrie aus Steuergeldern zeigen, dass man nicht gewillt ist, die Corona-Krise als Fanal für eine Umkehr zu akzeptieren.
Zahllose weitere Beispiele weisen auf den Wahnsinn solcher politischer Hilflosigkeit. Anlässlich neuer Warnungen an der letzten globalen Konferenz betreffend die bedrohliche Zunahme von Plastikmüll in den Weltmeeren kamen prompt Versicherungen verschiedener Politiker über alle Medien-Kanäle zum Ergebnis, dass unverzüglich weitere Maßnahmen eingeleitet würden. Als einen der ersten Schritte kündigten sie an – man konnte seinen Ohren nicht trauen – dass man die Industrie auffordere, Alternativen für Wattestäbchen zu suchen.
In der Meinung von Papst Franziskus „nimmt oft die wirkliche Lebensqualität der Menschen im Zusammenhang mit einem Wirtschaftswachstum ab, und zwar wegen der Zerstörung der Umwelt, wegen der niedrigen Qualität der eigenen Nahrungsmittel oder durch die Erschöpfung einiger Ressourcen. In diesem Rahmen pflegt sich die Rede vom nachhaltigen Wachstum in eine ablenkende und rechtfertigende Gegenrede zu verwandeln, die Werte der ökologischen Überlegung in Anspruch nimmt und in die Logik des Finanzwesens und der Technokratie eingliedert, und die soziale wie umweltbezogene Verantwortlichkeit der Unternehmen wird dann gewöhnlich auf eine Reihe von Aktionen zur Verbraucherforschung und Image-Pflege reduziert“.34, E18
24 K. Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge 2011 (1945), S. 149.
25 L.M. Auer, Mensch und Demokratie. LIT-Verlag 2021, S. 175ff.
26 J. Merlot, Wer ist Klimasünder Nummer eins? Spiegel online, 13.12.2018 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimakonferenz-in-katowice-wer-ist-klimasuender-nummer-eins-a-1241962.html, abgefragt am 02.05.2019
27 UN-Millenium Development Goals Indicators, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=751&crid=, abgefragt am 02.05.2019
28https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242564/umfrage/laender-mit-dem-groessten-handelsbilanzdefizit/, abgefragt am 03.05.2019
29https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242564/umfrage/laender-mit-dem-groessten-handelsbilanzdefizit/, abgefragt am 03. 05. 2019.
30https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=145&l=de, abgefragt am 03. 05. 2019
31 K.W. Steininger et al., Austria’s consumption-based greenhouse gas emissions: Identifying sectoral sources and destinations, in: Global Environmental Change 48, 2018, S. 226-242.
32 K.W. Steininger et al., Multiple carbon accounting to support just and effective climate policies. In: Nature Climate Change 6, 2016, S. 35-41. doi:10.1038/nclimate2867.
E5 John Locke‘s „state of nature“ und „natural law“
John Locke‘s Konzept von “Naturgesetz” (natural law) konnte natürlich die evolutionären Aspekte von individuellem und Gruppenverhalten nicht berücksichtigen, wenn er “argumentierte, dass die Menschen Grundrechte unabhängig von den Gesetzen irgendeiner Gesellschaft haben, wie das Recht auf Leben, Freiheit und Besitz. Locke benutzte seine Forderung nach naturgegebener Freiheit und Gleichheit als Rechtfertigung zum Verständnis einer legitimen politischen Regierung als Ergebnis eines Gesellschaftsvertrages”.*35
Das tatsächliche Naturgesetz des frühen Menschen wird jedoch bestimmt von den in der Evolution entstandenen Eigenschaften und repräsentiert durch die Einbindung des Individuums in Sippe, Clan und die dazugehörigen Abhängigkeiten und genetisch bedingte Verhaltensautomatismen. Ein Recht im Sinne eines naturgegebenen Anspruchs existiert als Ergebnis dieser Evolution hingegen nicht. Nur das geistige
Erwachen und Erkennen der tatsächlichen Gegebenheiten kann die Menschen zur Einsicht bewegen, dass sie zwecks Stabilisierung ihrer Sicherheit einen Sozialkontrakt abschließen und einander Rechte zusprechen bzw. Beschränkungen auferlegen, um asoziales Verhalten in gegenseitigem Einverständnis einzudämmen.
Mit „naturgegeben“ kann auch bei Locke ohnehin nur ein moralisches Recht im Rahmen eines Sozialkontrakts gemeint sein, da ein Recht immer nur ein soziales Phänomen sein kann. Insofern besteht in dieser Argumentation eine gewisse Zirkularität, bzw. resultieren die Rechte aus dem Gesellschaftsvertrag und nicht umgekehrt. Dies zeigt sich entsprechend an Beispielen aus dem wirklichen Leben: im Kriegsfall gibt es kein Naturrecht auf Leben; desgleichen nicht angesichts von Verbrechen und Todesstrafe, noch auf Freiheit bei lebenslänglichem Gefängnis.
Leben ist also eine biologische Möglichkeit, kein Naturrecht. Desgleichen ist Freiheit kein Naturrecht, sondern das Ergebnis eines Erkenntnisprozesses: Freiheit entsteht, indem Menschen einander gleiche Würde, also Anspruch auf Respekt einräumen: „Freiheit“ ist dieser von Allen mit gleichem Anspruch eingeräumte und beanspruchte Raum.
Es trifft in der Regel eben nicht zu dass „die Menschen im Naturzustand schließlich überein[kommen], sich politisch zu organisieren und eine Regierung zu bilden“. Stattdessen entsteht aus der in vormenschlicher Zeit entstandenen instinktiven hierarchischen Gesellschaftsordnung eine neue Ordnung zur Regelung und Beschränkung bewusst ausgelebten und ausgekosteten instinktiven Verhaltens. Insofern ist also Hobbes‘ Vorschlag der Realität eines sozialen Urzustandes näher, in dem „Recht … erst … vom absoluten Herrscher geschaffen“ wird (beide Zit.36).
Locke’s Standpunkt könnte man verstehen als Reaktion auf die Forderung nach Hierarchie als Ausdruck des Gotteswillens, weil aus der Anbindung an Religion der säkulare Machtmissbrauch gerechtfertigt wird. Tatsächlich gibt es außer „gesetzmäßig“ ablaufenden körperlichen Automatismen nur das, was er als „positives Gesetz“ – positive law - bezeichnet, nämlich den Gesellschaftsvertrag. Richtig ist, dass in der Evolution sozial gewachsene Gewohnheiten Naturgesetzcharakter annehmen und Locke’s “state of nature”, “natural law”, zugeordnet werden könnten; sie betreffen jedoch insgesamt nur Verhalten, keine Rechte. Insgesamt geht aus solchen Gedanken jedoch der fundamentale Wandel hervor, der sich in den Köpfen dieser Vordenker wie Locke vollzieht: nämlich religiös fundiertes Glauben durch rationales Denken und Schlussfolgern zu ersetzen. Inkongruenzen in Texten dieser Zeit müssen teilweise auch auf Vorsicht und Überlebenswillen der Autoren zurückgeführt werden, die feststellen, dass die Naturbeobachtung und das rationale Denken zu anderen Ergebnissen führen kann, als dies der religiöse Glaube vorschreibt. Wer also leben will, muss wohl hin und wieder möglichst vage umschreiben anstatt klar zu beschreiben, um nicht der Inquisition anheimzufallen.
Auch die von Kant postulierte naturgegebene Moral – als a priori - gibt es nicht: Kant schrieb: „Das Fundament der praktischen Vernunft und der ethischen Verpflichtung ist aber das Faktum der Vernunft und das moralische Gesetz „in mir“.37 Auch dieses Gesetz in mir ist lediglich das Ergebnis des evolutionären Prozesses, teilweise auch bereits der kulturellen Evolution. „Tötung“ als Mord zu bezeichnen ist ein Beispiel:
es gibt eine tief in der Evolution verwurzelte Tötungshemmung innerhalb einer Spezies, Kultur oder Sippe (s. hierzu auch A331); ebenso gibt es aber den legalisierten Mord als Ergebnis eines Sozialkontrakts, wie im Krieg, im Gesetz, unter Kannibalen, als religiös-rituelle Tötung. Einige Verhaltensweisen früher Völker stechen besonders hervor, wie die Grausamkeiten der mongolischen „Goldenen Horde“, oder zeitgeschichtliche Greueltaten, die allesamt keinen Hinweis auf die Existenz eines moralischen a priori erkennen lassen. Die Tötungshemmung ist jedoch eine äußerst starke und tief verwurzelte Kraft - möglicherweise eine jener Kräfte, auf die sich Kant mit seinem vermeintlichen a priori beruft: Sigmund Freud bezieht sich in seinem Werk „Totem und Tabu“ auf frühe völkerkundliche Forschung bei damals noch in vielen Regionen anzutreffenden Naturvölkern; er beschreibt Schuldgefühle bei Stammeskriegern nach Tötung von Feinden, und Riten, mit deren Hilfe sie vom Fluch aus dem Tabubruch befreit wurden, den sie durch die Überwindung ihrer Tötungshemmung begangen hatten.38