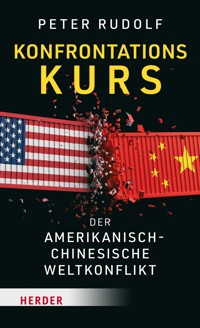
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Chinas Machtzuwachs weckt in den USA die Angst, den Status als vorherrschende Supermacht zu verlieren. Die Trump-Administration stilisierte die Auseinandersetzung mit China zu einem ideologischen Konflikt, und auch Biden führt diese Rhetorik fort, um innenpolitische Unterstützung für einen Machtkonflikt mit China zu mobilisieren. Dabei liegt die größte Gefahr für die zukünftige Weltordnung in der verbalen Aufrüstung auf beiden Seiten: Die gegenseitige Bedrohung wird immer intensiver wahrgenommen, die Gefahr der Eskalation steigt. Peter Rudolf analysiert die Gefahren und zeigt, wie sich Europa in diesem aufziehenden Weltkonflikt positionieren kann, um seine eigenen Interessen zu wahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Rudolf
Konfrontationskurs
Der amerikanisch-chinesische Weltkonflikt
Mit einer Karte von Peter Palm; © Peter Palm, Berlin
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: total italic
Umschlagmotiv: © rawf8 / shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timișoara
ISBN Print: 978-3-451-39947-3
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83294-9
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83296-3
Inhalt
Einleitung
1. Die USA und der Aufstieg Chinas
1.1 Die USA und China im Kalten Krieg
1.2 Amerikas zweigleisige Chinastrategie nach dem Kalten Krieg
1.3 Chinas Weg zur Weltmacht
1.4 Machtübergangstheorien als Deutungsrahmen
1.5 Machtkonkurrenz als Narrativ der amerikanischen Chinapolitik
2. Das amerikanisch-chinesische Konfliktsyndrom
2.1 Hegemonialkonflikt und neue Bipolarität
2.2 Der ideologische Systemantagonismus
2.3 Das Sicherheitsdilemma
3. Dimensionen und Dynamik der strategischen Rivalität
3.1 Die regionale Dimension: Rivalität um die Vormachtstellung im pazifischen Asien
3.2 Die globale Dimension: Rivalität um weltweiten Einfluss
3.3 Die technologische Dimension: Rivalität um die Vorherrschaft im digitalen Zeitalter
4. Der neue strukturelle Weltkonflikt und seine Folgen
4.1 Konfrontationskurs
4.2 Wirtschaftliche Entflechtung und ihre Risiken
4.3 Wenig Raum für Kooperation
4.4 Europa und Deutschland: Mit den USA gegen China?
Epilog
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Empfohlene Literatur
Karte
Anmerkungen
Über den Autor
Einleitung
Die USA sind in ihrem traditionellen Selbstverständnis eine „pazifische Macht“ – oder wie es seit einigen Jahren meist heißt: eine „indopazifische Macht“.1 Zugleich verstehen sie sich nach wie vor als unentbehrliche Führungsmacht, die die Stabilität des internationalen Systems sichert. Chinas Aufstieg wird in den USA daher weithin als bedrohlich wahrgenommen. So heißt es in der National Defense Strategy von 2022 mit Blick auf die „strategische Konkurrenz“ mit China: „Die umfassendste und ernsthafteste Herausforderung für die nationale Sicherheit der USA ist das zwangsgestützte und zunehmend aggressive Bestreben der VR China, die indopazifische Region und das internationale System nach ihren Interessen und autoritären Präferenzen umzugestalten.“2
Die Volksrepublik China ist der einzige Staat, der als „potenzielle Supermacht“ den Status der USA bedrohen kann.3 China möchte eine wirtschaftliche, technologische und kulturelle Weltmacht werden und größeren Einfluss auf die Spielregeln internationaler Politik nehmen. Das ist zumindest die Vision, die Xi Jinping als Teil der Erneuerung der chinesischen Nation verfolgt. Den Legitimitätsanspruch der Kommunistischen Partei Chinas hat er so auch mit der Verwirklichung einer internationalen Führungsrolle Chinas verknüpft.4
Mittlerweile werden die Konflikte in den Beziehungen zu China nicht nur in der amerikanischen Debatte oft als eine Art neuer Kalter Krieg gedeutet. Doch wie jede Analogie ist auch diese problematisch und von begrenztem Nutzen. Anders als zwischen den USA und der Sowjetunion existiert zwischen den USA und China keine Konfrontation zweier abgeschotteter gegnerischer Blöcke, sondern eine Konkurrenz um Einfluss innerhalb eines globalisierten internationalen Systems, in dem die beiden Mächte nach wie vor wirtschaftlich hochgradig verflochten sind. Die strategische Rivalität zwischen den USA und China enthält jedoch die Ingredienzen, sich zu einem „strukturellen Weltkonflikt“ zu verfestigen. Von einem solchen Konflikt lässt sich sprechen, „wenn die Staaten (insbesondere die Großmächte oder bedeutsame Mächtegruppierungen) unvereinbare oder unvereinbar erscheinende Tendenzen hinsichtlich der Organisation (Struktur) des internationalen Systems verfolgen“.5
Die geopolitische, ökonomische und ideologische Rivalität zwischen den USA und China hat sich zu einer Konfliktkonstellation entwickelt, die mehr und mehr die internationalen Beziehungen prägt und ein hohes wirtschaftliches und militärisches Risikopotenzial birgt. Es ist daher nicht übertrieben, von einer „Epoche strategischer Konfrontation“ zu sprechen, von einer Konfrontation, die enorme Auswirkungen auf das „Schicksal der Menschheit im 21. Jahrhundert“ haben könnte – Auswirkungen auf Frieden, Wohlstand, Klimasicherheit.6 Das gilt zumal, wenn es über Taiwan zu einem Krieg zwischen den beiden stärksten Wirtschaftsmächten der Welt kommen sollte – zu einem Krieg zwischen zwei Nuklearmächten, einem Krieg mit beträchtlichem Eskalationsrisiko und unkalkulierbaren Kosten und Konsequenzen.7
Doch wie ist es zu dieser Konfrontation gekommen? Was liegt diesem Weltkonflikt zugrunde? Wie wird er ausgetragen? Was sind seine Folgen für die internationale Politik und für Deutschland und Europa? Das sind die Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden.
Im ersten Teil richtet sich der Blick zurück: zunächst auf die Annäherung zwischen den USA und China in den 1970er Jahren in einer Art strategischer Partnerschaft, die gegen die Sowjetunion gerichtet war, dann auf die Jahrzehnte pragmatischer Kooperation in der Zeit nach Ende des Kalten Krieges, in denen die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und China trotz zahlreicher Konflikte stetig wuchs. Die primär auf Kooperation und Integration Chinas in das internationale Wirtschaftssystem setzende amerikanische Politik unter den Präsidenten Clinton, Bush und Obama war begleitet von militärischer Risikoabsicherung für den Fall, dass sich die mit dem „engagement“ verbundenen Erwartungen nicht erfüllen sollten: Dies war zum einen die Erwartung, die chinesische Führung werde ein Interesse an der Stabilität des internationalen Systems entwickeln. Das war zum anderen die Erwartung, über wirtschaftliches Wachstum, die Modernisierung und Entstehung einer Mittelschicht werde die Demokratisierung des Landes gefördert. Doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht, was unter Xi Jinping immer deutlicher wurde: Die autoritäre Verhärtung im Inneren geht einher mit einer ambitionierten Weltpolitik, mit der die internationale Ordnung nach chinesischen Vorstellungen geformt werden soll. Aus chinesischer Sicht sind es die USA, die bislang vorherrschende, sich aber im Abstieg befindende Macht, die sich dem Prozess der „großen Erneuerung der chinesischen Nation“ entgegenstellen. Aus vorherrschender amerikanischer Sicht bedroht China die eigene internationale Führungsrolle, und die Volksrepublik will die Weltpolitik nach illiberalen Wertvorstellungen prägen. Der Konflikt zwischen den USA und China gilt mittlerweile als Teil einer fundamentalen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie.
Im zweiten Teil des Buches folgt eine Strukturanalyse des amerikanisch-chinesischen Konfliktsyndroms. Dessen Grundlage bildet eine regionale, aber auch zunehmend globale Statuskonkurrenz. In den USA hat Chinas erwarteter und tatsächlicher Machtzuwachs Ängste vor einem Statusverlust hervorgerufen. China gilt als langfristige Bedrohung für die internationale Führungsrolle der USA und die damit einhergehenden sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Privilegien und Vorteile. Diese Konkurrenz um Einfluss mischt sich mit einem ideologischen Antagonismus. Auf chinesischer Seite war diese Dimension – die empfundene Bedrohung der kommunistischen Parteiherrschaft durch Vorstellungen liberaler Demokratie – schon immer stark ausgeprägt. Auf amerikanischer Seite ist der Wertekonflikt inzwischen stärker in den Blickpunkt gerückt. Diese Mischung aus Statuskonkurrenz und ideologischer Differenz gibt dem Konfliktsyndrom seinen besonderen Charakter. Da sich die USA und China seit der Taiwankrise 1996 (wieder) als potenzielle militärische Gegner sehen und die Planungen danach ausrichten, prägt auch das Sicherheitsdilemma die Beziehungsstruktur. Im Zuge des Ausbaus der chinesischen Nuklearrüstung gewinnt die nukleare Abschreckung für beide Staaten zunehmend an Bedeutung. Beide Seiten sind nicht besonders sensibel für dadurch ausgelöste wechselseitige Bedrohungsvorstellungen. Denn die Antagonisten verstehen sich selbst als defensive, friedliche Mächte, unterstellen der jeweils anderen Seite aber offensive Absichten.
Im dritten Teil werden Dimensionen und Dynamik der strategischen Rivalität zwischen den USA und China analysiert. Die sich zuspitzende strategische Rivalität, die in unvereinbaren Zielen und wechselseitigen Bedrohungsvorstellungen wurzelt, hat eine regionale, eine globale und eine technologische Dimension. Regional geht es um die Vormacht im Indopazifik, global um Einfluss und im technologischen Bereich um die Führungsrolle. Die Rivalität ist besonders in der maritimen Peripherie Chinas ausgeprägt, dominiert von militärischen Bedrohungsvorstellungen und der amerikanischen Auffassung, China wolle in Ostasien eine exklusive Einflusssphäre etablieren. Im Südchinesischen Meer kollidiert der amerikanische Anspruch auf freien Zugang zu den Weltmeeren mit dem chinesischen Bestreben, eine Sicherheitszone zu errichten und die amerikanische Interventionsfähigkeit zu konterkarieren. Weniger bedeutsam, aber gleichwohl vorhanden sind die militärischen Bedrohungsperzeptionen in der globalen Einflusskonkurrenz, die mittlerweile auch die Arktis umfassen. Washington versucht mit Anreizen und Druck, andere Staaten vom Ausbau ihrer wirtschaftlichen Beziehungen mit China abzubringen. Wie insbesondere die Kampagne gegen den chinesischen Konzern Huawei zeigt, ist die globale Einflusskonkurrenz eng mit der technologischen Dimension der amerikanisch-chinesischen Rivalität verwoben. Es geht dabei um die Vorherrschaft im digitalen Zeitalter. Diese Dimension des Konflikts ist deshalb so essenziell, weil technologische Führung weltwirtschaftliche Wettbewerbsvorteile schafft und die Basis für militärtechnologische Überlegenheit sichert.
Im vierten Teil geht es um die Auswirkungen des amerikanisch-chinesischen Weltkonflikts auf die internationale Politik und die Folgen für Europa und Deutschland. Seine Konsequenzen können weitreichend und seine Kosten hoch sein, wenn sich der Prozess geoökonomischer Fragmentierung beschleunigt, die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und China sich auflöst und sich möglicherweise eine neue geoökonomische Weltordnung herausbildet. Sicher scheint bereits: Die strategische Rivalität mit China prägt die US-amerikanische Außenpolitik in starkem Maße. Weithin herrscht Einigkeit, dass die Politik des „engagement“ gescheitert ist. Die Biden-Administration verfolgt eine Politik kollektiver Gegenmachtbildung. Dabei ist die europäische Kooperation besonders dort gesucht, wo es um die Verweigerung von Hochtechnologie für China geht. Gewiss ist Europa daran gelegen, nicht zum Spielball chinesischer Weltmachtpolitik zu werden. China wird nicht mehr länger vor allem aus dem Blickwinkel wirtschaftlicher Interessen und Chancen gesehen. Doch Chinas Aufstieg berührt die USA und Europa in unterschiedlichem Maße, sodass auch die Bedrohungswahrnehmungen vermutlich weiterhin voneinander abweichen dürften. Für Europa ist die sicherheitspolitisch-militärische Perspektive nicht vorrangig und überschattet daher auch nicht alle anderen Bereiche. Zwar hat die Covid-19-Pandemie auch in Europa zu einer veränderten Sicht der Abhängigkeiten von China geführt; jedoch nicht im Sinne einer möglichst weiten Entkopplung, sondern einer Risikominderung und Diversifizierung von Lieferketten und Produktionsstätten. Für Deutschland und Europa stellt sich mehr denn je die Frage, wie man sich im amerikanisch-chinesischen Weltkonflikt positioniert, wie viel Schulterschluss mit den USA geboten, wie viel eigenständige Politik gegenüber Peking notwendig und möglich ist.
Diese Analyse beruht in Teilen auf einigen Vorarbeiten, die im Laufe etlicher Jahre als Studien und kürzere Papiere der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) erschienen sind, die jedoch für das vorliegende Buch überarbeitet, erweitert und aktualisiert wurden. Kritik und Anregungen vieler Kolleginnen und Kollegen sind eingeflossen. Ihnen und den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die für eine einzigartige Informationsinfrastruktur sorgen, gilt mein herzlicher Dank. Besonders danken möchte ich meiner langjährigen Kollegin und hervorragenden Chinakennerin Dr. Gudrun Wacker, die die SWP-Studie „Der amerikanische Weltkonflikt“ (Oktober 2019) kommentiert und begutachtet hat, auf der das vorliegende Buch aufbaut. Dr. Patrick Oelze vom Verlag Herder danke ich für das ermutigende Interesse an dem Buchprojekt und Florentine Schaub für das vorzügliche Lektorat.
1. Die USA und der Aufstieg Chinas
Für Präsident Richard Nixon (1969–1974) waren die Tage im Februar 1972, als er die Volksrepublik China besuchte, eine „Woche, die die Welt veränderte“.1 Wie sehr, konnte zu dieser Zeit niemand auch nur erahnen. Erst einmal begann mit der Annäherung der USA an das kommunistische Land der Weg zur Normalisierung der Beziehung zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Diese Woche seines Besuchs leitete darüber hinaus einen Wandel ein, dessen Folgen ein halbes Jahrhundert später die Weltpolitik prägen sollten.
1.1 Die USA und China im Kalten Krieg
Nach dem Sieg der Kommunistischen Partei Chinas und ihrer Machtübernahme 1949 hatten die USA eine Politik der Eindämmung und Isolation der Volksrepublik verfolgt. Diese Politik stützte sich auf bilaterale Bündnisse und eine ausgedehnte Militärpräsenz in Ostasien. Die USA versagten der Volksrepublik China die Anerkennung und verweigerten ihr die Aufnahme in die Vereinten Nationen. China wurde dort von der „Republik China“, so der bis heute offizielle Staatsname Taiwans, vertreten. Auf diese Insel hatte sich die Regierung der 1912 ausgerufenen Republik China nach der Niederlage im Bürgerkrieg und der Gründung der Volksrepublik zurückgezogen. Auf der koreanischen Halbinsel kämpften Anfang der 1950er Jahre amerikanische Streitkräfte und chinesische „Freiwillige“ gegeneinander. In der Straße von Taiwan kam es dreimal zu einer krisenhaften Zuspitzung. Im Vietnamkrieg unterstützte die Volksrepublik China das kommunistische Regime Nordvietnams. Das amerikanische „engagement“ im Vietnamkrieg hatte insbesondere die Eindämmung Chinas zum Ziel.2
Entgegen der öffentlichen Rhetorik beruhte die Politik unter den Präsidenten Harry S. Truman (1945–1953) und Dwight D. Eisenhower (1953–1961) keineswegs auf der Annahme eines monolithischen sino-sowjetischen Blocks; man rechnete mit nationalistischen Tendenzen in China und versuchte, einen Keil zwischen die beiden kommunistischen Hauptmächte zu treiben: nicht durch Annäherung an China, sondern durch Isolation und Druck. Damit verband sich die Erwartung, dass ein isoliertes China der Sowjetunion hohe wirtschaftliche und militärische Unterstützungsleistungen abverlangen werde, die dann zur Belastung der Beziehungen führen würden.3
Als sich Anfang der 1960er Jahre die Spaltung zwischen den beiden kommunistischen Staaten abzeichnete, näherten sich die USA unter den Präsidenten John F. Kennedy (1961–1963) und seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson (1963–1969) keineswegs China an. Vielmehr galt das kommunistische Regime in Peking als gefährlichere und akutere Bedrohung in Asien als die Sowjetunion. Erst die Nixon-Administration nutzte die neue weltpolitische Konstellation und orientierte die amerikanische Chinapolitik um: von der Isolation und Eindämmung zur Annäherung im Rahmen einer pragmatischen Gleichgewichtspolitik.4
Aus chinesischer Sicht war die Annäherung an die USA eine Reaktion auf die veränderte internationale Konstellation und wirtschaftliche Notwendigkeiten. Die Beziehungen zur Sowjetunion hatten sich verschlechtert, nachdem die sowjetische Führung unter Nikita Chruschtschow 1956 Stalins Verbrechen und den Personenkult verurteilt hatte – sehr zur Beunruhigung von Mao Zedong, einem Verehrer Stalins, der hier Gefahr für seine eigene Führungsrolle witterte. Die Sowjetunion stellte 1960 die wirtschaftliche und technische Hilfe für China ein. Spätestens seit ihrem Einmarsch in die Tschechoslowakische Sozialistische Republik 1968 galt die Sowjetunion für China, verglichen mit den USA, als größere Bedrohung, zumal es ein Jahr später zu einer kriegerischen Auseinandersetzung an der chinesisch-sowjetischen Grenze kam. Der „Große Sprung nach vorn“ in den Kommunismus (1958–1961) und die dadurch verursachte Hungersnot mit Millionen von Toten und dann die „Kulturrevolution“ (1966–1976) führten die Volksrepublik unter Mao Zedong in die wirtschaftliche Zerrüttung. Die Annäherung an die USA bedeutete keineswegs, dass sich an der Ablehnung westlicher Demokratie irgendetwas geändert hatte. Für die wirtschaftliche Modernisierung, die unter der Führung von Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre in Angriff genommen wurde und die staatliche Planung mit Marktliberalisierung verband, war der Zugang zu amerikanischer Technologie und zum amerikanischen Markt ein wichtiger Faktor.5
Für die USA unter Präsident Nixon und dem Nationalen Sicherheitsberater und späteren Außenminister Henry Kissinger lag das unmittelbare Interesse darin, die sino-sowjetische Entzweiung zu nutzen, um einen Hebel, ein Druckmittel in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen zu haben – vor allem im Hinblick auf die sowjetische Kooperation in Vietnam und in der strategischen Rüstungskontrolle. Um sowohl die Sowjetunion als auch China beeinflussen zu können, sollten nach Kissingers Kalkül die USA im „strategischen Dreieck“ bessere Beziehungen zu den beiden anderen Staaten haben als diese untereinander.6
Dabei ging es zunächst keineswegs um eine Art stilles Bündnis mit China gegen die Sowjetunion, sondern um die taktische Nutzung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen für die amerikanisch-sowjetische Entspannungspolitik. Ein zu enger Schulterschluss zwischen den USA und China barg das Risiko, die Sowjetunion allzu sehr zu provozieren. Doch eine solche strategische Partnerschaft wurde attraktiver, als die an die Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion geknüpfte Hoffnung auf Zurückhaltung und Kooperation seitens der Sowjetunion enttäuscht wurde. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre galt unter den Präsidenten Gerald Ford (1974–1977) und James Earl („Jimmy“) Carter (1977–1981) die „Chinakarte“ als ein Mittel, die militärische Position gegenüber der Sowjetunion über den Weg der strategischen Kooperation mit China zu verbessern.
Der strittige Punkt in den USA blieb die militärisch-strategische Kooperation mit China. Unter Nixon war sie auf Erklärungen beschränkt, die die Bereitschaft zum Schutz Chinas vor einem sowjetischen Angriff zum Ausdruck brachten; unter Ford begannen substanziellere Diskussionen, eine entsprechende Entscheidung wurde jedoch bis zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen aufgeschoben. Als diese unter Präsident Carter aufgenommen wurden, blieb der Waffenexport zwar weiter untersagt, China erhielt aber erleichterten Zugang zu fortgeschrittener Technologie. Zur beginnenden strategischen Zusammenarbeit gehörte vor allem die Einrichtung von zwei gemeinsam betriebenen Stationen im westlichen China zur Überwachung sowjetischer Raketentests (1980). Im Herbst 1983 begann der Ausbau der militärisch-strategischen Zusammenarbeit zwischen den USA und China: Konsultationen auf hoher Ebene, Austausch von Geheimdienstinformationen, Kontakte zwischen den Militärs beider Länder und schließlich auch Waffenverkäufe, als China Mitte 1984 in das Foreign Military Sales Program aufgenommen und so staatlich finanzierte und abgesicherte Rüstungsgeschäfte möglich wurden.7
Die militärische Kooperation begann zu einer Zeit, als China, interessiert an einer „unabhängigen Außenpolitik“ und an der Entspannung mit der Sowjetunion, nicht mehr öffentlich von der Idee einer strategischen Partnerschaft mit den USA sprechen wollte. Vor dem Hintergrund der amerikanisch-sowjetischen Entspannung und der sino-sowjetischen Annäherung verlor dann Mitte der 1980er Jahre die antisowjetische Begründung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen für beide Seiten an Bedeutung. Für die USA galt China jetzt weniger als „aktiver strategischer Partner“ im Konflikt mit der Sowjetunion, sondern in erster Linie als passives „strategisches Gegengewicht“.8 Die prowestliche Orientierung Chinas sollte bewahrt, die weitere Absenkung des militärischen Gefälles zwischen China und der Sowjetunion verhindert werden. Das grundlegende Interesse der USA war nunmehr vor allem die langfristig prowestliche, kooperative außenpolitische Orientierung Chinas. Der wirtschaftlichen Modernisierung und Reform galt die amerikanische Unterstützung.
China blieb ein wichtiger Faktor im weltpolitischen Kalkül der USA, unter Präsident George H. W. Bush (1989–1993) mehr noch als unter seinem Vorgänger Ronald Reagan (1981–1989).9 Begründet wurde die Notwendigkeit tragfähiger amerikanisch-chinesischer Beziehungen mit dem langfristigen Interesse an Stabilität in Asien und insbesondere mit dem unmittelbaren Interesse, die chinesische Zusammenarbeit bei drängenden Problemen zu sichern: in Regionalkonflikten, vor allem in Kambodscha und auf der spannungsgeladenen koreanischen Halbinsel, sowie in der Nonproliferationspolitik. Und nicht zuletzt führte der Golfkonflikt 1990/91 die Bedeutung Chinas für das Funktionieren der Vereinten Nationen vor Augen.
Auch nach der gewaltsamen Niederschlagung der Protestbewegung am 4. Juni 1989 mit Hunderten oder Tausenden von Toten und Tausenden Verwundeten hielt die Bush-Administration weitgehend an der traditionellen Linie der Chinapolitik fest.10 Sie verhängte zwar Sanktionen, die sich am stärksten auf die militärisch-strategische Zusammenarbeit auswirkten: Die Zusammenarbeit bei der Überwachung sowjetischer Nuklear- und Raketentests setzten die USA jedoch fort. Gleichzeitig war die Bush-Administration aber bemüht, einen Bruch in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu vermeiden. Bereits Ende 1989 zeigte sie sich an der erneuten Normalisierung der Beziehungen interessiert, musste aufgrund der innenpolitischen Stimmung in den USA jedoch dann eine etwas härtere Position einnehmen.
Während die Bush-Administration die Kontinuität alter Politik neu zu begründen suchte, löste sich mit der verringerten globalstrategischen Bedeutung Chinas der innenpolitische Konsens für die bisherige Realpolitik auf. In der Öffentlichkeit und im Kongress gewann die Respektierung der Menschenrechte in China nach dem Massaker am Tian’anmen-Platz in Peking an Bedeutung. Nicht nur die Frage der Menschenrechte aktivierte Interessengruppen, auch die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen änderte das gesellschaftliche Umfeld. Als sich der amerikanisch-chinesische Handel in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre ausweitete, wurde in manchen Industriezweigen, insbesondere in der Textilindustrie, der Ruf nach Schutzmaßnahmen laut.11 Zudem wuchs das Handelsbilanzdefizit zulasten der USA. Diese Entwicklung sorgte dafür, dass die Hindernisse beim Zugang zum chinesischen Markt und der mangelnde Urheberrechtsschutz für amerikanische Produkte in China zunehmend Anstoß in den USA erregten. Zudem hatte sich die Exportpolitik Chinas im Laufe der 1980er Jahre immer mehr zu einem erheblichen Proliferationsproblem entwickelt. Mit dem Verkauf von Nukleartechnologie und Raketen(technologie) unterstützte China die Nuklearprogramme etlicher Staaten des Globalen Südens. All die genannten Entwicklungen – die Menschenrechtssituation, die Konflikte in den amerikanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen und die chinesischen Rüstungsexporte – führten dazu, dass sich neue Akteure für die Chinapolitik zu interessieren begannen und sich entlang der Konfliktlinien gesellschaftliche Koalitionen bildeten. Auf der einen Seite fanden sich seit Ende der 1980er Jahre Menschenrechtsorganisationen, unterstützt von jenen Teilen der Industrie und der Gewerkschaften, denen die billigen Importe aus China ein Dorn im Auge waren, und die über die chinesischen Rüstungsexporte besorgten Nonproliferationsexperten. Auf der anderen Seite standen die am Chinahandel interessierten Teile der Industrie und der Landwirtschaft sowie die realpolitisch orientierte Mehrheit der amerikanischen Chinaexperten.12
1.2 Amerikas zweigleisige Chinastrategie nach dem Kalten Krieg
Präsident William Jefferson („Bill“) Clinton (1993–2001) setzte gegen einige innenpolitische Widerstände die Politik des pragmatischen „engagement“ fort. So mancher Republikaner im US-Kongress neigte bereits Mitte der 1990er Jahre zu einer Politik der Eindämmung, zu einer Verhinderung oder zumindest einer Verlangsamung des Aufstiegs Chinas. Doch aus der in der Clinton-Administration vorherrschenden Sicht gab es keine Alternative zur „engagement“-Strategie. Eine Politik der Eindämmung Chinas mochte irgendwann vielleicht notwendig erscheinen; doch bliebe dann immer noch genügend Zeit für einen solchen Strategiewechsel. Wünschenswert war eine Eindämmungspolitik für die Clinton-Administration nicht. Für eine Neuauflage der Eindämmungspolitik fehlten nach Einschätzung der Administration die Verbündeten; bei einer solchen Ausrichtung amerikanischer Politik wäre es unvermeidlich, die Beziehungen zu befreundeten Staaten in der Region einer größeren Belastung auszusetzen. Ein Kalter Krieg mit China hätte – das schien die große Sorge innerhalb der Clinton-Administration zu sein – enorme negative Konsequenzen: höhere Verteidigungsausgaben, wirtschaftliche Einbußen, eine Lähmung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, ein unverantwortlich handelndes China.13
Wirtschaftlich setzte die kooperative Linie im Verhältnis zu China auf eine möglichst weitgehende Normalisierung der Handelsbeziehungen und die Integration Chinas in das westliche Wirtschaftssystem, politisch auf die Verdichtung der bilateralen Beziehungen und die Einbindung Chinas in multilaterale Regime und militärisch auf die Anknüpfung von Kontakten zwischen den Streitkräften beider Staaten. Diesem Ansatz lagen zwei Kausalhypothesen zugrunde: zum einen die Erwartung, dass die Integration Chinas in das internationale System eine sozialisierende Wirkung auf die chinesische Führung haben würde und sie dabei Normen verinnerliche, die an der Stabilität des internationalen Systems orientiert sind; zum anderen die Erwartung, dass über die Öffnung Chinas, über das wirtschaftliche Wachstum und die dadurch ausgelösten Modernisierungsschübe, insbesondere über die Entstehung einer Mittelschicht, die Demokratisierung des Landes gefördert werden würde.
Chinas Aufnahme in die Welthandelsorganisation (World Trade Organization – WTO) und damit die stärkere Öffnung des chinesischen Marktes galten aus dieser Sicht als große Chance, einen positiven Wandel in China zu bewirken. Voraussetzung für die Aufnahme war auf amerikanischer Seite die dauerhafte Gewährung eines normalen Handelsstatus. Bis dahin wurde dieser Status (die „Meistbegünstigung“) jährlich erneuert. Nirgendwo kamen die Erwartungen, die der amerikanischen Chinapolitik zugrunde lagen, deutlicher zum Ausdruck als in Präsident Clintons Rede, mit der er im Jahre 2000 den Kongress zu überzeugen suchte, China den normalen Handelsstatus dauerhaft zu gewähren:14
„Die Mitgliedschaft in der WTO wird natürlich nicht über Nacht eine freie Gesellschaft in China schaffen oder garantieren, dass sich China an die globalen Regeln hält. Aber ich glaube, dass sie China mit der Zeit schneller und weiter in die richtige Richtung bringen wird. […] Je mehr China seine Wirtschaft liberalisiert, desto mehr wird es das Potenzial seines Volkes freisetzen. […] Und wenn der Einzelne die Macht hat, nicht nur zu träumen, sondern seine Träume zu verwirklichen, wird er ein größeres Mitspracherecht fordern. Im neuen Jahrhundert wird sich die Freiheit über Mobiltelefon und Kabelmodem verbreiten. […] Es steht außer Frage, dass China versucht hat, gegen das Internet vorzugehen. Viel Glück dabei! Das ist so, als würde man versuchen, Gelee an die Wand zu nageln.“
Die Rede spiegelte die Annahmen wider, die damals verbreitet waren und die den „Chinakonsens“ darstellten: Optimismus über eine wünschenswerte weitere Entwicklung Chinas, Nutzen aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das Interesse, eine konfrontative Entwicklung in den Beziehungen zu vermeiden. Die Annahme war: Würden die USA China als Gegner behandeln, dann wäre mit der Entwicklung einer solchen feindseligen Beziehung zu rechnen. Eine Politik des kooperativen „engagement“ dagegen würde die Möglichkeit zu einer positiven Entwicklung der Beziehungen eröffnen.15 Weniger langfristig transformativ orientiert als kurzfristig pragmatisch war eine weitere Erwartung: dass ein dichtes Beziehungsgeflecht die eigenen Einflussmöglichkeiten erhöhen und die kooperative Regelung anstehender bilateraler oder regionaler Probleme erleichtern würde. Unterfüttert war dieser kooperative Ansatz durch die in Ostasien stationierten Streitkräfte.
Als Präsident George W. Bush (2001–2009) sein Amt antrat, schien es, als neige er, wie manche Republikaner im Kongress, zu einer Politik der Eindämmung Chinas. So sprach er denn auch von China als „strategischem Konkurrenten“ („strategic competitor“). Das war eine deutliche rhetorische Abgrenzung zur „strategischen Partnerschaft“, die Präsident Clinton angestrebt hatte. Doch bald wich diese Ausrichtung einem pragmatischen, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit betonenden Ansatz. Zum einen machte die elf Tage dauernde „Spionageflugzeug-krise“ – ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug kollidierte mit einem chinesischen Flugzeug und musste auf chinesischem Territorium notlanden, die Besatzung wurde interniert – vom April 2001 deutlich, wie wichtig stabile Beziehungen sind. Zum anderen veränderten die Terroranschläge vom 11. September 2001 die Bedrohungswahrnehmung und schienen die Grundlage für eine gegen die terroristische Bedrohung gerichtete Großmachtkooperation zu schaffen.16
Die Bush-Administration verfolgte eine zweigleisige Strategie, die politische Kooperation und wirtschaftliche Integration mit einer intensivierten strategischen Absicherung gegenüber einem militärisch erstarkenden China zu verbinden suchte.17 Ein starkes, prosperierendes, friedliches China wurde erklärtermaßen begrüßt, aber mit seinem politischen Wandel in Richtung größere Freiheiten und Demokratie verknüpft – eine Entwicklung, die jedoch keineswegs als sicher galt. Es ging nun nicht mehr allein um die Integration Chinas in das internationale System, sondern um die Frage, ob China darin zu einem „verantwortungsbewussen Akteur“ („responsible stakeholder“) würde. Es galt aus Sicht der Bush-Administration, die seit drei Jahrzehnten verfolgte Politik der Integration zu transformieren. Ein „verantwortungsbewusster Akteur“ zeichnete sich nach deren Sicht dadurch aus, dass er Verpflichtungen einhält und mit den USA und anderen Staaten im Rahmen des bestehenden internationalen Systems zusammenarbeitet, das heißt: sich an die rechtlichen Spielregeln der internationalen Wirtschaft hält, beim Streben nach Sicherung der Energieversorgung keine merkantilistische, problematische Staaten stützende Politik verfolgt und kooperativ zur internationalen Stabilität und Sicherheit beiträgt.
Gleichzeitig sahen die Sicherheitspolitiker in Washington in China jenen Staat, der das größte Potenzial hatte, sich zu einem militärischen Rivalen zu entwickeln und die traditionelle amerikanische Überlegenheit durch die technologische Modernisierung seiner Streitkräfte zu konterkarieren. Die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte hatte sich nach amerikanischer Einschätzung seit Mitte/Ende der 1990er Jahre beschleunigt und zielte auf die Fähigkeit zur Machtprojektion in Asien. Politisch rechneten die amerikanischen Verteidigungsplaner damit, dass China in der Zukunft versucht sein könnte, seine Militärmacht als Drohpotenzial zu nutzen oder auch tatsächlich zur Durchsetzung eigener Interessen einzusetzen.
Der Aufbau amerikanischer Abwehrsysteme gegen Raketen und Marschflugkörper aller Reichweiten, die Bewahrung der Luftüberlegenheit zur Abwehr fortgeschrittener Bedrohungen, verbesserte Fähigkeiten zur Unterwasserkriegsführung, der Ausbau der Überwasserflotte – all diese amerikanischen Rüstungsprogramme ergaben Sinn nicht nur, aber vor allem auch mit Blick auf die erwartete weitere Modernisierung der chinesischen Streitkräfte. Mit der veränderten Wahrnehmung Chinas – dem rasanten Aufstieg, der militärischen Modernisierung und dem globalen Ausgriff des Landes – wurde das Element der Risikoabsicherung in der Politik der Bush-Administration deutlich ausgeprägter als früher.
Präsident Barack Obama (2009–2017) setzte die zweigleisige, Kooperation und Risikoabsicherung verbindende Chinapolitik fort.18 Nichts zeigt die zentrale Rolle Chinas und die Bedeutung Asiens in der außenpolitischen Konzeption der Obama-Administration deutlicher als die Tatsache, dass die erste Auslandsreise von Außenministerin Hillary Clinton nicht, wie es unter ihren Vorgängern Tradition war, nach Europa führte, sondern nach Asien. Die Obama-Administration wollte die Zusammenarbeit mit China ausbauen – und das nicht nur bei den Themen, die wie die Handelsfragen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten unmittelbar berührten, sondern auch bei regionalen und internationalen Problemen und Konflikten, darunter die Nuklearrüstung Nordkoreas, der Klimawandel und die Finanzmarktkrise. Seinen institutionalisierten Niederschlag fand der Wunsch nach umfassender Zusammenarbeit mit China im sogenannten U.S.-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED), den Barack Obama und Chinas damaliger Staatspräsident Hu Jintao auf den Weg brachten, aufbauend auf dem Strategic Economic Dialogue, den die Bush-Administration ins Leben gerufen hatte. Dieses viele Ministerien und Behörden einbeziehende institutionalisierte Dialogformat erbrachte zwischen 2010 und 2016 einige Erfolge in Bereichen, in denen die USA und China überlappende Interessen hatten: besonders bei der Stabilisierung des internationalen Finanzsystems nach der weltweiten Finanzmarktkrise, bei Maßnahmen zum Klimaschutz sowie bei der Zusammenarbeit von Sicherheits- und Zollbehörden.19
Mehr Kooperation mit China, aber zugleich Stärkung der amerikanischen Position im pazifischen Asien – das war der Ansatz, den die Obama-Administration verfolgte. Deutlicher Ausdruck der amerikanischen Entschlossenheit, eine asiatisch-pazifische Macht zu bleiben und eine regionale Vorherrschaft Chinas nicht zu akzeptieren, war das sogenannte „rebalancing“ der amerikanischen Außenpolitik in Richtung Asien. Hierunter sind eine Stärkung des Allianzsystems in der asiatisch-pazifischen Region, intensivere Beziehungen mit dortigen Staaten wie Indien und Vietnam, mehr „engagement“ in regionalen Organisationen und vertiefte wirtschaftliche Integration durch die Transpazifische Partnerschaft (Trans-Pacific Partnership, kurz TPP) zu verstehen. Bei der TPP handelt es sich um ein Freihandelsabkommen mit dem Ziel, Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse für Güter, Dienstleistungen und landwirtschaftliche Produkte abzubauen. Nach acht Jahre währenden Verhandlungen wurde dieses Abkommen zwischen den USA und elf asiatisch-pazifischen Staaten (Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam) im Februar 2016 unterzeichnet.20 Aus Sicht der Obama-Administration war die TPP ein Instrument, um Chinas hegemoniale Ambitionen zu begrenzen. Sollten die anderen asiatischen Staaten wirtschaftlich zu abhängig von der Volksrepublik China werden, wüchse deren politischer Einfluss in der Region – so lautete das Kalkül.21





























