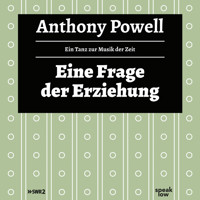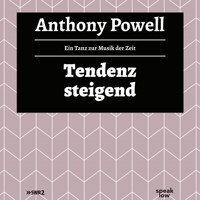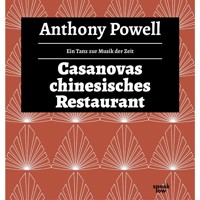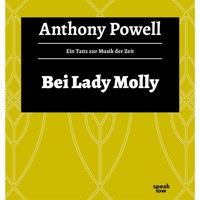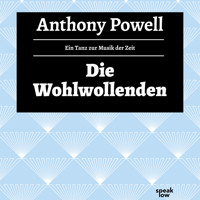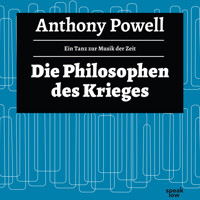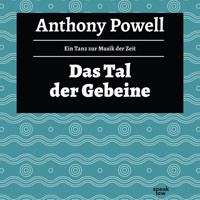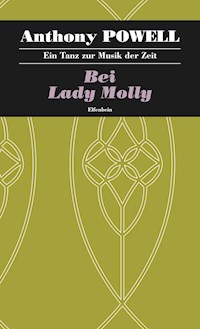Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Tanz zur Musik der Zeit
- Sprache: Deutsch
Der zwölfbändige Zyklus "Ein Tanz zur Musik der Zeit" — aufgrund seiner inhaltlichen wie formalen Gestaltung immer wieder mit Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" verglichen — gilt als das Hauptwerk des britischen Schriftstellers Anthony Powell und gehört zu den bedeutendsten Romanwerken des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von dem gleichnamigen Bild des französischen Barockmalers Nicolas Poussin, zeichnet der Zyklus ein facettenreiches Bild der englischen Upperclass vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten sechziger Jahre. Aus der Perspektive des mit typisch britischem Humor und Understatement ausgestatteten Ich-Erzählers Jenkins — der durch so manche biografische Parallele wie Powells Alter Ego anmutet — bietet der "Tanz" eine Fülle von Figuren, Ereignissen, Beobachtungen und Erinnerungen, die einen einzigartigen und aufschlussreichen Einblick geben in die Gedankenwelt der in England nach wie vor tonangebenden Gesellschaftsschicht mit ihren durchaus merkwürdigen Lebensgewohnheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Powell
Könige auf Zeit
Roman
Ein Tanz zur Musik der Zeit –Band 11
Aus dem Englischen übersetzt
von Heinz Feldmann
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1973unter dem Titel
»Temporary Kings« bei William Heinemann, London.
Band 11 des Romanzyklus »A Dance to the Music of Time«
Temporary Kings
©John Powell and Tristram Powell, 1973
Die Übersetzung dieses Bandes
wurde mit freundlicher Unterstützung
der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung ermöglicht.
© 2018 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-86-2 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-46-6 (Druckausgabe)
1
Der Geruch Venedigs durchdrang die Nacht, ein dichtes, eindringliches Brackwasser-Aroma. Der Spätsommer war heiß hier. Ein sehr alter Mann begann seine Vorführung. Mit rauer Stimme auf unsicheren Füßen die wenigen verbliebenen, dunkel verfärbten, wie willkürlich in seinem Mund verteilten Zähne die Launigkeit seines Grinsens betonend, trug er das Lied in einem ungewöhnlich langsamen Tempo vor, wobei er die Hände in die Luft stieß und mit den Füßen auf den Boden stampfte, die Bewegungen der Seilbahn imitierend, wie sie sich, ihn und sein Mädchen in ihrer Gondel einschließend, mühsam ächzend zum Krater des Vulkans hinaufwand – eine Reise, dazu gedacht, ihr undankbares Herz zu rühren.
Iamme, iamme, via montiam su là.
Iamme, iamme, via montiam su là.
Funiculì, funiculà, via montiam su là.
Ein erster, einführender Besuch Italiens, als Junge mit meinen Eltern, hatte eine Woche in ebendiesem Hotel eingeschlossen. Es blickte auf den Canal Grande. Damals klein, ja sogar winzig, dehnte sich seine dem Wasser zugewandte Front jetzt an beiden Seiten über die Terrasse, wo traditionell die Gondeln der Musiker festmachten, hinaus. Eine fast touristisch legere Kleidung ersetzte nun die Abendgarderobe, die so antiquiert gewesen wäre wie diese Musikgruppe selbst; in anderer Hinsicht aber war das Muster unverändert geblieben, insbesondere dieser Veteran und das ›Ziel‹ seines Lieds. War er vielleicht derselbe Mann? Bloße vierzig Jahre – drei oder vier weniger, wenn man genau sein wollte – mochten sehr wohl ohne große, wahrnehmbare Veränderungen an einer Fassade vorübergegangen sein, die bereits zu der Zeit stark verwittert erschien, als ich sie zuerst erblickt hatte. Die Gesten waren identisch. Mit theatralisch ausgestreckten Armen wies er auf die Königreiche der Erde, wie sie sich unterhalb der Seilbahn-Passagiere zu deren Vergnügen erstreckten.
Si vede Francia, Procida, la Spagna,
E io veggo te, io veggo te.
Mit seinen fast hundert Jahren mochte sich der Sänger sehr wohl der Gelegenheit erinnern, für die das Lied komponiert worden war: An jenem großen Tag, so behaupteten die Worte, war er selbst auf den Vesuv gefahren, begleitet von seiner Innamorata, behaglich eng mit ihr eingeschlossen in dem frisch installierten Raumschiff, das die Möglichkeiten der Verführung so sehr begünstigte. Hatten eine dominierende Persönlichkeit, die suggestive Rotation der Maschinerie, die Insel Procida, die weit unten wie eine sich auf dem Rücken austreckende Frau dalag – hatte all das zusammengenommen zum Erfolg geführt? Die Antwort war zweifellos ein Ja. Selbst wenn die Ehe fraglich blieb – möglicherweise wegen des Librettisten Respekt vor der Konvention –, wurden zumindest wärmere Kontakte ganz gewiss erreicht.
Die stilisierten Bewegungen der Hände erinnerten an Dicky Umfraville und seine Imitationen. Auch er hätte in frühen Jahren sein Talent zu einer sich stets erneuernden Kunst, die kein Pensionsalter kannte, nutzbar machen sollen. Sich selbst zur Schau zu stellen, etwas vor einer Menge vorzuführen, bedeutet für viele Menschen das größte Vergnügen, das sie kennen; doch eine Selbstdarstellung ohne eine Grundlage in der Kunst neigt dazu, in Staub und Asche zu zerfallen. Vielleicht hätte eine professionelle Haltung seinen eigenen Darstellungen gegenüber jetzt, wo sich Umfraville von seinen Aufgaben als Agent auf Thrubworth zurückgezogen hatte, seine, wie Frederica und seine Stiefkinder behaupteten, fast chronische Melancholie in Schach gehalten. Manchmal, nach einem Tag auf der Pferderennbahn zum Beispiel, konnte er zur alten, gewohnten Form auflaufen. Aber selbst dann pflegten ein paar schlecht platzierte Einsätze ihm die Überzeugung zu vermitteln, dass ihn das Glück für immer verlassen habe und sein Leben vorüber sei.
»Gott, was für ein Irrsinnsort diese Welt ist. Und meinen Rücken spür ich auch. Trompeter, welche Weise bläst du gerade? – Antreten zum Strafappell, alter Junge, wenn dein Name Geri Atrisch ist. Weißt du, alt zu werden ist wie zunehmend für ein Verbrechen bestraft zu werden, das du gar nicht begangen hast.«
»Welche hast du denn nicht begangen?«, sagte Frederica. »Du bist nie erwachsen geworden, Liebling. Du kannst nicht alt werden, ehe du das nicht getan hast.«
Duldendes Ertragen sprach neben Zuneigung aus diesen Worten. Frederica war Umfravilles nie überdrüssig geworden, obwohl sie sich oft über ihn ärgerte.
»Ich fühle mich wie der Mann in der Gespenstergeschichte, der über die Wellenbrecher kriecht, und das schreckliche Wesen hinter ihm kommt näher und näher. Ich hab nicht mehr richtig gelacht, seit dieser Pferdetransporter in Lingfield beim Zurücksetzen über Buster Foxe gerollt ist.«
In der Regel hasste Umfraville es, wenn man über den Tod sprach, aber die Legende von Buster Foxe’ Opfertod unter den Rädern von so etwas wie einem im Rückwärtsgang fahrenden Houyhnhnm-Juggernaut bildete eine Ausnahme. Sie war unwandelbar in Umfravilles Mythologie eingegangen. Captain Foxe’ Ende (er war während des Krieges befördert worden) war in Wirklichkeit weniger dramatisch gewesen, obwohl es zweifellos einen tödlichen Unfall in der Nähe der Rennbahn als Ursache hatte. Es beseitigte ein für alle Mal das Risiko, bei zukünftigen Rennveranstaltungen einem alten Feind zu begegnen. Es lohnte sich vielleicht, Umfraville zu fragen, ob er eine eigene Version von »Funiculì, Funiculà« besitze – etwas, das keineswegs außer Frage stand.
In gewisser Hinsicht widerlegte der gegenwärtige Vokalist Fredericas Behauptung und bestätigte eher St. John Clarkes Beobachtung, dass »Altwerden in großem Maße aus Jungwerden besteht«. Der betagte Sänger sah aus, als ob ihm Gedanken an den Tod und jede Form von Melancholie unbekannt seien. Man konnte sich vorstellen, dass er wusste, was Wut war, sexuelle Lust, Not, Schmerz und Verzweiflung, nicht aber Melancholie. Das war eindeutig, besonders auch nach dem Applaus, der seiner Vorführung folgte. Das Klatschen war, angesichts der drückenden Hitze, die jetzt, am Ende des Tages, kaum abgenommen hatte, ziemlich herzlich. Dr. Emily Brightman und ich schlossen uns ihm an. Die seinem Talent gezollte Anerkennung entzückte den Künstler. Er verbeugte sich immer wieder, entblößte wiederholt die spärlichen, schwärzlichen Stümpfe, während er die Schweißströme wegwischte, die die Furchen aus trockener, loser Haut hinabrannen, die sich zu beiden Seiten seines Mundes eingegraben hatten. Ein langes Leben hatte ihm, was öffentlichen Beifall betraf, nicht das geringste Gefühl der Sättigung vermittelt. Insgesamt gesehen war das sympathisch. Ich nahm jetzt größeres Interesse als zuvor an den Gewohnheiten und charakteristischen Eigenschaften des Alters.
Trotz der dem Sänger eigenen Nonchalance, der eingängigen Melodien der Musiker, des großartigen Hintergrunds und der zweiten Karaffe Wein drängten sich mir auf eine nicht unangenehme Weise Gedanken an die Vergänglichkeit der Dinge auf. Marinetti und die Futuristen hatten einen frischen Start gewollt – was immer das bedeuten mochte – und, neben anderen Projekten, ein Zuschütten der Kanäle Venedigs mit dem Schutt der venezianischen Paläste befürwortet. Jetzt schienen die Futuristen mit ihrer Zukunftssentimentalität, der primitiven Maschinerie, den Oldtimer-Autos ebenso antiquiert pittoresk zu sein wie der Doge in dem Bucintoro, der sich mit seiner Braut dem Meer vermählt, und auch fast ebenso zeitfern – obwohl es stimmte, dass ein Verlangen zu zerstören, der Hass auf und die Furcht vor der Vergangenheit, eine Konstante im menschlichen Verhalten blieb.
»Glauben Sie, die Soubrette ist seine Geliebte oder seine Urenkelin?«, fragte Dr. Brightman. »Es scheint ein sehr enges Verhältnis zu sein. Vielleicht beides.«
Gleich bei unserer ersten Begegnung, anlässlich der Eröffnungssitzung der Konferenz (als ein freundschaftlicher Kontakt sich aus ihrer Vertrautheit mit »Borretsch und Nieswurz«, meinem Buch über Burton, und meiner Kenntnis ihres berühmteren Werks über die Triaden ergab) hatte Dr. Brightman ihre Entschlossenheit deutlich gemacht, auch dem leisesten Verdacht altjüngferlicher Prüderie, der sich fälschlicherweise aus ihren Lebensumständen ergeben mochte, entgegenzutreten. Ihre diskret modische Kleidung unterstrich noch diese völlige Distanz zu allem, was man für akademische Spießigkeit halten konnte – eine Art, sich anzuziehen, die auf eine ruhige, aber nachdrückliche Weise elegant war. Eine ihrer Schülerinnen an der Universität (die beste Freundin unserer Nichte Caroline Lovell) schrieb ihr große Strenge als Tutorin zu, und auch die Fähigkeit, wenn nötig selbst die überheblichste Studentin mühelos zum Weinen zu bringen. Dr. Brightman war, zugegebenermaßen, im ersten Augenblick ein wenig furchterregend. Wir unterhielten uns kurz über das frühe Mittelalter. Sie erzählte von ihrer gegenwärtigen Beschäftigung mit Boethius, die, wie sie sagte, eine Form annähme, die sich wahrscheinlich als umstritten erweisen würde. Der männliche Professor ihres Namens, den ich während meiner Studienzeit gekannt hatte, schien nur ein entfernter Verwandter von ihr zu sein.
»Sie meinen Harold Brightman, der bei dem Dinner zur Feier des neunzigsten Geburtstags dieses alten Schurken Sillery eine Rolle spielte? Er ist so etwas wie ein Cousin. Es gibt eine ganze Menge von denen unter den Gelehrten. Wir stammen alle von dem Pastor Salathiel Brightman ab, der in Alexander Popes ›The Dunciad‹ im Zusammenhang mit irgendeiner lange vergessenen Streiterei über eine Pedanterie des 18. Jahrhunderts erwähnt wird. Er verfasste ›Attische und römische Berechnungen des Volumens von flüssigen und trockenen Dingen, übertragen und beschränkt auf die allgemeinen englischen Maße für Wein und Getreide‹. Ich glaube, der große Lemprière erwähnt, dass er ihm für die Aufstellung seiner eigenen Tabellen der Proportionen am Ende seiner ›Bibliotheca Classica‹ zu Dank verpflichtet sei. Salathiel soll die Auffassungen seiner Zeit von dem Cochlearion und dem Oxybaphon revolutioniert haben, obwohl ich selbst nicht die geringste Vorstellung davon habe, wie viele von ihnen jeweils in eine Amphore gehen. Da wir gerade von flüssigen und trockenen Dingen sprechen, sollen wir etwas trinken gehen? Sagen Sie, Mr. Jenkins, hat Mark Members Sie dazu überredet, zu dieser Konferenz zu kommen?«
»Sie auch?«
»Nicht ohne Widerstand meinerseits. Ich hatte geplant, in diesen langen Ferien eine Menge Arbeit zu erledigen. Mark hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Er kann sehr tyrannisch sein.«
»Ich hab auch Widerstand geleistet, hatte aber Schwierigkeiten mit einem Buch. Es schien ein Ausweg zu sein.«
Was ich sagte, verschönerte die Lage ein wenig, war nicht allzu harsch mir selbst gegenüber. Das Schreiben mag nicht gerade vergnüglich sein, es aufzugeben kann schlimmer sein, obwohl Members selbst damals schon sicher jenseits solchen Nagens der Schuld gewesen sein muss. Er war inzwischen ein versierter, häufiger Besucher von internationalen Zusammenkünften von ›Intellektuellen‹ jeglicher Art. Er war seit Jahren in diesem Geschäft. Es passte zu ihm. Es brachte seine bis dahin verborgen gebliebenen Talente für die Organisation und die Kunst, Reden zu halten, zum Vorschein, die ja im Laufe der Routinebeziehungen eines Autors zu Verlegern und Chefredakteuren kaum zur Geltung kommen – und auch nicht, was das betrifft (da Members die umgekehrten Rollen ebenfalls versucht hatte), im Umgang mit Autoren als Chefredakteur oder Verleger. Das damals sich stets erweiternde Feld von kulturellen Kongressen sagte ihm zu und stimulierte sein Temperament. Auf einem von ihnen hatte er sogar seine Ehefrau gefunden, eine Amerikanerin, eine Autorin und Journalistin, einige Jahre älter als er selbst, exzellent erhalten, nicht ohne einen Namen und nützliche Verbindungen in ihrem eigenen Land. Sie war auch, wie Members selbst prahlte, »gewöhnt an Autoren und deren inkonsequentes Verhalten«. Das stimmte wahrscheinlich, denn Members war ihr vierter Ehemann. Die Ehe befand sich noch in einem einigermaßen gedeihlichen Zustand, trotz Andeutungen (hauptsächlich seitens des Kritikers Bernard Shernmaker), dass Members aus dem Treffen in Venedig ausgestiegen sei, weil an einer anderen, kleineren Konferenz eine Autorin teilnehmen würde, an der er interessiert sei. Ein Grund dafür anzunehmen, dass diese besondere Unterstellung ungerecht war, bestand darin, dass mehrere andere literarische Persönlichkeiten das Konkurrenztreffen für verlockender gehalten hatten. Darin unterschieden sie sich von Members nur insofern, als er von London aus bei der Organisation des Treffens in Venedig eine Rolle gespielt hatte. Deshalb musste er, um nicht durch sein Ausscheren Schaden zu nehmen, kurzfristig zwei Stellvertreter wie Dr. Brightman und mich finden. Er wischte meinen Vorwand, dass ich nie an solchen Aktivitäten teilnähme, beiseite.
»Umso mehr Grund hinzufahren, Nicholas, und zu sehen, was solche Treffen ›wahrer Geister‹ zu bieten haben. Ich wäre keineswegs überrascht, wenn du der Droge erliegen würdest. Es ist eine ziemlich starke, wie ich zu meinem eigenen Leidwesen erfahren habe. Zudem, selbst in unserem Alter besitzen solche Symposien ein gewisses Fluidum des Abenteuerlichen. Man trifft interessante Leute – wenn man denn Schriftsteller und dergleichen interessant nennen kann, etwas, das du und ich im Verlauf unserer via dolorosa hin zur literarischen Kreuzigung oft bezweifelt haben müssen. Schlimmstenfalls bedeutet es eine Abwechslung, bietet es einen praktisch kostenlosen Urlaub, oder etwas, das nicht weit davon entfernt ist. Komm schon, Nicholas, gib dir einen Ruck. Sag ja. Sei nicht so lahm.
Lasst überlassen uns die ungebildet’ Ebene der Herde und der
Frucht;
Lasst suchen uns die Grablegung
Auf einem hohen Berg, bewohnt bis an die Spitz’,
Dort finden wir Kultur im Übermaß!
Es ist keine Grablegung und auch kein hoher Berg diesmal. Aber die Piazza San Marco – mein Namenspatron, vergiss bitte nicht – und eine Menge Partys, nicht nur Kultur im Übermaß, sondern auch exzellentes Essen und exzellente Getränke gratis dazu. Die Biennale findet dann gerade statt, und in der darauf folgenden Woche das Filmfestival, wenn du Lust hast, dafür dazubleiben. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? Nutz die Gelegenheit. Du wirst leben wie ein König, wenn du einmal da bist.«
»Einer dieser Könige auf Zeit in ›The Golden Bough‹: Es steht ihnen alles zur Verfügung für ein Jahr oder einen Monat oder einen Tag – dann die Exekution? Tod in Venedig?«
»Nur die rituelle Exekution in aufgeklärteren Zeiten – das Bild der abnehmenden Virilität. Um es mit Robert Burns zu sagen, Thomas Mann ist der Mann für all das. Der König auf Zeit zu sein, das ist es, was wichtig ist. Für die Kongress-Könige besteht die Vergeltung nur darin, dass sie, und das ist harsch genug, wie ich zugebe, ins Alltagsleben zurück müssen. Aber selbst das wirst du, mein lieber Nicholas, mit erneuerter Energie tun. Wie der neue König, genauer gesagt.
Hier auf der Erde sind wir Könige, und keiner außer uns
Kann solch ein König sein und auch nicht solch ein Untertan.
Das ist es, worauf die Konferenz in Venedig hinauslaufen wird. Ich setze also deinen Namen auf die Liste.«
»Wer geht sonst noch dahin?«
»Quentin Shuckerly, Ada Leintwardine. Die beiden sind sicher. Nicht Alaric Kydd, und das ist auch gut so. Der neue Shuckerly, ›Der Lakai des Athleten‹, ist der beste Schwulenroman seit ›Seeigel‹. Du solltest ihn dir mal ansehen, wenn du Zeit hast. Du wirst deine Entscheidung nicht bereuen, nach Venedig zu fahren. Ich bin désolé, dass ich nicht in der Lage bin, selbst teilzunehmen. Man kann leider nicht an zwei Orten zu gleicher Zeit sein; und ich habe eine Verpflichtung, mich an einer anderen Stelle verfügbar zu halten. Es werden eine Menge internationale Persönlichkeiten kommen, einige von ihnen ziemlich bekannt. Ferrand-Sénéschal, Kotecke, Santos, Pritak. Mit ein wenig Glück wirst du auf eine sehr talentierte Truppe treffen. Ich hatte gehofft, Ferrand-Sénéschal zum Thema ›Pasternak und der Nobelpreis‹ zu hören. Seine Einwände dagegen – und er wird sicher Bedenken gegen die Möglichkeit äußern – werden bestimmt hörenswert sein.«
Mit seinem Hinweis, dass der internationale Ruhm mehrerer ausländischer Schriftsteller, die wahrscheinlich an der Konferenz teilnahmen, bei der Beurteilung der Attraktion der letzteren nicht völlig außer Acht gelassen werden sollte, hatte Members einen überzeugenden Punkt angesprochen. Einige von ihnen kennenzulernen, sie auch nur näher in Augenschein zu nehmen, würde bedeuten, ein paar zusätzliche Stücke in dem komplexen Puzzlespiel aneinanderfügen zu können, aus dem die literarische Szene der Welt besteht – einem Spiel, das sich nie vollenden lässt, obwohl es manchmal in grellem Licht erscheint, wenn zwei oder drei unerwartete Teile plötzlich an der richtigen Stelle zusammengesteckt werden. Für die süchtigen Anhänger dieser Freizeitbeschäftigung kann die physische Erscheinung eines gegebenen Schriftstellers seinem Werk ein erhellendes Postskriptum hinzufügen, denn körperliche Eigenschaften lassen sich nach Fotografien nur unzureichend beurteilen. Ferrand-Sénéschal, einer der von Members genannten unbedeutenderen Berühmtheiten, bildete dafür ein Beispiel. Seine dicken Lippen, die eng beieinanderliegenden Augen, der grübelnd-brutale Gesichtsausdruck waren mir von Zeitungsbildern und Verlagskatalogen her ziemlich vertraut, der Mann selbst aber wurde durch sie nie wirklich definiert. Ich verspürte kein großes Verlangen, Ferrand-Sénéschal persönlich kennenzulernen – hätte es alles in allem fast vorgezogen, der Mühe enthoben zu sein, mit ihm sprechen zu müssen –, aber ich war dennoch neugierig zu sehen, wie er in Person aussah und wie er sich verhielt, wenn er sich unter seinen Mit-Nomaden des Intellekts befand, den Beduinen der kulturellen Wüste, die auf immer ihre Zelte in deren Oasen auf- und abbauen.
Es gab noch einen weiteren Grund, warum, als Members Ferrand-Sénéschals Namen als potentielle Belohnung für eine Teilnahme an der Konferenz aus dem Hut zog, sich bei mir eine andere, eine stärkere Reaktion einstellte als bei solchen Namen wie Santos, Pritak oder Kotecke. Während des Krieges erhielten Stabsoffiziere, deren Arbeit eine oberflächliche Vertrautheit mit dem Zustand der soldatischen Moral im Hinblick auf gewisse Truppenteile oder Operationsgebiete erforderlich machte – in einer Hinsicht stellte die ganze Welt in jener Zeit ein Operationsgebiet dar –, von Zeit zu Zeit die Gelegenheit, einen Blick auf die Exzerpte zu werfen, die aus einer großen Auswahl von Briefen, die die Zensurabteilung überprüft hatte, gesammelt worden waren. Eine solche Kollektion, die keine besonders hohe Sicherheitsstufe besaß, wurde natürlich zu praktischen Zwecken zusammengestellt, doch nicht unter völliger Missachtung der Komik. Der anonyme Ersteller der Anthologien zeigte gelegentlich seine Wertschätzung für den komischen oder ironischen Charakter eines Briefes. Ferrand-Sénéschal bildete dafür ein Beispiel. Während ich die Akte durchsah, fiel mein Auge zweimal auf seinen Namen, der jedem vertraut war, dessen Beschäftigung mit der zeitgenössischen Literatur ihn auch nur ein kleines Stück über den Kanal hinausführte. Ferrand-Sénéschals Briefe waren von den Vereinigten Staaten aus verschickt worden, wo er, bei Ausbruch des Krieges dort auf einer Vortragsreise weilend, während der gesamten Feindseligkeit auch geblieben war. Stets ein Mann der Linken (als welcher er besonders während des Spanischen Bürgerkriegs in Erscheinung trat, als sein Name gelegentlich zusammen mit dem von St. John Clarke erschien) hatte er ganz außergewöhnliche Geschmeidigkeit beim Sitzen auf jenem Zaun bewiesen, der die gegensätzlichen Haltungen der Vichy-Administration und der französischen Elemente, in Frankreich und sonstwo, die in aktiver Opposition zu Deutschland standen, voneinander trennte.
Nur zitiert, um die gegenwärtigen Ansichten eines relativ bekannten französischen Autors zu illustrieren, der durch die Dringlichkeiten des Krieges sein Domizil im Ausland gefunden hatte, zeigten die beiden Beiträge Ferrand-Sénéschals in der Sammlung des Zensors geschickt die Unaufrichtigkeit der Loyalität ihres Verfassers. Ohne Zweifel zielten die Sätze in einer Hinsicht darauf ab, genau das zu erreichen, nämlich natürlich zu implizieren, dass nichts als auch nur im Geringsten antagonistisch der Sache der Alliierten gegenüber gedeutet werden könne. Was immer sonst Ferrand-Sénéschal sein mochte, er war kein Narr. Ja, es war seine eigene Einsicht, dass seine Briefe für den Zensor – für jeden Zensor – von Interesse sein würden, die bei mir ein Lächeln über das Geschick hervorriefen, mit dem so gekonnt die Exzerpte aus diesen sorgfältig gewählten Sätzen erstellt worden waren. Außerdem, persönliche Briefe, auch wenn sie eindeutig in dem Bewusstsein geschrieben sind, dass sie von jemand anderem, sei es eine offizielle oder inoffizielle Person, als dem endgültigen Empfänger untersucht werden, vermitteln ein einzigartiges Gefühl von der Persönlichkeit des Schreibers, ein Gefühl, das in Büchern aus der gleichen Feder oft fehlt. Sie sind möglicherweise aufschlussreicher als alles andere – wie Retuschen an persönlichen Erscheinungen, um eine außergewöhnliche Wirkung zu erzielen. Im Falle Ferrand-Sénéschals war – wie bei den Porträts in der Presse – die als eine Kraft nicht zu unterschätzende Persönlichkeit, die vermittelt wurde, ebenfalls nicht besonders attraktiv.
Dass er während der Zeit seiner Expatriierung jede äußere Teilnahme, selbst parti pris, an den Auseinandersetzungen um die so heftig umkämpften Probleme vermieden hatte, erwies sich nicht als Nachteil für Ferrand-Sénéschals anschließende Karriere. Nicht nur hatte er diese Jahre physisch überlebt – etwas, das ihm vielleicht nicht gelungen wäre, hätte er Europa nicht verlassen –, er kehrte auch nach Frankreich zurück, ohne durch eine der Kategorisierungen belastet zu werden, der aktive Kombattanten der einen oder anderen Art unweigerlich unterliegen. Einige von diesen hatten natürlich militärische oder sonstige Auszeichnungen errungen – etwas, auf das Ferrand-Sénéschal keinen Anspruch erheben konnte –, aber dabei waren nur wenige einer verhältnismäßig schädigenden sektiererischen Abstemplung entkommen. Ja, Ferrand-Sénéschal, der während seines Exils im literarischen und akademischen Bereichen in beiden Teilen des amerikanischen Kontinents hart gearbeitet hatte, befand sich nun, mit einem größeren Publikum und in einer stark veränderten Welt, in einer verbesserten Position. Er gab jetzt seine Politik der Nichteinmischung auf und verkündete öffentlich, er sei nun Anhänger einer extremeren Form seines früheren politischen Standpunkts – von der er auch in der Folgezeit nie mehr abwich. Von dieser Position aus spielte er eine ziemlich prominente Rolle während der Zeit der Neuorientierung in Frankreich unmittelbar nach dem Krieg; als sich dann einige Jahre später die Kulturkongresse voll etablierten, wurde er zu einer herausragenden Figur in deren lebhaften polemischen Auseinandersetzungen.
Mir wurden diese zensierten Briefe wieder in Erinnerung gerufen, als ich für die Buchseite der »Spaltung« verantwortlich war. Ein Werk Ferrand-Sénéschals sollte rezensiert werden. Quiggin & Craggs hatten eine Übersetzung einer seiner philosophisch-ökonomischen Studien veröffentlicht. Obwohl die Zeitschrift theoretisch ein von dem Verlag, der das Buch herausbrachte, getrenntes Unternehmen war, neigte die Firma – besonders Quiggin – dazu, eine allzu häufige Missachtung ihrer Publikationen auf den kritischen Seiten der »Spaltung« übelzunehmen. Ich hätte in jedem Fall Bagshaw, als den Chefredakteur, konsultiert, ob ein von Quiggin & Craggs veröffentlichtes Buch so ohne weiteres ignoriert werden könne. Angesichts seiner Faszination von allen Formen des Marxismus, seien sie nun orthodox oder das Gegenteil davon, würde Bagshaw wahrscheinlich zu diesem Werk eine feste Meinung haben. So war es auch. Er zeigte sich sofort lebhaft bewegt, als er Ferrand-Sénéschals Namen hörte.
»Eine interessante Subspezies von einem Mitstreiter. Ich würde mir das Buch selbst gerne ansehen. Ferrand-Sénéschal ist der Partei hin und wieder äußerst nützlich gewesen, trotz seiner Häresien. Alles, was er schreibt, enthält stets ein wenig kommunistische Propaganda, wie trivial auch immer. Er hat auch seltsame sexuelle Neigungen. Seine politischen Gegner bringen das gerne vor. Sie behaupten, in Amerika sei irgendein Skandal vertuscht worden.«
Bagshaw blätterte in Ferrand-Sénéschals Buch. Er akzeptierte es als etwas für den Experten und setzte sich hin, um es sich näher anzusehen.
»Du wirst nichts über seine sexuellen Neigungen darin finden. Ich hab’s schon flüchtig durchgeguckt.«
»Ich werde es mit nach Hause nehmen und über die Frage eines Rezensenten nachdenken. Vielleicht kommt mir ja eine gute Idee.«
In der folgenden Woche hatte Bagshaw eine gute Idee, und zwar eine sehr gute.
»Wir werden den Ferrand-Sénéschal Kenneth Widmerpool für seinen Routineartikel in der Zeitschrift geben. Es ist dem, was er selbst so schreibt, gar nicht so unähnlich.«
Das war Bagshaw in Bestform. Sein Instinkt als Chefredakteur – exzentrisch, unvorsichtig, oft undurchsichtig in seinen Zielen – konnte nur selten als gedankenlos oder absurd abgetan werden. Er berichtete, Widmerpool sei zunächst gar nicht bereit gewesen, sich mit der Übersetzung von Ferrand-Sénéschals Werk abzumühen (er hatte kaum von dem Autor gehört), habe aber, nachdem er etwas von dem Buch gelesen hatte, seine Meinung geändert. Der Artikel erschien in der folgenden Ausgabe der »Spaltung«. Widmerpool selbst war äußerst angetan von ihm.
»Eine meiner erfolgreichsten Bemühungen; ich glaube, das kann ich mit Sicherheit behaupten. Ferrand-Sénéschal ist ein Mann, den man im Auge behalten muss. Er und ich haben etwas gemeinsam; wir sind beide Intellektuelle in der Welt der Tat. Indem ich eine Analogie zwischen unseren übereinstimmenden Denkprozessen aufweise, beziehe ich mich auf einen gemeinsamen Nenner der Entschlossenheit, rücksichtslos mit alten gesellschaftlichen Methoden und Ansichten zu brechen. Kurz gesagt, wir sind beide Realisten. Ich würde diesen Franzosen gerne kennenlernen. Ich werde das Nötige veranlassen, dass das geschieht.«
Die Folgen des Artikels über Ferrand-Sénéschal waren auf ihre Weise weitreichend. Ferrand-Sénéschal, der London in Verfolgung seiner Unternehmungen – kultureller Unternehmungen – ziemlich häufig besuchte, wurde auf einer dieser Reisen ohne Schwierigkeiten mit Widmerpool bekannt gemacht. Ein gewisses Gefühl der Verbundenheit scheint sich unmittelbar zwischen den beiden ergeben zu haben, wozu möglicherweise auch bestimmte Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen beitrugen, denn Menschen, die einander ähnlich sehen, entdecken manchmal auch zusätzliche Affinitäten. In der Armee, zum Beispiel, pflegten hochgewachsene, ausgezehrte Generäle hochgewachsene, ausgezehrte Soldaten als ihre Burschen oder Fahrer auszuwählen; kleine, cholerische Generäle zogen kleine, cholerische Offiziere für ihren Stab vor. Was immer es war, Widmerpool und Ferrand-Sénéschal fanden auf den ersten Blick Gefallen aneinander. Als Mitglied irgendeines Ausschusses innerhalb der Labour Party lud Widmerpool Ferrand-Sénéschal dazu ein, seine Kollegen bei einem Lunch im Unterhaus kennenzulernen. Das muss ein Erfolg gewesen sein, denn zu gegebener Zeit erwiderte Ferrand-Sénéschal das Kompliment und führte Widmerpool aus, als dieser auf seinem Weg zurück von Osteuropa, das er unter dem Banner einer Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft mit einer der Volksrepubliken bereist hatte, durch Paris kam.
Dieser Abend mit Ferrand-Sénéschal in Paris war ebenfalls ein uneingeschränkter Erfolg gewesen. Das stellte fast eine Untertreibung der Befriedigung dar, die er Widmerpool dessen eigener Aussage nach vermittelt hatte. Sein Kommentar landete, entweder zufällig oder absichtlich, unmittelbar im Büro der »Spaltung«. Das war zu der Zeit, in der sich Widmerpool, verlassen von seiner Frau, von der Zeitschrift ferngehalten hatte. Er mochte nicht zu Unrecht gehofft haben, dadurch, dass er bewusst die Legende seiner Ausschweifung mit Ferrand-Sénéschal in Umlauf setzte, den Anschein zu vermeiden, ein verlassener Ehemann zu sein, der sich nicht zu amüsieren wusste, während Pamela irgendwo heimlich mit X. Trapnel zusammenlebte. Das konnte das Motiv dafür gewesen sein, dass er die Kunde verbreitete, er habe in Paris ordentlich einen draufgemacht. Andernfalls würde man das wohl eher für ein Ereignis halten, über das man besser Stillschweigen bewahrt. Ohne Zweifel machten anzüglich gefärbte Gerüchte über ihr Gelage noch Monate später die Runde. Abgesehen von anderen Erwägungen stand ein solches Betragen, jedenfalls eine solche Unverfrorenheit, in völligem Gegensatz zu dem Ton, mit dem Widmerpool selbst Sir Magnus Donners’ louche Reputation zu beklagen pflegte.
Dieser Tadel mochte natürlich sehr wohl ein doppelter Bluff gewesen sein. Als ich ihm das letzte Mal begegnet war – auf einer großen Party, die am Abend nach der Parlamentswahl von 1955 gegeben wurde –, hatte Widmerpool bewusst die Wochen zur Sprache gebracht, die wir zusammen in La Grenadière verbracht hatten, um Französisch zu lernen; und er hatte hinzugefügt, das es »ein Glück für unsere Moral gewesen ist, dass Madame Leroys Haus nicht in Paris lag« – Worte, die zu bestätigen schienen, dass er es darauf anlegte, seinen Ruf, ein flotter Hecht zu sein, zu bekräftigen. Das war am frühen Abend gewesen, ehe Pamelas Unhöflichkeit unsere Gastgeberin grob beleidigte oder Widmerpool hörte (gegen Morgen, nachdem Isobel und ich schon nach Hause gegangen waren), dass er seinen Parlamentssitz verloren hatte. Zu der Zeit, als die »Spaltung« noch existierte, war Bagshaw skeptisch gegenüber der Geschichte in Paris gewesen, ohne sie aber völlig auszuschließen.
»Ich vermute, irgendetwas Vergnügliches mag durchaus stattgefunden haben. Die Bordelle sind zwar heutzutage alle offiziell geschlossen, aber das würde für jemanden, der sich auskennt, keinen Unterschied machen. Ich weiß nicht genau, worauf Ferrand-Sénéschal angeblich steht – an ein Kruzifix gekettet sein, während grünes Licht auf ihn scheint; kleine Mädchen; Venezianischer Spiegel – man hat es mir gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern. Er mag Kenneth durchaus ein paar Anregungen gegeben haben. Ich werde selbst noch sadistische Neigungen entwickeln, wenn sich die neue Sekretärin nicht bessert. Sie hat wieder diese Druckfahnen der Anzeigen durcheinandergebracht. Also, Nicholas, wir haben immer noch zu viel Platz übrig. Wirf mal einen Blick auf diese hier und sag, ob du irgendwelche Vorschläge hast. Du wirst frischen Wind in das Anzeigen-Problem bringen. Es ist auch ganz schön schlimm, dass wir keine Artikel mehr von Trapnel kriegen. Diese Zeitschrift herauszugeben treibt mich noch in den Wahnsinn.«
Im Lichte dessen, was ich von Widmerpool wusste, musste die Geschichte, dass er zusammen mit Ferrand-Sénéschal ein Bordell besucht habe, mit Vorsicht behandelt werden, obwohl es stimmte, dass er in der Vergangenheit mehr als einmal einen verstohlen-lüsternen Ton angenommen hatte, wenn er über Nutten sprach – eine Haltung, die auf unsere ganz frühen Tage in London zurückging. Moreland sagte gelegentlich: »Maclintick mag Frauen nicht, er mag Nutten. Er hat sich einmal in eine Nutte verliebt, die ein böses Spiel mit ihm getrieben hat.« Eine solche Neigung konnte auch für Widmerpool zutreffen, war ihm vielleicht zu einer Gewohnheit geworden, die so tiefe Wurzeln geschlagen hatte, dass sie sich zu einer Vorliebe entwickelte, die weniger beschränkte sexuelle Intimitäten behinderte. Ein solcher Hang erklärte vielleicht zum Teil das Fiasko mit Mrs. Haycock, vielleicht sogar sein Verhältnis zu Pamela – welche Form das auch immer haben mochte. Dass, wie Bagshaw vermutete, Ferrand-Sénéschal das Medium war, durch das Widmerpool in seinen mittleren Jahren in ihm bis dahin unbekannte Befriedigungen eingeführt wurde, in neue, ungewöhnliche Formen der Selbstbefreiung, konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach allem, was man so hört, geschehen auf dem Gebiet später sexueller Entwicklung weit unwahrscheinlichere Dinge. Bagshaw war natürlich voreingenommen. Er war inzwischen nicht nur zu der Ansicht gelangt, dass Widmerpool entschlossen sei, ihn von der Position des Chefredakteurs der »Spaltung« zu vertreiben, sondern dass er auch ein ›Mitstreiter‹ war.
»Er hat wahrscheinlich politisch eine Menge von Ferrand-Sénéschal gelernt, denn dieser ist weit erfahrener in diesem Spiel.«
»Aber was kann denn Widmerpool dabei gewinnen, ein heimlicher Kommunist zu sein?«
Bagshaw lachte laut. Er hielt das für eine sehr törichte Frage. Da politische Standpunkte der extremen Linken das war, was ihn am meisten interessierte, wo er sozusagen seine Unschuld verloren hatte, war meine Frage für ihn so etwas, wie wenn ich von Umfraville wissen wollte, was er denn interessant daran finde, dass ein Pferd sich schneller bewegt als ein anderes, oder von einem Fußballfan, warum es so bedeutsam sei, dass eine aufgeblasene Lederkugel zwischen zwei Pfosten gekickt wird. Zuerst konnte Bagshaw keine Worte finden, die einfach genug waren, einen so unwissenden Geist aufzuklären. Dann fiel ihm eine anschauliche Parallele ein.
»Abgesehen von allem anderen ist es eine jener heimlichen Freuden, so wie wenn man einer hübschen Frau auf einem Plakat einen Schnäuzer anmalt oder über ein Treppengeländer spuckt, weißt du, von einer großen Höhe auf die Leute unten. Du siehst mehrere Köpfe, möglicherweise eine Glatze. Sie wissen nicht, woher die Spucke kommt. Es gibt einem ein enormes Gefühl der Macht. Wie zu der Zeit, als ich Murmeln unter die Hufe der Pferde der berittenen Polizei zu werfen pflegte. Stell dir diese Art von Spaß vor, wenn du ein Parlamentsabgeordneter bist, oder ein respektierter Beamter, und du verrätst im Stillen die ganze Schau, während jeder glaubt, du seist eine Säule der Gesellschaft.«
»Ist das nicht eine ziemlich frivole Ansicht? Wie steht es denn mit den tiefen Überzeugungen, den komplizierten Ideologien, von denen du dauernd sprichst?«
»Nicht wirklich frivol. Auch dieses Spucken ist eine aktive Form der Revolte – unterminiert die Gesellschaft, wie wir sie kennen, verbreitet Alarm und Verzagtheit unter der Bourgeoisie. Außerdem, ganz abgesehen vom Spucken, besteht eine ziemlich gute Chance, dass du eines Tages selbst an die Macht kommst. Du machst ihnen allen die Hölle heiß. Der Bourgeoisie und allen anderen. Ein Mitglied des kommunistischen apparat zu sein, würde unserem Freund politisch sehr gut in den Kram passen.«
»Aber Widmerpool ist der größte Bourgeois, der je gelebt hat.«
»Natürlich ist er das. Das ist es, was ihm solchen Spaß vermittelt. Nebenbei bemerkt, in seinen eigenen Augen ist er kein Bourgeois. Er ist ein Mann, der sich in einem Kampf auf Leben und Tod mit der dekadenten Gesellschaft um ihn herum befindet. Entweder er gewinnt oder sie.«
»Das klingt nicht sehr rational.«
»Der Marxismus ist nicht rational, Nicholas. Das musst du in deinen Kopf kriegen. Der Marxist der intelligenteren Sorte sagt dir das. Er hebt besonders hervor, dass letzten Endes der Marxismus wie die Religion Glauben erfordert, und er nennt das eines von dessen höchsten Verdiensten. Nebenbei bemerkt, mein alter Freund Max Stirner behandelt auch Kenneth: ›Weil ich »von Natur« ein Mensch bin, habe ich ein gleiches Recht auf den Genuss aller Güter, sagt Babeuf. Müsste er nicht auch sagen: Weil ich »von Natur« ein erstgeborener Prinz bin, habe ich ein Recht auf den Thron?‹ Genau das ist es, was Kenneth Widmerpool sagt – nicht laut, aber es ist das, was er denkt.«
Bagshaw hatte wieder mit seinem politischen Lieblingsphilosophen angefangen. Ich befand mich in jenem Moment nicht in der nötigen Stimmung. Dass ich mich stattdessen um die Bücher in der »Spaltung« kümmerte, bedeutete nicht, dass ich verneinte, dass vielleicht ein Stück Wahrheit in seiner Darlegung steckte: nämlich dass Widmerpool, der auf einer Ebene seines Lebens ziemlich konventionell war – in der letzten Zeit konventionell in seiner Verurteilung der Konventionalität –, im Innern vielleicht gleichzeitig einen ganz anderen Geisteszustand nährte als den, den er nach außen zeigte; dass er nicht nur die Welt entsprechend irgendeinem doktrinären Muster umzugestalten wünschte, sondern sich auch an der Welt zu rächen gedachte, die ihn in diesem Tun nicht für genügend großartig hielt. Hatte ihn General Conyers nicht vor Jahren als einen »typischen intuitiv extrovertierten Menschen« diagnostiziert, »kaltblütig, für einen Moment für eine Sache begeistert, aber nie zufrieden, sich bald wieder was anderem zuwendend«? In einer Hinsicht, materiell gesehen, hatte die Welt Widmerpool natürlich sehr gut behandelt, sogar zu der Zeit, als diese Unterhaltung mit Bagshaw stattfand. Andererseits sind die Menschen nur selten der Ansicht, dass sie entsprechend ihren Verdiensten belohnt worden sind, und die am meisten Belohnten sind oft auch am meisten erpicht darauf, gerächt zu werden. Möglicherweise gehörte Ferrand-Sénéschal ebenfalls zu denen.
Was immer die inneren Gefühle Ferrand-Sénéschals sein mochten, eine Begegnung mit ihm in Venedig kam nicht zustande. Es ergab sich nicht einmal ein kurzer Blick auf ihn auf dem Podium. Sein Tod ereignete sich in London, nur wenige Tage vor der Eröffnung der Konferenz. Er erlitt einen Schlaganfall in seinem Hotel im Stadtteil Kensington. Das Ableben eines französischen Autors von internationalem Ansehen wäre in jedem Fall einer mittelgroßen Schlagzeile in den Zeitungen für wert erachtet worden. Da die Jahreszeit aber nicht viel an Neuigkeiten hergab, wurde Ferrand-Sénéschal größere Aufmerksamkeit gewidmet, als man sonst vielleicht erwartet hätte. Es wurde zum Beispiel bekannt, dass er nur einige Tage zuvor einen Arzt aufgesucht hatte, der ihn vor allzu großer Anstrengung gewarnt habe. Dementsprechend fand keine gerichtliche Untersuchung der Todesursache statt. Der Tod war – »wie in dem Buch«, wie Evadne Clapham bemerkte – am Nachmittag gekommen. Für später an jenem Abend, so berichteten die Zeitungen, sei Ferrand-Sénéschal eingeladen gewesen, nach dem Dinner bei Lady Donners »hereinzuschauen« – »keine Party, nur ein paar Freunde«, hatte sie den Reportern erläutert –, wo er sich, so schien es, unter einer Auswahl von Politikern und Schriftstellern, einschließlich Mr. und Mrs. Mark Members, befunden hätte. Gesellschaftliche Verpflichtungen dieser Art, zusammen mit einem Strom von Bekannten und Journalisten, die in seiner Suite im Hotel ein- und ausgingen, hatten sich offensichtlich für seinen bereits angeschlagenen Gesundheitszustand als zu viel erwiesen.
Den Londoner Nachrufen zufolge befand sich Léon-Joseph Ferrand-Sénéschal in seinem sechzigsten Lebensjahr. Sie erwähnten nur zwei oder drei seiner besser bekannten Bücher, ausgewählt aus einer enormen Sammlung von Romanen, Dramen, philosophischen und ökonomischen Studien, politischen Traktaten und (laut Bernard Shernmaker) einem frühen, später von dem Autor unterdrückten Band von Gedichten im Stile Verlaines. Dieser unfreiwillige Rückzug würde keinen großen Einfluss auf die Konferenz haben. Bekannte Intellektuelle bildeten stets eine unsichere Quantität, wenn es darum ging, ob sie auch wirklich erscheinen würden, selbst wenn sie nicht plötzlich verstarben. Pritak, Santos und Kotecke mochten sehr wohl ebenfalls etwas Besseres zu tun finden, wenn vielleicht auch nicht notwendigerweise ein unvorhergesehenes Ende. Ich entschloss mich, wenn sich die Gelegenheit bot, Dr. Brightman zu fragen, ob sie je Ferrand-Sénéschal begegnet sei, und wenn ja, was sie von ihm halte.
Das jüngste und am besten aussehende Mitglied der Truppe, die Frau, die Dr. Brightman die Soubrette genannt hatte, ging mit einem Teller herum, um Geld zu sammeln. Die übrigen sangen en masse lauthals »Santa Lucia«. Die Vorstellung ging zu Ende. Sie trafen Vorbereitungen, zu einem anderen Hotel weiterzugehen. Bevor sie sich auf den Weg machten, überprüfte der alte Sänger zusammen mit der Soubrette verstohlen die Einnahmen, wobei sie reichlich gestikulierten – ob aus Befriedigung oder Ironie über das Ausmaß der Spenden war ungewiss.
»Neapolitanische Lieder in Venedig zu singen ist so wie schottische Balladen in Bath in Südengland«, sagte Dr. Brightman. »Neapel ist einzigartig. Selbst seine volkstümliche Musik lässt sich nicht bis hierher nach Norden exportieren. Eine Vorliebe für Neapel ist etwas, was die Menschen voneinander trennt. Man liebt den Ort, oder man kann ihn nicht ausstehen. Der Charakter des Reisenden scheint keinen Einfluss auf die instinktive Wahl zu haben. Ich persönlich bin begeistert von der parthenopäischen Küste, obwohl ich einmal, als ich noch jünger war, das Opfer einer äußerst unziemlichen Episode in Pompeji wurde. Es passierte außerhalb des Lupanars, von dem damals Damen ausgeschlossen waren. Ich hätte mich innerhalb dieser Stätte archaischen Lasters, in der ich später außer der spartanischen Härte der Doppeldecker-Liegen wenig fand, das selbst die Sittsamste hätte schockieren können, weit weniger gekränkt gefühlt. Ich hab den Kerl mit meinem Sonnenschirm davongejagt – eine Tat, die ohne Zweifel in diesen aufgeklärteren Zeiten heute als bedauerlich empfunden wird, da sie bei einem dieser allzu häufigen Fälle von ›Organminderwertigkeit‹ irreparablen Schaden für die Reaktionen riskiert.«
Sie schüttelte energisch ihre kurzen weißen, eng am Kopf anliegenden Locken. Diese sahen aus wie eine Batterie von Drahtspiralen (wie die von Shakespeares Dark Lady), die einen immens kraftvollen Dynamo elektrisch antreiben. Das Thema der Anekdote erinnerte mich wieder an den Namen Ferrand-Sénéschals. Ich fragte sie, ob sie ihm schon einmal begegnet sei.
»Ja, Ferrand-Sénéschal ist mir einmal in höchsteigener, wenig anziehender Person vorgestellt worden. Er sagte mir, er verachte »gutes Schreiben«. Ich lobte seine französische Logik in dieser Hinsicht. Wie Sie zweifellos wissen, sind seine frühen Bücher lächerlich gestelzt und die späteren extrem schludrig geschrieben. Ich wurde sofort von seinen Speichellecker-Höflingen weggeführt. Gewisse Personen bedürfen eines Hofes. Andere ziehen einen Harem vor. Das ist nicht ganz das Gleiche.«
»Einige mögen beides.«
»Natürlich kann das eine in das andere aufgehen – na hallo, Russell.«
Der junge Amerikaner, der an unseren Tisch getreten war, schien der einzige seiner Landsleute zu sein, der an der Konferenz teilnahm. Er hieß Russell Gwinnett. Wir hatten am Tag zuvor beim Lunch nebeneinander gesessen. Er hatte erklärt, dass er an einem bekannten amerikanischen College für Frauen Englisch unterrichte. Dr. Brightman hatte dort ein Jahr als Austausch-Professorin verbracht, so dass sie einander schon kannten, bevor sie sich auf der Konferenz wieder begegneten.
»Wie geht es Ihnen, Russell? Haben Sie Mr. Nicholas Jenkins schon kennengelernt? Das ist Mr. Russell Gwinnett, ein alter Freund aus meinen transatlantischen Tagen. Sie kennen sich schon? Kommen Sie und setzen Sie sich zu uns, Russell.«
Der ernsthafte Teil der Konferenz – Intellektuelle aus der ganzen Welt hielten Vorträge vor dem Plenum über ihre Lieblingsthemen – fand in Morgen- und Nachmittagssitzungen auf der Insel San Giorgio Maggiore statt. Um den Enthusiasmus, der dadurch gefährdet war, dass man den Beflissenheiten des Kongresslebens lange ausgesetzt war, am Leben zu erhalten, schloss der Veranstaltungsplan fast an jedem Tag unseres Aufenthaltes einen offiziellen Lunch oder ein offizielles Dinner ein. Diese Bankette waren gewöhnlich mit irgendeiner nationalen Kostbarkeit oder einem Ort historischen Interesses verbunden – waren also Gelegenheiten, die in gewissem Maße Mark Members’ Versprechen rechtfertigten, wir würden »wie die Könige leben«. Gleichzeitig boten sie Anlässe, andere Teilnehmer des Kongresses »näher kennenzulernen«. Während einer dieser Veranstaltungen, die in einer wegen ihrer Fresken von Veronese berühmten Villa an der Brenta stattfand, war ich mit Gwinnett bekannt geworden.
Er war Anfang dreißig, von schmächtiger Figur, und trug einen kleinen schwarzen Schnurrbart, der entlang seiner Oberlippe oben und unten einen schmalen Streifen Haut frei ließ. Dass er Amerikaner war, ließ sich äußerlich zunächst kaum erkennen, dann aber deuteten etwas in den dünnen Knochenformationen der Arme und Beine, die Blässe und Textur der Haut auf seine Nationalität. Die Bewegungen des Körpers, geschmeidig, nicht ohne einen Anflug von Athletik, wiesen ebenfalls auf eine eher amerikanische als europäische nervöse Spannung – auf eine extreme Form davon. Er trug eine Brille mit leicht blau gefärbten Gläsern. Seine allgemein unkonformistische Ausstrahlung deutete nicht auf irgendeine klar erkennbare Ausrichtung hin.
Ich hatte am vorhergehenden Tag nicht lange neben ihm gesessen, bevor sich seine unorthodoxe Art bestätigte. Nachdem er den Namen Dr. Brightmans erwähnt hatte, legte er (wie sie) das gewöhnlich vorteilhafte Fundament eines guten Verhältnisses zwischen Schriftstellern – was keineswegs stets erreichbar ist –, indem er eine zustimmende Kenntnis meines eigenen Werkes zur Schau stellte. Das war ein exzellenter Anfang. Es zeigte sich, dass er noch ein weiteres Ass im Ärmel hatte, aber er spielte die Karte nicht sofort aus. Indem er Kontrolle bewies, begann er so, wie er sich dann weiter verhielt. Nach der erfreulichen, wenn auch subjektiven, Gratulation in Richtung auf mein eigenes schriftstellerisches Werk wurde er weniger umgänglich. Ja, es war fast unmöglich, ihn in ein Gespräch zu ziehen; er verstummte völlig; es fehlte ihm gänzlich jene Reserve leichter, ziemlich gut informierter gesellschaftlicher Ausstattung, die im Großen und Ganzen charakteristischer für das amerikanische als das britische akademische Leben ist. Dieses Abgleiten in eine stumpfe, fast mürrische Weigerung, gesprächsmäßig zu kooperieren, ließ hier eine amerikanische Version des am wenigsten flexiblen Typs eines britischen Professors vermuten – jenen stillen Egoismus, die selbstapplaudierende Enge des Blickfelds, die manchmal unerträglich ist, selbst wenn sie durch verifizierte Bezüge und fortschrittliche Ansichten gestützt wird. Wenn es bei Gwinnett Anzeichen fast einer Parodie einer akademischen Standardfigur gab, war er deshalb nicht notwendigerweise ohne Interesse für mich, und sei es nur als eine amerikanische Universitätsspezies, der ich bisher noch nicht begegnet war; besonders da er seltsam jung schien, um solche Charakterzüge entwickelt zu haben. Doch selbst zu Beginn unserer Bekanntschaft war ich bereit zuzugeben, dass diese Diagnose weit am Ziel vorbeischießen mochte. Er hatte etwas ganz und gar Nicht-Selbstzufriedenes, vermittelte den Eindruck der Verängstigung, des nie endenden Bewusstseins bevorstehenden Desasters.
Am Tisch hatte er in den Speisen auf seinem Teller herumgestochert – eine nicht ungewöhnlich Form des Ausdrucks von Verhaltensgestörtheit, die aber jetzt irritierte, weil das Essen zufälligerweise bemerkenswert gut war. Den Wein wies er zurück. Es mochte sein, dass er ein geheilter Alkoholiker war. Er hatte etwas von diesem traurigen, erschöpften, gedankenverlorenen Fluidum, das unruhige Erinnerungen an stürmischere Zeiten suggeriert. Vor allem aber verbreitete er ein Gefühl der Einsamkeit. Ich unterhielt mich eine Zeitlang mit dem belgischen Schriftsteller an meiner anderen Seite. Dann wurde der Belgier in ein Gespräch mit seinem anderen Nachbarn verwickelt, so dass Gwinnett und ich wieder einander überlassen waren. Ehe ich mir noch etwas Neues zu sagen ausdenken konnte, stellte er mir eine unerwartete Frage. Das passierte gegen Ende des Essens und war ein erstes Zeichen, dass er langsam auftau-te.
»Wie ist der Veronese auf Dogdene im Vergleich zu denen hier an der Wand?«
Das war eine Überraschung.
»Sie meinen den, der gerade von Lord Sleaford verkauft wurde? Ich bin noch nie auf Dogdene gewesen, hab ihn also nur als Reproduktion gesehen. Ich kenne das Haus selbst nur von dem Constable in der National Gallery.«
Der Veronese der Sleafords hatte kürzlich auf einer Auktion eine Summe erzielt, die damals für sehr hoch gehalten wurde. Das Bild hatte Chips Lovell immer stark beschäftigt, und er pflegte sich oft darüber zu beklagen, dass seine Sleaford-Verwandten ihr Glück nicht zu schätzen wüssten, die Besitzer eines Werkes von einem so großen Meister zu sein. Lovell, der sowohl mit Smethyck (jetzt Direktor einer Galerie) als auch mit General Conyers einer Meinung war, dass das Bild gereinigt werden sollte, beschwerte sich auch häufig darüber, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend Gelegenheit habe, die Schönheiten des Gemäldes zu inspizieren. Damals war Dogdene während des Sommers an etwa drei Tagen in der Woche für das Publikum zugänglich. Nach dem Krieg wurde das Haus, wie viele andere Herrensitze dieser Art, gegen Eintritt das ganze Jahr über offengehalten. Dennoch, der Veronese musste verkauft werden, um die Instandhaltungskosten bezahlen zu können. Trotz der Publizität, die der Verkauf damals erhalten hatte, war ich beeindruckt, dass Gwinnett davon gehört hat-te.
»Man hat mir gesagt, es zähle nicht zu den besten Bildern Veroneses – ›Iphigenia‹, nicht wahr?«
Das war Lovells Ansicht gewesen, wenn er sich in einer verunglimpfenden oder demütigen Stimmung befand. Gwinnett schien mehr an dem Gegenstand des Bildes interessiert zu sein als daran, ob Veronese in guter Form gewesen sei.
»Das ist eine faszinierende Geschichte, die es darstellt. Die Frau bringt sich selbst als Opfer dar. Die ruhige Würde, mit der sie dem Tod ins Auge sieht. Tiepolo hat auch eine Iphigenie gemalt, mehr als einmal; ich hab allerdings nur die in der Villa Valmarana gesehen. Es gibt wenigstens noch eine weitere, die in der Reproduktion sogar noch feiner aussieht. Es ist die über die unmittelbare Bedeutung hinausweisende Seite des Mythos, die mich fasziniert.«
Gwinnett klang seltsam erregt. Sein Verhalten hatte sich völlig verändert. Der Gedanke an Iphigenie musste ihn merkwürdig bewegt haben. Dann wechselte er abrupt das Thema. Aus irgendeinem Grund hatte das Gespräch über Veronese etwas in ihm freigesetzt, es möglich gemacht, dass er ein anderes, ganz verschiedenes Motiv einführte, eines, das er, wie sich zeigte, auf dem Herzen gehabt hatte, seit wir uns begegnet waren. Nachdem er ihr einmal Ausdruck gegeben hatte, erklärte die Sache ein bisschen seine wenig umgängliche Art zuvor. Zumindest ließ sie vermuten, dass Gwinnett, wenn er Themen anschnitt, die ihm viel bedeuteten, nicht so sehr eitel und abweisend als vielmehr nervös, gelähmt und seiner selbst unsicher war. Das war mein nächster, als Urteil ebenso unzuverlässiger Ein-druck.
»Sie kannten den englischen Schriftsteller X. Trapnel, Mr. Jenkins?«
»Gewiss doch.«
»Sehr gut, nehme ich an?«
»Ja, ich war ein ziemlicher Trapnel-Experte eine Zeitlang.«
Gwinnett seufzte.
»Ich würde alles darum geben, Trapnel gekannt zu haben.«
»Es hatte seine Höhen und Tiefen, sein Freund zu sein.«
»Sie hielten ihn für einen guten Schriftsteller?«
»Einen sehr guten Schriftsteller.«
»Ich auch. Deshalb hätte ich ihn so gerne kennengelernt. Es wäre möglich gewesen, als ich Student war. Ich war drüben in London. Ich werde wütend auf mich, wenn ich daran denke. Er lebte da noch. Ich hatte seine Bücher damals noch nicht gelesen. Ich hätte sowieso nicht gewusst, wohin ich gehen sollte, um ihn zu treffen.«
»Das Einzige, was Sie hätten tun müssen, war, in einer seiner Kneipen etwas mit ihm zu trinken.«
»Ich hätte ihn nicht einfach ansprechen können. Das hätte er nicht gemocht.«
»Wenn jemand Ihnen ein oder zwei seiner Stammlokale genannt hätte – den Hero of Acre oder den Mortimer –, wären Sie kaum umhingekommen zu hören, wie Trapnel seine Monologe über Bücher und Schriftsteller hielt. Dann hätten Sie ihm vielleicht einen Drink spendiert, und Sie hätten Ihr Ziel erreicht.«
»Trapnel ist das Thema meiner Dissertation – sein Leben und seine Werke.«
»Trapnel wird also einen Biografen haben?«
»Mich.«
»Schön.«
»Sie halten es für richtig?«
»Ganz sicher.«
Gwinnett nickte.
»Ich sollte erwähnen, dass ich bereits geplant hatte, mit Ihnen Verbindung aufzunehmen, Mr. Jenkins – neben anderen, die Trapnel gekannt haben –, wenn ich nach dieser Konferenz in England sein würde. Ich hätte nie erwartet, Sie hier anzutreffen.«
Nachdem mir Gwinnett von seinem Trapnel-Projekt berichtet hatte, hätte man annehmen können, dass unsere Beziehung dabei sei, sich zu entspannen. Das geschah nicht; zumindest trat die Entspannung nicht unmittelbar ein. Für ein paar Minuten schien er sogar die überstürzte Natur seines Geständnisses zu bedauern. Doch dann kam er ein wenig zu seinem früheren, zugänglicheren Verhalten zurück.
»Sie blieben nicht bis zu seinem Tod mit Trapnel in Verbindung, vermute ich?«
»Nur bis etwa vier oder fünf Jahre davor. Es muss jetzt nahezu zehn Jahre her sein, seit ich das letzte Mal mit ihm sprach – doch einmal schickte er mir eine Notiz, in der er mich nach dem Datum fragte, wann ein Buch publiziert worden sei, den genauen Monat, meine ich. Er ist zum Schluss völlig untergetaucht.«
»Was für ein Buch war das – das, von dem er das wissen wollte?«
»Eine Essaysammlung von L. O. Salvidge mit dem Titel ›Papierwein‹. Es war geplant, dass Trapnel es rezensieren sollte, aber der Artikel ist nie geschrieben worden.«
»Wo lebte Trapnel, als er Ihnen schrieb?«
»Er nannte nur eine Nachsendeadresse. Ein Zeitungsgeschäft im Stadtteil Islington.«
»Ich möchte auch Mr. Salvidge aufsuchen, wenn ich nach London komme.«
»Wie Sie wissen, schrieb er die Einführung zu Trapnels postum veröffentlichtem Werk ›Hunde haben keine Onkel‹.«
»Es ist gut. Nicht so groß wie ›Ein Kamelritt zum Grabmal‹, aber gut. Welch ein Gefühl von Unheil dieser andere Titel vermittelt.«
Im Gegensatz zu dem Ableben eines produktiven Autors wie Ferrand-Sénéschal blieb das Ende Trapnels, trotz der Angemessenheit der Umstände, von den Zeitungen unbeachtet. Das war nicht verwunderlich. Er hatte während seiner letzten Jahre kein ›ernsthaftes‹ Werk mehr hervorgebracht. Sein ganzes Leben hindurch war er es gewohnt gewesen, zeitweise ›unterzutauchen‹, wenn die Dinge einen ungünstigen Verlauf nahmen, wobei der Zustand des Untergetauchtseins nach der Affäre mit Pamela Widmerpool, ihrer Zerstörung seines Manuskripts und ihrer Rückkehr zu ihrem Ehemann zu etwas Permanentem wurde. Damals verschwand Trapnel für immer. Ich kannte niemanden, der noch weiter mit ihm verkehrte. Er muss von Zeit zu Zeit geschäftliche Kontakte unterhalten haben. Sein Name erschien hin und wieder im Druck oder im Radio und Fernsehen im Zusammenhang mit Gelegenheitsarbeiten der verschiedensten Art. Gewöhnlich handelte es sich bei Letzteren um eine Zusammenarbeit mit einem professionellen, sicher etablierten Partner, dem Trapnel eine verwertbare Idee vermittelt hatte, die vollständig auszuarbeiten ihm selbst die Energie oder der Wille fehlte. In diesen Fällen des Austauschs mit anderen muss er es darauf angelegt haben, früheren freundschaftlichen Beziehungen, Erinnerungen an »glücklichere Tage«, aus dem Wege zu gehen. Man musste einräumen, dass Trapnel »glücklichere Tage« gekannt hatte, selbst wenn sie von einer eher besonderen Art waren.
Bagshaw bildete ein Beispiel dafür, dass Trapnel Annäherungsversuche seitens eines alten Bekannten bewusst zurückwies. Wie er es für sich selbst nach der Auflösung der »Spaltung« geplant hatte, hatte Bagshaw, als solche ›Lehen‹ noch verhältnismäßig leicht zu erobern waren, ein obskures, aber offensichtlich ziemlich gut dotiertes kleines Reich in der ungebärdigen Welt des Fernsehens errungen. Er war jetzt als ›Lindsay Bagshaw‹ bekannt und unterdrückte seinen Vornamen nicht länger, jetzt, wo er wirkliche Anerkennung fand. Nachdem die Zeitschrift die Publikation eingestellt hatte, sah ich ihn nicht mehr häufig, sondern traf ihn nur noch gelegentlich. Einmal begegneten wir uns im Aufzug des Funkhauses, und er begann sofort, über Trapnel zu sprechen. Schon damals war aus Bagshaw ein ganz anderer Mensch geworden. Erfolg, selbst moderater Erfolg, hatte eine Wirkung gezeitigt.
»Ich hätte gerne gesehen, dass Trappy in einem meiner Programme erscheint. Ist aber völlig unmöglich, ihn aufzuspüren. Ich hab ihn mal vom Oberdeck eines Busses aus gesehen. Es war nicht so sehr der Bart und der lange schwarze Mantel als vielmehr dieses melancholische, distinguierte Fluidum, das Trappy immer hatte. Ich konnte nicht bei voller Fahrt rausspringen. Es war einer dieser dunstigen Abende in Langham Place. Die Lichter leuchteten von all den Fensterreihen in diesem Gebäude. Trappy stand an der Kirche mit dem spitzen Turm. Er schaute zu diesen tausend Fenstern der BBC hoch, alle hell erleuchtet. Etwas an ihm stimmte mich sehr traurig. Ich musste an Arnolds ›The Scholar Gypsy‹ und Christ Church Hall und all das denken, obwohl ich selbst nicht auf der Universität war und es auch jetzt nicht schneite. Ich dachte, das wäre eine glänzende Aufnahme in einem Film gewesen. Ich fragte mich, ob er einem Dokumentarfilm über sein – vergleichsweises – Versagen im Leben zustimmen würde. Etwa einen Monat später traf ich einen seiner Kulis in einer Kneipe. Er würde Trappy später an dem Abend sehen. Ich schickte ihm eine Nachricht. Aber es war sinnlos. Keine Antwort.«
Gelegentlich erschien noch eine Kurzgeschichte von Trapnel oder ein Artikel. Nichts, dessen er sich hätte schämen müssen, aber gleichzeitig auch nichts, dass mit dem alten Standard Trapnels vergleichbar gewesen wäre. Diese Periode in seinem Leben, in der er untergetaucht war, konnte nicht beneidenswert gewesen sein. Er gab den Hero of Acre und all die andern Kneipen auf, in denen er es gewohnt war, einer Schar ausgewählter Anhänger lange Vorträge zu halten. Die Wanderintelligenzija des Schankraums – kulturelle Nomaden einer Rasse ohne Chance, je in die internationale Steppe vorzudringen –, professionelle Zecher, umherziehende Langweiler, Fast-Kriminelle – sie alle mussten jetzt ohne ihn auskommen, waren nun sich selbst überlassen, mussten andere Wege finden, sich zu informieren und zu amüsieren. Wohin Trapnel gegangen war, wen er noch traf, wie er sich am Leben erhielt, konnte man sich nur schwer vorstellen. Wahrscheinlich gab es weiterhin Frauen, die ihn selbst in seinem Niedergang noch ganz passabel fanden – mehr oder weniger ergebene Geliebte, die für so etwas wie ein Überleben sorgten. Wie Trapnel selbst sagen würde – man konnte seine trockene, harsche Stimme förmlich die Worte sprechen hören: Wenn du heruntergekommen bist, macht dich das nicht notwendigerweise unattraktiv für eine Frau. Das war auch eines von Barnbys Themen gewesen: »Damen mögen es, einen Mann zu retten. Eine Aufgabe, die ihnen eine Herausforderung bietet. Sie können sich die Immobilie zu einem billigen Preis aneignen und sie dann rücksichtslos entwickeln.«
Eine Frau mochte sich Trapnel angeeignet haben, eine große Entwicklung war aber eher unwahrscheinlich, ein Minimum an finanzieller Sicherheit wohl das Beste, das man erhoffen konnte. Aber das war immerhin etwas. Gwinnett stimmte mir zu: Es war plausibel anzunehmen, dass nach dem Zusammenbruch von Trapnels Hoffnungen eine relativ umsichtige, lohnempfangende Geliebte die Verwaltung seiner persönlichen Verhältnisse übernommen hatte; es mochte auch eine gutherzige Hauswirtin sein, deren gesunder Menschenverstand seine finanziellen Angelegenheiten – wie immer die aussahen – regelte und den absoluten Notstand abwendete. Das heißt, Gwinnett konnte keine andere Vermutung beisteuern. Seine Zustimmung war nicht enthusiastisch. Sein leichtes Zögern bei der Annahme, dass eine Frau Trapnel finanziell unterstützt haben könnte, regte in mir den Verdacht, dass Gwinnett homosexuell war. Er mochte sowohl ein Homosexueller als auch ein ehemaliger Alkoholiker sein, wobei der erstere, möglicherweise unterdrückte, Zustand ein Ventil in dem letzteren gesucht hatte. Dann brachte er selbst das Thema wieder auf Frauen zurück.
»Ich möchte Sie gerne etwas über diese Frau fragen – die kastrierende Frau.«
»Pamela Widmerpool?«
»Man hat mir so viele Storys über sie erzählt.«