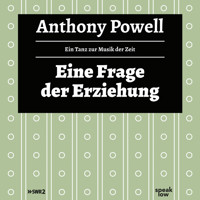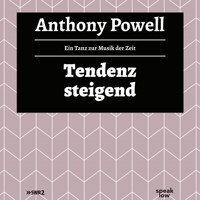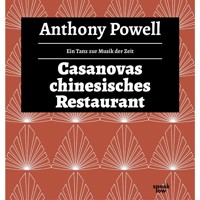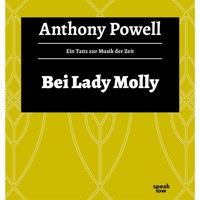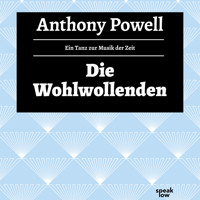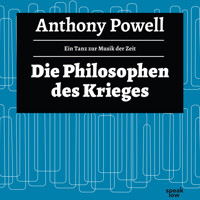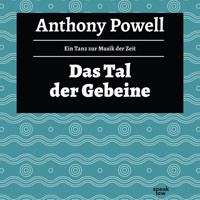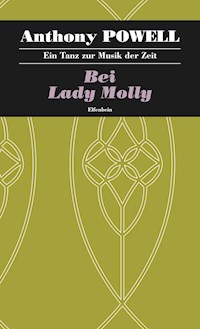Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Tanz zur Musik der Zeit
- Sprache: Deutsch
Der zwölfbändige Zyklus »Ein Tanz zur Musik der Zeit« — aufgrund seiner inhaltlichen wie formalen Gestaltung immer wieder mit Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« verglichen — gilt als das Hauptwerk des britischen Schriftstellers Anthony Powell und gehört zu den bedeutendsten Romanwerken des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von dem gleichnamigen Bild des französischen Barockmalers Nicolas Poussin, zeichnet der Zyklus ein facettenreiches Bild der englischen Upperclass vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten sechziger Jahre. Aus der Perspektive des mit typisch britischem Humor und Understatement ausgestatteten Ich-Erzählers Jenkins — der durch so manche biografische Parallele wie Powells Alter Ego anmutet — bietet der »Tanz« eine Fülle von Figuren, Ereignissen, Beobachtungen und Erinnerungen, die einen einzigartigen und aufschlussreichen Einblick geben in die Gedankenwelt der in England nach wie vor tonangebenden Gesellschaftsschicht mit ihren durchaus merkwürdigen Lebensgewohnheiten. Im zweiten Band sehen wir den Protagonisten auf Bällen und Partys der Oberklasse, aber auch der Boheme, wo er neue und immer wieder alte Bekannte trifft — sowie erste Liebschaften erlebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Powell
Tendenz: steigend
Roman
Ein Tanz zur Musik der Zeit –Band 2
Aus dem Englischen übersetzt von Heinz Feldmann
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1952 unter dem Titel
»A Buyer’s Market« bei William Heinemann, London.
Band 2 des Romanzyklus »A Dance to the Music of Time«
A Buyer’s Market
©John Powell and Tristram Powell, 1952
© 2015 / 2016 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-77-0 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-37-4 (Druckausgabe)
1
Das letzte Mal, dass ich einige von Mr. Deacons Arbeiten sah, war auf einer Auktion, die aus unerfindlichen Gründen in der Nachbarschaft der Euston Road stattfand, viele Jahre nach seinem Tod. Keines der Bilder war mir vertraut, aber sie riefen, neben vielen anderen Dingen, besonders das Abendessen bei den Walpole-Wilsons in mein Gedächtnis zurück und belebten schlagartig die Erinnerung an jene Phase meiner Jugend. Sie weckten Gedanken an lang vergessene Konflikte und Kompromisse zwischen der Vorstellung und dem Willen, der Vernunft und dem Gefühl, der Macht und der Sinnlichkeit; aber auch an viele ganz persönliche Empfindungen der Freude und des Schmerzes, die ich in der Vergangenheit durchlebt hatte. Das Frühlingswetter draußen war kühl und sonnig: Mr. Deacons bevorzugte Jahreszeit. Die Ölgemälde im Innern, gegen drei Seiten eines Waschtisches gelehnt, schienen irgendwie in diese staubige, aber nicht unangenehme Umgebung zu passen, die auf ihre Weise auch an die Art von Wohnung erinnerte, die Mr. Deacon für sich selbst und seine Habe bevorzugte: an das Wohnzimmer über dem Geschäft zum Beispiel, formlos, nicht zu dauerhaft, ziemlich heruntergekommen. Seine Lieblingslokale, so erinnerte ich mich, lagen in diesen nördlichen Grenzbereichen Londons.
Ansammlungen beziehungsloser Objekte, die für eine Auktion zusammengetragen worden sind, nehmen, in der wahllosen Art ihrer Anhäufung, eine gewisse eigene Würde an: Gegenstände, die in einer bewohnten Behausung nicht zu ertragen sind, finden alle ihren eigenen Platz in diesen weitläufigen, anonymen Höhlen, wo diese Belanglosigkeiten, ohne Anspruch auf individuellen Wert zu erheben, still miteinander und mit der allgemeinen Nüchternheit des Hintergrundes harmonieren. Solche Lokalitäten haben etwas von Museen an sich, und die umherziehende Menge begutachtet gewöhnlich die angesammelten Überreste mit sachkundiger, unbefangener Intensität, die keineswegs nur auf kommerziellen Gewinn oder Erwerb ausgerichtet ist.
Hier in diesen Räumlichkeiten schien fast jedes von Menschen gemachte Ding vertreten zu sein: verhältnismäßig neue Rasenmäher; scheidenlose und rostige Kavalleriesäbel; Bruchstücke eines afrikanischen Fetischs aus Ebenholz; eine Schreibmaschine aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf langen Metallfüßen unsicher platziert inmitten eines Teeservice aus Liverpooler Steingut, dessen schwarzweißes Landschaftsdessin irreparabel beschädigt war. Mehrere mit der englischen Flagge bezogene Kissen und Kopfpolster legten den bestürzenden Schluss nahe, dass irgendwo tief unter ihnen ein Leichnam auf sein Begräbnis mit militärischen Ehren wartete. Weiter hinten waren hohe Rollen blauen, grünen und rosafarbenen Linoleums wie Säulen gegen die Wand gestellt, eine minoische Kolonnade, von der aus Korbsessel und stark abgenutzte Gepäckstücke einen Halbkreis bildeten. In der Mitte dieses offenen Raumes stand, fast wie ein für den Gottesdienst dort aufgestellter Altar, der Waschtisch, um den die Bilder gruppiert waren. Auf seiner Marmorplatte hatten ein leerer Vogelkäfig, zwei vermutlich deutsche Zinnsoldaten und ein Stapel stark zerlesener Walzer-Noten ihren Platz gefunden. Vor einem Streifen eines maschinengewebten noppigen Teppichs, der wie ein verblichener Wandbehang an der Seite eines Kleiderschranks aus Kiefernholz herabhing, stand, mit dem Kopf nach unten, ein viertes Gemälde.
Alle vier Bilder gehörten zu der gleichen Schule großer, unordentlich angelegter Kompositionen ausschließlich männlicher Figuren, hell im Ton und mythologisch in der Thematik: dem Einfluss, nicht aber genau auch dem Geist nach präraffaelitisch – ein Kompromiss zwischen, etwa, Burne-Jones und Alma-Tameda, mit vielleicht einer Spur von Watts in der Methode des Farbauftrags. Eines von ihnen, das sich oben aus dem Keilrahmen gelöst hatte, datierte von 1903. Eine offenkundige Schwäche im Zeichnen wurde noch betont durch die absolute Gewissheit – die allerdings auch einige der größten Maler einholt –, dass keines von Mr. Deacons Bildern in einer anderen als seiner eigenen Epoche hätte gemalt werden können. Dieses Kennzeichen der Zeitlichkeit war hier besonders der Vorliebe des Malers für große, leere Flächen oft verwegen aufgetragener Farbe zuzuschreiben. Doch trotz ihrer augenscheinlichen Mängel hatten die Bilder, wie ich schon sagte, in dieser Situation etwas Ansprechendes und Passendes. Selbst der Wald von umgekehrten Beinen, die sich, offenbar in einem Laufwettbewerb bei den Olympischen Spielen, wild auf ihr Ziel zubewegten, zeigte sich zu seinem größeren Vorteil, wahrscheinlich wegen dieser verkehrten Stellung, in der er ein immenses Gefühl nervöser Dringlichkeit vermittelte, wobei die Fleischtöne der angestrengten Glieder der Athleten seltsam mit den rosafarbenen und gelben Konturen von drei Amoretten aus nachgemachtem Meißner Porzellan kontrastierten, die nebeneinander auf einem Nachtschränkchen dahertrippelten.
Nach einiger Zeit hielten zwei bukolische Gestalten in Sportmützen, Hemdsärmeln und Schürzen aus grünem Fries Mr. Deacons Bilder nacheinander hoch, damit sie von einer kleinen Schar von Händlern – einer deprimierten Gruppe von Männern, die aussahen, als ob sie sich zwischen zwei ihnen mehr zusagenden Ereignissen auf dem Rennplatz in die Auktion verirrt hätten – begutachtet werden konnten. Ich war mir nicht sicher, welchen Eindruck diese Zurschaustellung auf andere Leute machen mochte, und war froh, dass es während der Vorführung keine unfreundlichen Kommentare gab. Die ungeheure Größe der dargestellten Szenen hätte an sich schon sehr wohl zum Lachen reizen können; und obwohl ich damals schon genug über Mr. Deacon wusste, um seine Malerei nicht für ernsthafter zu halten als eine Reihe anderer in ihm im Widerstreit liegender Elemente, hätte mich die offene Verspottung seines Werkes doch betrübt. Alle vier Bilder trafen jedoch, als sie so eins nach dem anderen hochgehalten wurden, nur auf apathisches Schweigen; und obwohl sie alle zusammen schließlich jemandem für nur ein paar Pfund zugeschlagen wurden, war das Bieten selbst ziemlich lebhaft – möglicherweise wegen der Rahmen, die aus einem schwarzen Material gemacht waren, das ein goldenes Blumenmuster schmückte, wohl ein Entwurf des Malers selbst.
Mr. Deacon muss unser Haus während meiner Kindheit wenigstens ein halbes Dutzend Mal besucht haben, und bei diesen Gelegenheiten hatte ich ihn dann ganz zufälligerweise mehr als einmal gesehen und gesprochen. Ich weiß jedoch nicht, warum sich unsere Wege damals kreuzten, denn man sagte von ihm immer, er könne »Kinder nicht leiden«, so dass unsere Begegnungen, wenn man sie so nennen konnte, wohl kaum von meinen Eltern absichtlich arrangiert worden waren. Mein Vater, den die Unterhaltungen mit Mr. Deacon amüsierten, sprach gewöhnlich ohne Enthusiasmus von seiner Malerei; und wenn Mr. Deacon, wie er es manchmal tat, behauptete, er ziehe es vor, seine Bilder selbst zu behalten, statt sie zu verkaufen, rief diese Bemerkung bei uns zu Hause immer einen mild-ironischen Kommentar hervor, nachdem er gegangen war. Es wäre jedoch nicht fair, damit sagen zu wollen, dass Mr. Deacon, professionell gesehen, unfähig gewesen sei, einen Absatzmarkt für seine klassischen Sujets zu finden. Im Gegenteil, er konnte immer mehrere treue Käufer aufzählen, zumeist Geschäftsleute aus Mittelengland. Besonders einer unter ihnen, von ihm der »große Eisen-Mann« genannt – den ich mir immer als physisch aus dem Metall konstruiert vorstellte, von dem sein Einkommen herrührte –, pflegte zum Beispiel einmal im Jahr aus Lancashire nach London herunterzukommen und jedes Mal im Besitze einer Ölskizze des Antinous oder eines Bündels von Kohlestudien trainierender junger Spartaner in den Norden zurückzukehren. Mr. Deacon zufolge hatte eine dieser kleineren Arbeiten sogar ihren Weg in die örtliche Kunstgalerie des Eisenfabrikanten gefunden – eine Auszeichnung, die dem Maler offensichtlich große Befriedigung bereitete; doch pflegte Mr. Deacon von dieser Sache in einem missbilligenden Ton zu sprechen, denn er verurteilte die »offizielle Kunst«, wie er sie nannte, und sprach immer mit großer Bitterkeit von der Royal Academy. Als ich ihn später im Leben wiedertraf, entdeckte ich, dass er den Impressionisten und den Nachimpressionisten fast die gleiche Abneigung entgegenbrachte und, natürlicherweise, spätere Trends wie den Kubismus oder die Werke der Surrealisten sogar noch stärker ablehnte. Ja, Puvis de Chavannes und Simeon Solomon, von denen er den letzteren, glaube ich, als seinen Meister betrachtete, waren die einzigen Maler, von denen ich ihn je mit uneingeschränktem Beifall habe sprechen hören. Die Natur hatte ihn zweifellos dazu bestimmt, so etwas wie ein zweitrangiger Vertreter der Kunstbewegung der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zu sein; doch irgendwie hatte Mr. Deacon in seiner Jugend diesen Geist verfehlt – ein moralisches Getrenntsein, das vielleicht einen späteren Mangel an Einordnung erklärte.
Er war nicht reich, doch erlaubte ihm sein damaliges Einkommen die Bewahrung einer ziemlich unabhängigen Haltung im Hinblick auf die mehr materielle Seite der Existenz eines Malers. So hatte er einmal die Gelegenheit zurückgewiesen, das Innere eines Fischrestaurants in Brighton – wo er damals lebte – auszumalen, weil die gebotene Summe in keinem Verhältnis zu der erniedrigenden Natur der verlangten Arbeit gestanden habe. Seine Mittel hatten es ihm auch ermöglicht, eine, wie es hieß, exzellente kleine Sammlung von Sanduhren, Schattenrissen und Nippsachen der verschiedensten Art zusammenzutragen. Gleichwohl beschrieb er gelegentlich gern, wie er, um die Ausgaben und die Verantwortung für Dienstboten zu vermeiden, es willentlich auf sich nahm, über lange Zeitabschnitte für sich selbst zu kochen. »Ich könnte immer meinen Lebensunterhalt als Koch verdienen«, pflegte er zu sagen und scherzhaft hinzuzufügen, dass er in einer weißen Mütze »enorm dekorativ« aussehen würde. Wenn er das europäische Festland bereiste, tat er das gewöhnlich zu Fuß, mit dem Rucksack auf dem Rücken, statt mit der Eisenbahn, die er »stickig« fand und »unendlich voll von langweiligen Leuten«. Er war sorgsam, ja fast übertrieben ängstlich auf seine Gesundheit bedacht, besonders in Bezug auf die persönliche Reinlichkeit und gute sanitäre Einrichtungen; so dass einige der unappetitlicheren Seiten dieser vorgeblichen Terre-à-terre-Ausflüge ins Ausland für ihn manchmal eine harte Prüfung gewesen sein mussten. Vielleicht waren seine Besuche auf dem Festland aber in Wirklichkeit quälender für die Geschäftsführer der Hotels und Restaurants, die er frequentierte, denn für ihn war es von großer Wichtigkeit, absolut darauf zu bestehen, dass andere seinen Wünschen bis ins Einzelne nachkamen. Ohne Zweifel waren solche Reisegewohnheiten, soweit er sie wirklich freiwillig annahm und nicht durch finanzielle Erwägungen in einem gewissen Maße dazu gezwungen wurde, in seiner Vorstellung auch mit seiner eigenen, besonderen Auffassung von gesellschaftlichem Verhalten verknüpft, in der er von einer oft geäußerten Abneigung gegenüber einem Betragen geleitet wurde, das auch nur den Anschein erweckte, entweder konventionell oder konservativ zu sein.
In dieser letzteren Hinsicht ging Mr. Deacon weiter als mein Onkel Giles, der mit seinem Bekenntnis, »so etwas wie ein Radikaler« zu sein, im Kreise seiner eigenen Familie, ja, wo immer er sich befinden mochte, auch nie hinter dem Berg hielt. Aber mein Onkel bezog sich dabei auf eine Materie, die er kannte und die er, obwohl er das nie zugegeben hätte, sogar bis zu einem gewissen Grade verehrte; er wünschte nur, dass die meisten Seiten dieser vertrauten Welt besser seinem eigenen Geschmack angepasst seien. Mr. Deacon dagegen trat dafür ein, die existierende Welt gänzlich abzuschaffen oder zu ignorieren, um dann mit einer Welt ganz anderer Ordnung experimentieren zu können. Er beschäftigte sich mit Esperanto (oder, möglicherweise, einer der weniger bekannten künstlichen Sprachen), war, mit Unterbrechungen, Vegetarier und verfocht das Dezimalsystem für Münzen. Gleichzeitig bekämpfte er entschieden die Einführung einer Rechtschreibreform des Englischen (mit der Begründung, dass solche Veränderungen für ihn John Miltons »Verlorenes Paradies« ruinieren würden), und ich kann mich erinnern, dass gesagt wurde, er hasse »Frauenrechtlerinnen«.
Solche Auffassungen wären, mit der möglichen Ausnahme des Dezimalsystems für Münzen, bei meinem Onkel als bloße Marotten angesehen worden; aber da Mr. Deacon sie fast immer in einer leicht amüsanten Art darlegte, waren meine Eltern hier weit duldsamer als gegenüber ähnlichen Vorurteilen, die mein Onkel verbreitete, dessen herzlich bedauerte Ansichten von den meisten seiner Verwandten automatisch mit der gegen sie gerichteten Gefahr bevorstehender finanzieller Sorge verbunden wurden – von möglichen Skandalen innerhalb der Familie ganz zu schweigen. Wie auch immer, aggressive persönliche Meinungen, welcher Art sie auch seien, werden wohl zu Recht als unerwünscht betrachtet, oder es wird ihnen bestenfalls geringes Gewicht beigemessen, wenn sie von einem Menschen ausgesprochen werden, dessen Lebensverlauf so konstant erfolglos ist, wie es der von meinem Onkel gewesen war. Mr. Deacons Überzeugungen dagegen konnte man tolerant als Teil des Rüstzeugs eines professionellen Malers – der auch keineswegs ein Versager war – ansehen und sie, wie widerwillig auch immer, als unvermeidliches Zubehör eines Boheme-Berufes hinnehmen, ja sogar als etwas auf ihre Art Wertvolles, da sie eine andere Seite menschlicher Erfahrung veranschaulichten.
Gleichwohl betrachteten ihn meine Eltern, obschon sie sich zweifellos über seine gelegentlichen Besuche freuten, mit Recht als einen Exzentriker, der sich, wenn man nicht sehr aufpasste, leicht zu einem langweiligen Schwätzer entwickeln konnte; und es würde nicht ganz der Wahrheit entsprechen, wenn ich behauptete, dass sie ihn mochten. Mr. Deacon seinerseits aber mochte sie beide, glaube ich. Die Umstände, unter denen sie sich kennengelernt hatten, sind nicht überliefert. Vielleicht wurden sie einander bei einem der Konzerte im »Pavilion« von Brighton vorgestellt, die meine Eltern manchmal besuchten, als mein Vater in den Jahren vor dem Krieg in der Nähe stationiert war. Es steht fest, dass sie Mr. Deacon während dieser Zeit einen Besuch in seinem Studio abstatteten: einer Reihe von kleinen Räumen, die zu diesem Zweck in dem Dachgeschoss eines Hauses umgebaut worden waren, das an einem der ruhigen Plätze weit weg von der Strandpromenade lag. Er hatte diese abgeschiedene Lage gewählt, weil ihn der Anblick des Meeres bei seiner Arbeit störte – eine Befangenheit, für die sich jetzt sicher leicht eine psychologische Erklärung finden ließe.
Ich selbst habe das Studio nie gesehen, aber meine Eltern oft davon sprechen gehört, dass es mit verschiedenen Raritäten angefüllt gewesen sei. Wir sind aus dieser Gegend noch vor dem Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 weggezogen und haben wohl die Verbindung mit Mr. Deacon verloren; aber noch lange danach erinnerte ich mich an den Eindruck, den seine Körpergröße auf mich machte, als er mir eines Tages nach dem Tee einen hölzernen Farbkasten, dessen Farben in Tuben waren, schenkte, wobei der schwere Duft seines Tabaks um die Falten und den Gürtel seiner Norfolkjacke hing – eines Kleidungsstücks, das schon ein wenig altmodisch auszusehen begann –, und an den Klang seiner tiefen, ernsten Stimme, während er mir die Skala der Farben in dem Kasten erklärte und von den Prinzipien des Lichtes und des Schattens sprach: Prinzipien, so konnte ich nicht umhin zu denken, während ich die Gemälde in dem Auktionsraum betrachtete, die sein Pinsel so oft und so heftig verletzt haben musste.
Vor jenem Abschnitt in meinem Leben, in dem ich zufälligerweise auf diese vier Bilder stieß, hatte ich während unserer kurzen späteren Bekanntschaft natürlich Gelegenheit gehabt, Mr. Deacon in einer Umgebung zu beobachten, die ganz anders war als die häusliche Privatheit meiner Eltern, wo ich zuerst Gespräche über seine Eigenarten gehört hatte; und ich hatte auch – vor der Zeit, in der ich mich in dem Auktionsraum befand – seinen Charakter mit Personen wie Barnby diskutiert, die ihn viel näher gekannt hatten, als das bei mir je der Fall gewesen war. Wie dem auch sei, ich verfiel wieder einmal in Grübeleien über die Diskrepanz zwischen einem Malstil, der selbst zu Mr. Deacons Frühzeit unmodern und, bestenfalls, trocken-formalistisch gewesen sein muss, und den revolutionären Prinzipien, die er predigte und – außer auf dem Gebiet der Ästhetik – auch in einem beträchtlichen Maße praktizierte. Ich fragte mich wieder, ob dieser offensichtliche Widerspruch in seiner Einstellung, der mich einmal beunruhigt hatte, widerstrebende Seiten seines Charakters symbolisierte oder ob sein Leben, sein Werk und seine Ansichten an irgendeinem Punkt miteinander verschmolzen und so einen Standpunkt ergaben, der in Wirklichkeit aus einem Guss war oder, wie er es selbst ausgedrückt hätte, »ein Kunstwerk darstellte«.
Natürlich konnte ich dieses Problem nicht an Ort und Stelle in dem Auktionsraum lösen, zwischen den Möbelstücken und dem Linoleum, bei dem Lärm des Bietens und des Zuschlagens des Hammers, auch nicht in dem Licht späterer Umstände, in denen ich ihn gekannt hatte; und es ist mir nie wirklich gelungen, zu einem eindeutigen Schluss in dieser Frage zu kommen. Ohne Zweifel stellte Mr. Deacons Malerei, in ihrer eigenen Weise, den extremsten Punkt seines Romantizismus dar, und ich glaube, man könnte mit einigem Recht behaupten, dass auf solchen Trümmern klassischer Bildmotive die Fundamente zumindest bestimmter Elemente der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts errichtet wurden.
Wie dem auch sei, der fast gänzliche Mangel an Fantasie in Mr. Deacons Malerei resultierte letztlich in einem Werk, das nicht an die ›Romantik‹ und schon gar nicht an den ›Klassizismus‹ denken ließ, sondern an ein unendlich banales Muster des täglichen Lebens; denn man verband die griechischen und römischen Episoden, die er darstellte, unwillkürlich mit der Welt der gemütlichen Kneipen und Teestuben – »wenigstens, wenn man sie sich«, wie Barnby zu sagen pflegte, »als Bildreproduktionen, etwa in Fotogravüre, vorstellt«, obwohl Barnby selbst, wenn er in einer bestimmten Stimmung war, immer wenigstens einige Aspekte von Mr. Deacons Kunst zu verteidigen versuchte. Kurz gesagt, die Bilder erinnerten eher an Zugaben zur Weihnachtsnummer einer Zeitschrift als an die Pracht von Sunions marmorner Höhe oder jene blaue sizilianische See, die als Hintergrund zu dem viktorianischen Hellenismus diente, der an unserer Schule von Le Bas, meinem Hausdirektor, propagiert wurde. In der Tat hätte man, allerdings auf einer sehr viel niedrigeren Ebene der Fantasie, Mr. Deacons Malerei mit Le Bas’ Tagträumen von Hellas vergleichen können; und vielleicht hätte auch Mr. Deacon letzten Endes besser daran getan, den Beruf eines Lehrers zu wählen. Unbestreitbar hatte er etwas Schulmeisterliches an sich, obwohl ich natürlich als Kind nie über seine Eigenheiten, die ich nur aus Gesprächen meiner Eltern und des Dienstpersonals kannte, nachgedacht hatte.
Dieser Anflug von Pedanterie war mir erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgefallen, als wir in den Sommerferien bald nach Beendigung des Krieges, während mein Vater noch in Paris Dienst tat, Mr. Deacon zufällig im Louvre begegneten. Ich hatte mich an diesem Nachmittag schon gefragt, wer die große, hagere, ziemlich gebeugte Gestalt sein mochte, die am hinteren Ende der Galerie rastlos hin und her ging, ihn aber nicht sofort erkannt; als jedoch, nach so vielen Jahren, sein Name wieder fiel, wusste ich augenblicklich, wer er war. Während wir zu ihm herankamen, betrachtete er gerade mit großer Aufmerksamkeit Peruginos »Heiligen Sebastian« und hatte, um, leicht vorgebeugt, das Bild besser untersuchen zu können, soeben ein kleines Vergrößerungsglas mit Goldrand hervorgeholt. Er trug einen festen Anzug in Pfeffer und Salz – diesmal ohne Gürtel und Seitenfalten – und hielt einen breitrandigen, pelzartigen Hut in der Hand. Seine ganze Aufmachung war von einer vielleicht beabsichtigten leichten Schäbigkeit, und zu diesem allgemeinen Eindruck kam noch die beunruhigende Vermutung hinzu, dass sein leicht gekrümmter Rumpf vielleicht in einer Art Korsett steckte, das nur unvollkommen passte. Sein graues Haar, das er zu lang trug, war glatt nach hinten gebürstet und unterstrich ein ziemlich bemerkenswertes Profil: ein wenig wie das eines Schauspielers, der für die Rolle des Prospero zurechtgemacht worden ist, mit stark zerfurchtem, ernstem Gesicht, ohne aber irgendeinen Eindruck von Niedergeschlagenheit zu vermitteln.
Er erkannte meine Eltern sofort und begrüßte sie mit einer seltsamen, gespreizten Förmlichkeit, wieder wie ein altmodischer Schauspieler. Mein Vater, der nicht in Uniform war, erklärte ihm, dass er zu der Delegation für die Konferenz abkommandiert sei. Mr. Deacon hörte mit einem Ausdruck größter Aufmerksamkeit zu, verstand jedoch nicht – oder es wäre vielleicht richtiger zu sagen: gab aus nur ihm bekannten Gründen vor, nicht zu verstehen –, um welche Art von Tätigkeit es sich dabei handelte. In seiner volltönenden, leicht ironischen Stimme fragte er: »Und worüber bitte konferieren Sie?«
Zu dieser Zeit war Paris voll von Gesandtschaften und Delegierten, Emissären und bevollmächtigten Ministern der verschiedensten Art, die alle wegen der Verhandlungen zum Friedensvertrag dorthin gekommen waren; und wahrscheinlich konnte sich mein Vater nicht vorstellen, dass Mr. Deacon wirklich weitere Einzelheiten über seine Arbeit, die, glaube ich, etwas mit Abrüstung zu tun hatte, zu hören wünschte. Es war schließlich eine Sache, die, wenigstens in den Details, nur von professionellem Interesse sein konnte. Sicher kam mein Vater nicht auf den Gedanken, dass Mr. Deacon zu dem Entschluss gekommen sein musste, für den Moment seine Augen vor der Konferenz und vor vielem – wenn nicht allem –, das zu ihrer Existenz geführt hatte, zu verschließen, oder es wenigstens vorzog, zumindest zu diesem Zeitpunkt alle ihre gegenwärtigen Umstände zu ignorieren. Die Antwort meines Vaters war deshalb, zweifellos mit Absicht, in vorsichtige, allgemeine Worte gefasst; und die Erklärung brachte, soweit man sehen konnte, Mr. Deacon nicht weiter in der Erkenntnis, warum wir uns zu dieser Stunde im Louvre aufhielten.
»In Verbindung mit jenen expositions, die die Franzosen so lieben?«, fragte er. »Sie sind also nicht mehr militaire?«
»Eigentlich haben sie nicht entfernt so viel Ärger gemacht, wie Sie vielleicht annehmen«, sagte mein Vater, der diese Frage als eine absonderliche Form von Anspielung auf vermutete Unnachgiebigkeiten auf Seiten des französischen Stabsoffiziers aufgefasst haben musste, der bei den Verhandlungen sein ›Gegenüber‹ bildete.
»Ich weiß nicht viel von diesen Dingen«, gab Mr. Deacon zu.
Man ließ es dabei bewenden, und das Gespräch wandte sich der Darstellung des Heiligen Sebastian zu. Hier stellte Mr. Deacon plötzlich eine ganz unerwartete Kenntnis der militärischen Rangordnung – zumindest einer etwas veralteten Form – zur Schau, indem er darauf hinwies, dass der Heilige, da er den Rang eines Zenturios innegehabt habe und folglich ein Feldwebel oder Hauptfeldwebel mit verhältnismäßig hohem Dienstalter gewesen sei, wahrscheinlich ein weniger jugendliches und insgesamt weit gröberes Aussehen besessen habe, als es ihm von Perugino und ja auch gewöhnlich von den meisten anderen Malern hagiografischer Themen verliehen worden sei. Allgemein auf die Peruginos, die sich sonst noch in der Galerie befanden, zu sprechen kommend, erklärte Mr. Deacon, dass mehr als einer von ihnen als »Raphael« bezeichnet sei. Wir zweifelten diese Behauptung nicht an. Auf die Frage, wie lange er selbst schon in Paris lebe, gab Mr. Deacon eine vage Antwort; und es wurde auch nicht deutlich, was er während des Krieges, dessen Verlauf er kaum wahrgenommen zu haben schien, getrieben hatte. Er ließ anklingen, dass er sich mehr oder weniger für immer, zumindest aber für eine lange Zeit »im Ausland niedergelassen« habe.
»Es gibt wirklich Augenblicke, in denen fühle ich, dass ich mehr Gemeinsamkeiten mit den Franzosen habe als mit meinen eigenen Landsleuten«, sagte er. »Ihre praktische Art, die Dinge zu betrachten, spricht eine bestimmte Seite von mir an – wenn vielleicht auch nicht die beste Seite. Wenn man hier etwas will, lautet die Frage: Hast du das Geld, um dafür zu bezahlen? Wenn sie bejaht wird, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, muss man darauf verzichten. Außerdem, die Atmosphäre ist freier hier. Das ist etwas, das Revolutionen bewirken. Paris ist wirklich ohne Vergleich in der Welt.«
Er lebe, so sagte er uns, »in einer kleinen Wohnung in einer der Seitenstraßen des Boul’ Mich’«.
»Ich fürchte, in dem Zustand, in dem sie sich im Augenblick befindet, kann ich Sie unmöglich dahin einladen. Es dauert immer eine Ewigkeit, wenn man irgendwo einzieht. Und ich habe so viele Schätze.«
Auf die Frage nach seiner Malerei schüttelte er den Kopf.
»Ich bin jetzt mehr an meinen Sammlungen interessiert«, sagte er. »Einer der Gründe, warum ich hier bin, ist, hier gelegentlich etwas für Freunde und für mich selbst anzukaufen.«
»Aber ich nehme an, Sie machen noch hin und wieder mit Ihrer Arbeit weiter.«
»Warum soll man schließlich den Müll in dieser vergänglichen Welt weiter vermehren?«, fragte Mr. Deacon und zog die Schultern hoch und lächelte. »Dennoch, manchmal nehme ich mein Skizzenbuch mit in ein Café – am liebsten in irgendein kleines estaminet in einem der Arbeiterviertel. Man sieht einen guten Kopf hier, eine kraftvolle Pose dort. Ich sammle Köpfe – und Hälse –, wie Sie sich vielleicht erinnern.«
Er selbst lehnte eine Einladung zum Lunch im Interallié, einem Club, von dem er offensichtlich noch nie gehört hatte, höflich, aber ziemlich bestimmt ab. Doch beschwerte er sich darüber, dass Paris teurer sei als früher, und beklagte gleichzeitig die ›Amerikanisierung‹ des Quartier Latin.
»Manchmal überlege ich mir, ob ich nicht auf den Montmartre ziehen soll wie die Maler zur Zeit Whistlers«, sagte er.
Das Gespräch fand danach bald ein Ende. Er fragte noch, wie lange wir in Frankreich blieben, und es schien fast so, als sei er erleichtert darüber, dass wir bald wieder in England sein würden. Beim Abschied konnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass die Begegnung, ohne dass man dafür augenfällige Gründe hätte nennen können, eine gewisse Unbehaglichkeit erzeugt hatte. In dieser Hinsicht war sie nicht unbedingt schlechter, als sich solche Treffen häufig erweisen, wenn Personen, die nicht viele Gemeinsamkeiten haben, sich nach langer Trennung plötzlich wiedersehen und auf gemeinsame Interessen zurückgreifen müssen, die sie inzwischen halb vergessen haben. Dieses leise Gefühl der Spannung war vielleicht auch ein wenig auf Mr. Deacons offensichtliche Weigerung zurückzuführen, beim Austausch autobiografischer Neuigkeiten auch nur bis zu jenem Punkt zu gehen, wo das sicher noch als frei von dem schwächsten Hauch einer ungebührlichen Zurschaustellung von Egoismus angesehen werden durfte – besonders da das Gespräch sich hauptsächlich deshalb in so engen Grenzen bewegte, weil eine Seite nicht die geringste Vorstellung davon besaß, was die andere während einer Reihe von Jahren getrieben hatte.
»Ich hab mich gefreut, Deacon wiederzusehen«, sagte mein Vater später an diesem Nachmittag, als wir auf dem Weg zum Tee in der Wohnung der Walpole-Wilsons in Passy waren. »Er sah sehr viel älter aus.«
Das muss wohl das letzte Mal gewesen sein, dass ich meinen Vater oder meine Mutter von Mr. Deacon oder seinen Angelegenheiten habe sprechen hören.
Die Begegnung im Louvre blieb aber, neben anderen Erfahrungen auf dieser meiner ersten Auslandsreise, als etwas ziemlich Wichtiges in meiner Erinnerung. Mr. Deacons erneutes Auftauchen in diesem Sommer schien nicht nur die Trennung des Reifseins von der Kindheit zu markieren, sondern auch die Abhängigkeit dieser beiden Zustände voneinander besonders zu betonen. Mr. Deacon war schon in der ›früheren Zeit‹ ›erwachsen‹ gewesen, und er war es noch immer. Ich selbst dagegen hatte mich verändert. Es musste noch eine Strecke zurückgelegt werden, aber ich war auf dem Wege, als Mit-Erwachsener zu Mr. Deacon aufzuschließen; und er selbst war nicht mehr länger ein Fantasieprodukt aus der Erinnerung meiner Kindheit, sondern ein sichtbarer Beweis dafür, dass das Leben in ziemlich der gleichen Weise existiert hatte, ehe ich in einem ernst zu nehmenden Maße begann, an ihm teilzunehmen, und ohne Zweifel weiter so ablaufen würde, wenn er und ich schon lange nicht mehr dazugehörten. Zusätzlich zu dieser Würdigung seiner Bedeutung als so etwas wie ein Meilenstein auf der gewundenen, staubigen Straße des Seins entdeckte ich noch eine andere interessante – wenn auch nicht völlig angenehme – Seite an Mr. Deacons Persönlichkeit. Er hatte mich mit einem langen, abschätzenden Blick angesehen, als wir uns zur Begrüßung die Hände schüttelten – eine an sich schon irgendwie unerwartete Handlung –, und mich später mit der gleichen tiefen, ernsten Stimme, mit der er mir in früherer Zeit seine Ansichten über Farbtonwerte dargelegt hatte, nach meinen Lieblingsbildern in der Galerie und anderswo gefragt und dann meiner Antwort zugehört, als ob die darin enthaltene Information für ihn selbst von beträchtlicher Bedeutung sein könnte.
Diese augenscheinliche Hochachtung meiner notwendigerweise noch unfertigen Meinung gegenüber war so schmeichelhaft, dass ich mich seiner noch deutlich erinnerte, nachdem wir schon lange nach England zurückgekehrt waren; und als ich sechs oder sieben Jahre später die Signatur ›E. Bosworth Deacon‹ in der Ecke eines Ölgemäldes sah, das hoch an der Wand im innersten Teil der Eingangshalle des Hauses der Walpole-Wilsons am Eaton Square hing, kam mir plötzlich die Atmosphäre jener Begegnung im Louvre – das Gespräch über die Konferenz und den »Heiligen Sebastian«, das Gefühl des Befangenseins (fast der Verlegenheit), der Besuch bei eben diesen Walpole-Wilsons später am Nachmittag – sehr klar wieder ins Bewusstsein zurück; und mit alldem auch die Illusion einer allgemeinen Erleichterung, die Teil jener historischen Epoche war: darüber, dass der Krieg, so überraschend, zu Ende sei und dass nun eine ›schöne Zeit‹ bevorstünde; und auch jenes seltsame Gefühl der intellektuellen Emanzipation, die zu der Kunst jener Epoche gehörte oder, wohl fälschlicherweise, zumindest zu ihr zu gehören schien; und auch, wie sich die Erregtheit und Melancholie dieser Kunst mit den kaleidoskopischen Eindrücken meiner ersten Erfahrung von Paris gemischt hatten. All diese Gedanken drängten sich mir kurz und schnell auf, während ich bei meinem ersten Besuch in dem Haus am Eaton Square – ich war inzwischen nach London gezogen – meinen Mantel ablegte und dabei Mr. Deacons Bild wahrnahm. Das Gemälde – vergleichsweise klein für einen ›Deacon‹ und offensichtlich von seinen Besitzern nicht sehr geschätzt – hatte jenseits der Treppe seinen Platz gefunden, über einem Barometer in einem Mahagonigehäuse. In Thema und Stil war es den Bildern in dem Auktionsraum ähnlich. Das Goldtäfelchen am Fuße des Rahmens besagte knapp und ohne den Namen des Malers zu nennen: »Kyros als Knabe«. Dies war nun das allererste Mal, dass ich einen ›Deacon‹ erblickte.
Die Bedeutung, die »Kyros als Knabe« schließlich für mich annahm, hatte jedoch nichts mit dem Maler oder dem künstlerischen Wert des Bildes selbst zu tun – wenn es ihn besaß. Es erlangte Wichtigkeit einzig und allein als Symbol, das auf die physische Nähe von Barbara Goring, der Nichte von Lady Walpole-Wilson, hindeutete. Diese Assoziation der Vorstellungen war in der Tat so mächtig, dass ich selbst später, als ich schon seit Jahren nicht mehr Gast an der Tafel der Walpole-Wilsons war, nicht den Namen ›Kyros‹ hören konnte – ein, unter diesen Umständen, glücklicherweise im täglichen Leben seltenes Vorkommnis –, ohne an die Schmerzen früher Liebe erinnert zu werden; während zu der Zeit, über die ich schreibe, fast jedes Ölgemälde, das auch nur eine entfernt klassische Szene darstellte (wie man das gelegentlich auf Bildern in den Schaufenstern von Händlern um den St. James’s Palace herum sieht, die sich normalerweise auf Genremalerei spezialisiert haben), gewöhnlich die Tatsache in mein Bewusstsein zurückrief (falls sie aus irgendeinem unwahrscheinlichen Zufall vergessen war), dass ich Barbara seit längerer oder kürzerer Zeit nicht gesehen hatte.
Ich muss zu dieser Zeit etwa einundzwanzig oder zweiundzwanzig gewesen sein, und ich hatte damals eine ganze Reihe ziemlich wilder Vorstellungen von Frauen. Sie waren größtenteils das Resultat davon, dass ich viel gelesen hatte, ohne gleichzeitig die Gelegenheit zu haben, die aufgezeichneten Urteile anderer auf diesem Gebiet durch persönliche Erfahrungen einzuschränken – Urteile, die, wenn richtig interpretiert, in ihren Schlussfolgerungen oft ausgezeichnet sind, die aber praktisches Wissen erfordern, wenn man sich ihres vollen Wertes bewusst sein soll.
Von der Schule her kannte ich Tom Goring, der später in das Sechzigste Regiment eingetreten war. Wir hatten zwar nie viel miteinander zu tun gehabt, aber ich erinnerte mich an eine von Stringhams Geschichten, wie sie beide Geld zusammengeworfen hatten, um einen Pons zu Horaz – oder einem anderen lateinischen Autor, dessen Werke sie ins Englische übertragen mussten – zu kaufen, und wie sie dann deswegen Ärger bekamen, weil die eingereichte Übersetzung Stellen enthielt, die das offizielle Schulbuch ausgelassen hatte. Vielleicht trug die Tatsache, dass ihr älterer Bruder gleichzeitig mit mir auf der Schule gewesen war – der jüngere Sohn, David, ging noch zur Schule –, dazu bei, dass ich mit Barbara unmittelbar nach unserer ersten Begegnung auf gutem Fuße stand – obwohl das Problem, sich mit jungen Männern gut zu verstehen, ihr unter keinen Umständen ernsthafte Schwierigkeiten bereitete.
»Beeilen Sie sich, wenn Sie mich um einen Tanz bitten wollen«, hatte sie gesagt, als ihre Kusine, Eleanor Walpole-Wilson, uns einander vorgestellt hatte. »Ich kann nicht den ganzen Abend warten, bis Sie zu einem Entschluss kommen.«
Ich war, muss ich zugeben, auf der Stelle bezaubert von diesem Gebaren, das ich natürlich in keiner Weise als entmutigend empfand. Bei einer früheren Gelegenheit hatte eine würdige ältere Dame Barbara in meiner Gegenwart »diese etwas laute kleine Goring« genannt, und diese Bezeichnung traf zu. Sie war klein und dunkelhaarig und trug einen eckigen Bubikopf, der, wie andere Mädchen häufig beklagten, sich immer in hoffnungsloser Unordnung befand. Ihre Ruhelosigkeit war von jener trügerischen Art, die gewöhnlich eher auf einen grundlegenden Mangel hindeutet als auf einen Überfluss an Energie; doch kann ich nicht beanspruchen, damals entweder allgemein oder in speziellem Bezug auf Barbara selbst über diese Diagnose nachgesonnen zu haben. Das geschah erst viele Jahre später. Ich erinnere mich jedoch, dass ich mir, als wir uns eine (wie es mir schien) ziemlich lange Zeit später zufällig an einem Sonntagnachmittag im Hyde Park trafen, noch einen gewissen Sinn für die richtigen Maßstäbe ihr gegenüber bewahrt hatte, obwohl wir einander inzwischen häufig gesehen hatten. Sie wurde auf dem Spaziergang im Park an jenem Nachmittag von Eleanor Walpole-Wilson begleitet, die offensichtlich vom Schicksal dazu ausersehen war, Zeugin der verschiedenen Stadien unserer Beziehung zu sein. Ich hatte es nicht geschafft, an diesem Wochenende von London wegzukommen, und dass ich den beiden so zufällig und unerwartet begegnete, schien ein wundervoller Glücksfall. Das war für viele Monate der letzte Tag, an dem ich morgens aufwachte, ohne sofort an Barbara zu denken.
»Ach, wie herrlich, dass wir uns so treffen«, hatte sie gesagt.
Ich empfand sofort ein ungewöhnliches Hochgefühl über diese harmlose Bemerkung. Es war Juni, und am Tag zuvor hatte es geregnet, so dass das Gras frisch und üppig roch. Das Wetter war warm, aber nicht unangenehm heiß. Wir trafen uns fast genau an der Statue des Achilles. Zu dritt schlenderten wir dann auf die Kensington Gardens zu. Der Reitweg war leer. Die Gruppe der plastischen weißen und vergoldeten knotenförmigen Spitztürmchen des Albert Memorials, dem wir uns stetig näherten, sandte funkelndes Licht in alle Richtungen. Eleanor Walpole-Wilson, ein stämmiges, breitschultriges, überdurchschnittlich großes Mädchen, trug ihr geflochtenes Haar hinten am Kopf zu einem Knoten zusammengesteckt, der immer aussah, als wolle er jeden Augenblick herunterrutschen – und in der Tat fiel er auch manchmal auseinander. Sie hatte Sultan, einen Labradorhund, mitgebracht und versuchte, ihn mit schrillen Signalen aus einer Pfeife, die sie mit barschen, einsilbigen Rufen unterstützte, abzurichten. Dieses Unterfangen, das Abrichten Sultans, stand in völligem Einklang mit Eleanors üblichem Verhalten, denn sie betrug sich prinzipiell immer so, als ob London das offene Land sei – eine Willensanstrengung, in der sie nur selten nachließ.
Wir gingen die Stufen des Albert Memorials hinauf und inspizierten die Figuren der Künste und Wissenschaften, die in hohem Relief den zentralen Sockel des Denkmals umgeben. Eleanor, die weiterhin sporadisch ihre Pfeife blies, machte irgendeine Bemerkung über die Muskeln einer bärtigen Männerfigur, die zu der »Handwerker« genannten Gruppe gehört, worauf Barbara laut loslachte. Das war auf unserem Weg die Treppe auf der Südseite hinunter, in Richtung auf die Statuen, die Asien symbolisieren, wo, neben einem knienden Elefanten, der Beduine hockt, auf immer, in hoffnungsloser Betrachtung der Bäume und Sträucher in den Kensington Gardens, mit Augen in den geschwärzten Höhlen, die endlos über das reiche Blattwerk dieser Oasen seiner Fata Morgana gleiten.
Aus irgendeinem Grund schienen Eleanors Worte in diesem Moment immens komisch zu sein. Barbara stolperte und nahm für eine kurze Sekunde meinen Arm. Es geschah vielleicht in diesem Augenblick, dass eine Kraft freigesetzt wurde – eine Kraft, die keineswegs weniger mächtig war, weil ihre Wirkung etwas verspätet einsetzte. Gefühle dieser Art begreift man ja nicht immer sofort. Wir setzten uns für einige Zeit auf Stühle und spazierten dann zu der Nordseite des Parks, in Richtung auf das Haus der Budds am Sussex Square, wo die Mädchen zum Tee eingeladen waren. Als wir uns an den Toren verabschiedeten, überkam mich ein Gefühl unerklärlichen Verlustes, das in seiner Plötzlichkeit jener Hochstimmung bei unserer Begegnung zuvor ähnlich war. Der Rest des Tages schleppte sich dahin. Ein Gefühl der inneren Unruhe – von dem die Jugend so viel mehr heimgesucht wird als die längst Erwachsenen – befiel mich, und mit ihm kam eine fast unerträgliche nervöse Erschöpfung. Ich aß allein zu Abend und ging früh zu Bett.
Die – nicht sehr enge – Bekanntschaft meiner Eltern mit den Walpole-Wilsons datierte aus dem gleichen Zeitabschnitt der Friedenskonferenz, in dem wir im Louvre zufällig Mr. Deacon begegnet waren. Sir Gavin Walpole-Wilson hatte zu dieser Zeit auch in Paris gearbeitet. Er gehörte damals schon nicht mehr dem diplomatischen Dienst an, sondern hatte sich einer freiwilligen Hilfsorganisation – von fragwürdiger praktischer Bedeutung, wie mein Vater öfter bemerkte – angeschlossen, die sich der Unterstützung einer besonderen Gruppe von Flüchtlingen widmete. Sir Gavins Karriere war nämlich kurz nach Verleihung einer hohen Auszeichnung – seiner Ernennung zum ›Knight Commander of the Order of St. Michael and St. George‹ – zu einem plötzlichen Ende gekommen; er war Botschafter in einer südamerikanischen Republik gewesen. Es hatte Ärger im Zusammenhang mit der Entsendung einer Depesche gegeben. Die britische Regierung hatte, so stellte sich später heraus, bereits den Führer der Opposition anstelle der Junta, die zuvor für einige Jahre an der Macht gewesen war, als Staatsoberhaupt anerkannt. Man stimmte allgemein darin überein, dass, wenn es überhaupt ein Fehlverhalten darstellte, Sir Gavin sich keiner schlimmeren Sache schuldig gemacht hatte als der völlig korrekten Bemühung, sich mit beiden Seiten »gutzustellen«, zu der vielleicht eine gewisse geistige Schwerfälligkeit im Hinblick auf die mögliche Fehlbarkeit von Außenministern und auf die einige Zeit zuvor erkennbaren Veränderungen in der politischen Bedeutung von General Gomez hinzukam. Aber er hatte sich die Sache zu Herzen genommen und seinen Abschied eingereicht. Es mag sein, dass er diesen Schritt auf Druck von oben und unfreiwillig tat – ein Punkt, über den die Meinungen auseinandergingen.
Obwohl Sir Gavin keineswegs dazu neigte, seine persönliche Rolle, die er in den Kabinettsälen Europas, ja: der Welt, gespielt hatte, zu gering zu bewerten, gewann man bei ihm leicht den Eindruck, er sei ständig darauf bedacht, sich auch bei den unbedeutendsten Angelegenheiten zu rechtfertigen. Und so umgab ihn die Atmosphäre einer fast sicheren Gewissheit, vom Leben weniger großzügig behandelt worden zu sein, als es seine Talente verdienten – eine Atmosphäre, die ihn, obwohl er eine viel eindrucksvollere Persönlichkeit war, manchmal meinem Onkel Giles gleichen ließ. Zum Beispiel behauptete auch er gerne, dass er gesellschaftlichem Rang – zumindest im Gegensatz zu Fähigkeiten – wenig Bedeutung beimesse; und diese Auffassung teilte er mit meinem Onkel. Es ist auch möglich, dass Sir Gavin in der Zeit vor seiner Ehe von ähnlichen finanziellen Sorgen geplagt wurde, denn ich glaube, seine eigene Familie war alles andere als reich und hatte nur mit Mühe das Geld zusammenkratzen können, das damals notwendig war, um in den diplomatischen Dienst einzutreten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst – ich hatte ihn natürlich vorher nicht gekannt – trug er sein Haar ziemlich lang und bevorzugte lose sitzende Anzüge aus grobem Stoff. Die feste Überzeugung, dass alles immer eher schlecht ausgehe als gut, war eine weitere charakteristische Seite in Sir Gavins Haltung dem Leben gegenüber – ohne Zweifel durch seine eigenen schmerzlichen Enttäuschungen hervorgerufen. Ja, man konnte ihn nicht völlig von dem Verdacht freisprechen, dass es ihn freute, wenn das Schlimmste wirklich eintrat, und dass er Unheil von einer rein gesellschaftlichen Art manchmal fast absichtlich in die Wege leitete.
»Aus Gier zu wissen, was zu wissen uns nicht ansteht«, so rezitierte er gerne, »wähl’n wir die Gold’ne Straß’ nach Samarkand.«
Dieses Zitat mag seinem Geist vielleicht eine Erklärung für menschliches Unglück geboten haben, ließ sich aber wohl kaum auf seinen eigenen Fall anwenden, denn er war ein Mann von einzigartigem Mangel an intellektueller Neugier; und es wurde allgemein angenommen, dass jener unglückliche Schritt in seiner Karriere eher das Ergebnis zu großer Vorsicht gewesen war als einer Neigung, auf dem Gebiete jener moralischen oder faktischen Erkundungen zu experimentieren, auf welche die Zeilen anzuspielen scheinen. Ein solcher Charakterzug trat dagegen mehr bei seiner Frau zutage. Sie war eine der beiden Töchter von Lord Aberavon, einem damals schon verstorbenen Schiffsmagnaten, dem, wie ich später entdeckte, »Kyros als Knabe« gehört hatte. Mr. Deacons Bild blieb aus einem unerklärlichen Grund fast als einziges übrig, als nach dem Tod des Besitzers seine Sammlung von Gemälden, die nicht mehr im Einklang mit dem Geschmack einer späteren Generation standen, in ihrer Gesamtheit veräußert worden war. Lady Walpole-Wilson litt an ›Nerven‹, jedoch weniger bedrückend als ihre Schwester, Barbaras Mutter, die sich aus diesem Grunde sogar für eine Halbinvalidin hielt. Ich habe in der Tat weder Lady Goring noch ihren Mann kaum je zu Gesicht bekommen, denn wie seine Nichte Eleanor hielt sich Lord Goring, wenn irgend möglich, von London fern. Er galt als Experte auf dem Gebiet landwirtschaftlicher Kultivierungsmethoden und besaß eine Obstplantage, auf der er experimentierte und die, glaube ich, wegen ihrer gewagten Methoden ziemlich berühmt war.
Onkel Giles nannte Leute, die reicher oder ganz allgemein in einer besseren Lage waren als er und gegen die er sonst keinen besonders herabsetzenden Vorwurf erheben konnte, gerne »zweifellos mit guten Verbindungen gesegnet« – eine anschauliche Beschreibung, die er manchmal unterschiedslos anwandte; aber ich glaube, die Gorings wären so wohl wahrheitsgemäß charakterisiert gewesen. Sie mieteten immer ein Haus in der Upper Berkeley Street für den ersten Teil des Sommers, aber Abendgesellschaften fanden dort nur selten statt und waren in der Regel nicht gesellig. Der größte Teil der Verantwortung für Barbaras ›Saison‹ fiel auf ihre Tante, die wahrscheinlich die lebhafte Veranlagung ihrer Nichte eher als eine Erleichterung der durch ihre eigene Tochter verursachten Schwierigkeiten denn als eine zusätzliche Bürde für ihren Haushalt auffasste.
Lady Walpole-Wilson, für die ich eine entschiedene Zuneigung empfand, war eine große, dunkelhaarige, vornehm aussehende Frau mit Rehaugen, für deren Äußeres eine Ehe mit einem Vizekönig oder Botschafter der passende Rahmen zu sein schien. Ihre verhältnismäßige Unfähigkeit, die eigenen Abendgesellschaften, auf denen sie fast immer besonders verwirrt war, unter Kontrolle zu halten, erschien mir als eine Art stummer persönlicher Protest gegen die Umstände – in der Gestalt des Ausscheidens ihres Mannes aus dem diplomatischen Dienst –, die sie des Glanzes (wenn man das so nennen kann) dieser Position, den das Leben ihrer stattlichen Erscheinung eigentlich schuldete, beraubt hatten. Damals nämlich hegte ich noch äußerst romantische Ansichten – nicht nur von der Liebe, sondern auch von Dingen wie Politik und Regierung – und glaubte zum Beispiel, dass Verschrobenheit und Unfähigkeit in jenen Zirkeln völlig unbekannt seien, wo sie doch in Wirklichkeit – zumindest was die offiziellen Gesellschaften aller Länder betrifft – eher die Regel als die Ausnahme sein dürften. Heute aber verstehe ich, dass sich Lady Walpole-Wilson durch ihre frühere Erfahrung vielleicht bewusst war, dass Frauen hochgestellter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oft nicht fähig oder willens sind, angemessene Gastgeberinnen abzugeben – ein Bewusstsein, das zusammen mit ihrer angeborenen Schüchternheit sie manchmal den Eindruck erwecken ließ, dass sie am liebsten um jeden Preis aus ihrem eigenen Hause entkommen würde: nicht etwa, weil ihr das Erweisen von Gastlichkeit an sich im Geringsten unangenehm gewesen wäre, als vielmehr wegen der Erinnerungen an verletzte Gefühle in der Vergangenheit, als häufig etwas ›schiefgelaufen‹ war.
Zu diesen Empfindungen kam ohne Zweifel noch die sich selbst auferlegte Peinlichkeit hinzu, die zum Drum und Dran der Einführung einer Tochter – und, wenn man das ohne Unfreundlichkeit sagen kann, ›welch einer Tochter‹ – in eine widerspenstige Welt gehört; von dem Ringen mit rein hypothetischen Fragen wie dem ewig unlösbaren Rätsel, was andere Mütter wohl über die Art denken mochten, wie sie selbst, als Mutter, diese Sorgenlast trug, ganz zu schweigen. Bei dieser letzteren Kümmernis war Sir Gavins Einstellung oft keine große Hilfe, und es ist schwer zu sagen, ob sie beide wirklich glaubten, dass Eleanor, die immer mehr oder weniger problematisch gewesen war – es gab endlose Geschichten über Nasenbluten und Kopfschmerzen –, je einen Ehemann finden würde. Eleanor hatte schon immer eine Abneigung gegen weibliche Betätigungen gehegt. Als wir uns, bevor wir beide erwachsen waren, in Paris kennenlernten, hatte sie mir gesagt, dass sie in diesem Augenblick viel lieber bei ihren Cousins auf dem Lande in Oxfordshire wäre. Und diese Geisteshaltung gipfelte dann schließlich in ihrer Abscheu vor Bällen. Da ich sie schon vorher gekannt hatte, erschien mir dieser Widerwille nicht so seltsam wie vielen der jungen Männer, die ihr zum ersten Mal auf den Abendgesellschaften begegneten, wo sie kurz angebunden und mürrisch sein konnte. Barbara sagte oft: »Eleanor hätte nie in die Stadt geschafft werden sollen. Das ist Tierquälerei.« Und sie machte auch gerne die Bemerkung: »Eleanor ist gar kein so schlechter Kerl, wenn man sie näher kennt« – eine zweifellos wahre Feststellung; aber da das Leben sich zum großen Teil auf einer oberflächlichen Ebene abspielt, erleichterte diese ermutigende Möglichkeit – ob nun wahr oder falsch – kaum die Last ihrer Partner.
Die Walpole-Wilsons legten also nicht nur die Grundlage, sondern ihr Haus war häufig auch die unmittelbare Örtlichkeit meiner Beziehung zu Barbara, die ich, nach unserem gemeinsamen Spaziergang in dem Park, ziemlich häufig auf Bällen traf. Manchmal gingen wir sogar zusammen ins Kino oder zu einer Nachmittagsvorstellung ins Theater. Das war im Sommer; und als sie vor Weihnachten für wenige Wochen nach London kam, trafen wir uns wieder. Bis dann im darauffolgenden Mai die neue Saison begann, fragte ich mich, wie die Situation entschieden werden könne. Jene kleinen Handgemenge, die manchmal während der verhältnismäßig seltenen Gelegenheiten, bei denen wir allein waren, zwischen uns stattfanden, wurden von ihr nicht gerade ermutigt; ja, sie schien meine gelegentlichen Attacken nur zu mögen, weil es ihr Vergnügen bereitete, sie zurückzuweisen. Jedenfalls brachten solche Angriffe keinen von uns irgendwie weiter. Sie liebte Neckereien, aber Neckereien und sonst nichts blieben diese Geplänkel auch. »Werd nur nicht sentimental«, sagte sie immer; und was tiefere Gefühle anging, so schien ihr Wunsch, sie zu vermeiden, ebenso echt wie ihr Ausweichen vor der Sentimentalität.
Diese Geschichte mit Barbara schien, obwohl sie weniger als ein Jahr währte, schon einen beträchtlichen Teil meines Lebens in Anspruch zu nehmen. Nichts nämlich bestimmt so sehr die Zeitlosigkeit der Zeit wie jene Episoden unserer frühen Erfahrung, die wir bei einer Rückschau von einem späteren Lebensabschnitt aus zu einer solch unglaublichen Dichte zusammengedrängt sehen und die uns doch, während der Monate, in denen wir sie wirklich durchleben, die Illusion vermitteln, sich endlos hinzuziehen. Meine Geistesverfassung – vielleicht sollte ich sagen: der Zustand meines Herzens – blieb unverändert; und Bälle erschienen mir freudlos, wenn Barbara nicht anwesend war. Während dieses Sommers entwickelte »Kyros als Knabe« seine mystische Bedeutung, indem es, wenn ich bei meiner Ankunft dort vor ihm stand, die Chance von zwei zu eins symbolisierte, dass ich Barbara beim Abendessen sehen würde. Wenn wir beide bei den Walpole-Wilsons speisten, hatte ich sie wenigstens unter meinen Augen. Sie selbst war sich nie der sentimentalen Bedeutung bewusst, die Mr. Deacons Bild angenommen hatte. Als ich sie zuerst auf das Gemälde ansprach, dauerte es lange, bis sie wusste, wovon ich redete; und als wir uns einmal beide zur gleichen Zeit in der Eingangshalle aufhielten und ich ihr zeigte, wo es hing, versicherte sie mir, dass sie vorher seine Existenz nicht bemerkt habe. Eleanor nahm zu diesem Thema eine ebenso unbestimmte Haltung ein.
»Gehen die baden?«, hatte sie gefragt. »Ich mag es nicht.«
Diese Möglichkeit, für bestimmte Stunden zu wissen, wo Barbara sich aufhielt, brachte mir wenigstens für die begrenzte Zeit Erleichterung von der Pein der Unwissenheit hinsichtlich ihres Tuns und Treibens und der sich daraus ergebenden Unfähigkeit, auch nur ein geringes Maß an Kontrolle über sie auszuüben; denn Liebe dieser Art – Liebe, in der das sinnliche Element zu einem Minimum reduziert ist – muss sich wohl, wenn nicht völlig, so doch zu einem großen Teil, in ein Verlangen nach Ausübung von Macht verwandeln: eine Tatsache, derer sich Barbara natürlich besser bewusst war als ich.
Diese Qualen zogen sich, wie gesagt, über eine Reihe von Monaten hin, und sie waren manchmal von großer Heftigkeit; aber dann rief mich Barbara an einem Nachmittag, als ich gerade Korrekturfahnen las, im Büro an und fragte mich, ob ich an diesem Tag vor dem Ball der Huntercombes bei ihnen am Eaton Square zu Abend essen wolle. Ich entschloss mich sofort, Short, einem Bekannten aus meiner Studienzeit, der jetzt in einem Ministerium arbeitete und mit dem ich mich am Anfang der Woche verabredet hatte, abzusagen, und ich versprach ihr zu kommen. Ich hatte das übliche Gefühl der Erregung verspürt, während ich mit ihr am Telefon sprach; aber als ich den Hörer einhängte und dabei dachte, dass ich Short an diesem Abend vielleicht ein wenig rücksichtslos versetzte, stieg in mir plötzlich die Frage auf, ob ich noch verliebt sei. Barbaras Stimme hatte so herrisch geklungen, und es war klar, dass ihr jemand im letzten Augenblick abgesagt hatte. Daran war natürlich nichts, was man vernünftigerweise übelnehmen konnte. Schließlich durfte ich ja wohl nicht erwarten, an jedem Abend unseres Lebens beim Essen neben ihr zu sitzen – außer wir wären verheiratet, und vielleicht nicht einmal dann. Und doch schien mein Herz um eine Spur leichter. Ließ das Fieber jetzt nach? Ich selbst war mir noch kaum bewusst, dass es schwächer wurde. Ich kannte Barnby damals noch nicht und hatte noch keine Gelegenheit gehabt, über seine Lieblingsmaxime nachzudenken: »Eine Frau überspannt immer den Bogen.«
Ich hatte im Verlauf der Zeit natürlich oft über das Problem Liebe nachgegrübelt. Barbara stellte nicht die erste Attacke dar. Es hatte zum Beispiel Peter Templers Schwester Jean gegeben und Madame Leroys Nichte Suzette; aber Jean und Suzette schienen nun bloß schwache – wenn auch angenehme – Erinnerungen, und ich fühlte mich jetzt – ohne einen besonderen Grund – reifer in meiner Haltung diesen Dingen gegenüber. Andererseits gab es sicher nur wenig Anlass, mit der Art zu prahlen, wie ich das Problem Barbara anging. Ich konnte mir nicht einmal klar darüber werden, ob ich sie – falls das überhaupt durchführbar gewesen wäre – wirklich zu heiraten wünschte. Die Ehe schien mir etwas Fernes und Gefährliches, mit dem mein Verlangen nach Barbara keine oder nur eine geringe Verbindung hatte. Sie schien nur zu existieren, um meine Ruhe zu stören: Ich konnte sie weder durch erlaubte noch durch unerlaubte Mittel besitzen; sie war aus Träumen gemacht, doch nur durch die Realität zu erobern. Das jedenfalls war der Rahmen, in dem sich meine Gedanken über sie bewegten, als ich an jenem Abend zum Hause der Walpole-Wilsons kam.
Taxis fuhren in der Abendsonne vor mehreren der Häuser am Eaton Square vor, und junge Männer in Fräcken und Mädchen in Abendkleidern, eher ein wenig schüchtern aussehend in dem hellen Licht, bezahlten die Fahrten oder zogen die Klingeln an den Haustüren. Es herrschte jenes bewegungslose Londoner Wetter, kein Lufthauch war zu spüren. Man hätte fast in den Tropen sein können. Selbst Archie Gilbert, der unmittelbar vor mir die Eingangshalle betrat – niemand hatte je erlebt, dass er zu spät zu einem Dinner gekommen wäre –, sah an diesem Abend aus, als leide er vielleicht ein wenig unter der Hitze. Sein fast unsichtbarer blonder Schnurrbart schien aus dem gleichen Pikee-Material gemacht zu sein wie sein Frackhemd; und wie gewöhnlich strahlte er eine ganz unnatürliche Reinlichkeit aus, so als seien in Vorbereitung auf die Abendgesellschaft sowohl er als auch seine Kleidung einem geheimen chemischen Prozess unterzogen worden, der die blendende Hülle seines Körpers nachtschwarz und silbern anstatt bloß schwarz und weiß gemacht hatte, gefeit gegen Schmutz und Staub. Hemd, Kragen, Schleife, Weste, Taschentuch und Handschuhe waren wie Schnee, und wie immer schien es, als trüge er all diese Dinge zum ersten Mal. Selbst er jedoch war wegen der drückend heißen klimatischen Umstände eine Spur rötlicher im Gesicht als gewöhnlich.