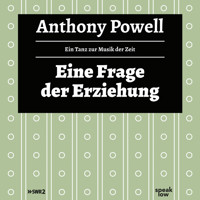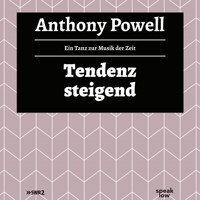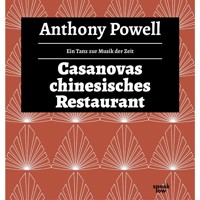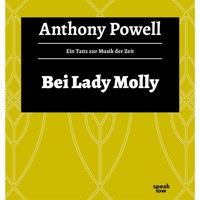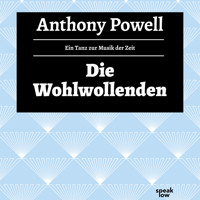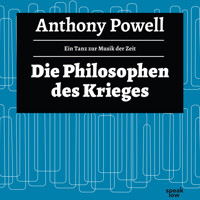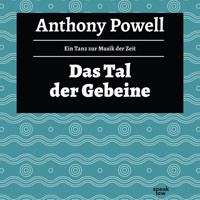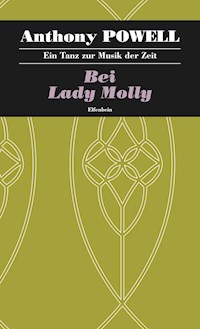Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Tanz zur Musik der Zeit
- Sprache: Deutsch
Der zwölfbändige Zyklus »Ein Tanz zur Musik der Zeit« — aufgrund seiner inhaltlichen wie formalen Gestaltung immer wieder mit Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« verglichen — gilt als das Hauptwerk des britischen Schriftstellers Anthony Powell und gehört zu den bedeutendsten Romanwerken des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von dem gleichnamigen Bild des französischen Barockmalers Nicolas Poussin, zeichnet der Zyklus ein facettenreiches Bild der englischen Upperclass vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten sechziger Jahre. Aus der Perspektive des mit typisch britischem Humor und Understatement ausgestatteten Ich-Erzählers Jenkins — der durch so manche biografische Parallele wie Powells Alter Ego anmutet — bietet der »Tanz« eine Fülle von Figuren, Ereignissen, Beobachtungen und Erinnerungen, die einen einzigartigen und aufschlussreichen Einblick geben in die Gedankenwelt der in England nach wie vor tonangebenden Gesellschaftsschicht mit ihren durchaus merkwürdigen Lebensgewohnheiten. Geheimnisvolle spiritistische Sitzungen und Dinnerpartys kennzeichnen den dritten Band. Der historische Hintergrund scheint dabei immer wieder überraschend schlaglichtartig auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Powell
Die Welt des Wechsels
Roman
Ein Tanz zur Musik der Zeit –Band 3
Aus dem Englischen übersetzt von Heinz Feldmann
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1955 unter dem Titel
»The Acceptance World« bei William Heinemann, London.
Band 3 des Romanzyklus »A Dance to the Music of Time«
The Acceptance World
©John Powell and Tristram Powell, 1955
© 2015 / 2016 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-78-7 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-38-1 (Druckausgabe)
1
Von Zeit zu Zeit, vielleicht in Abständen von achtzehn Monaten, erreichte mich eine Postkarte in Onkel Giles’ klarer, enger Handschrift, die mich für den Sonntagnachmittag zum Tee im Ufford einlud. Diese Hotelpension in Bayswater, wo er während seiner verhältnismäßig seltenen Besuche in London immer wohnte, bestand aus zwei Eckhäusern in einem versteckten, fast unzugänglichen Gebiet westlich der Queen’s Road. Nicht nur die schlachtschiffgraue Farbe des Gebäudes, sondern auch etwas Winkliges und gleichzeitig Kopflastiges in seiner Gestaltung insgesamt legte den Gedanken an ein großes, in der Straße vertäutes Schiff nahe. Auch in seinem Inneren, wenigstens im Erdgeschoss, erinnerte das Ufford ein wenig an das Leben auf See – allerdings nicht an einen luxuriös ausgestatteten Ozeandampfer, sondern bestenfalls an einen jener altersschwachen Schoner in den Romanen von Joseph Conrad: vor Jahren vielleicht aufgeputzt als die Yacht eines reichen Mannes, doch jetzt schäbig geworden durch die Zeit und degradiert zu niedrigeren Aufgaben wie der Beförderung von Touristen oder Pilgern oder gar illegalen Einwanderern; durchdrungen – um eine angemessene Conrad’sche Wendung zu gebrauchen – von unbehaglichen Erinnerungen an die Mühen und Konflikte der Menschen. Das war das Gefühl, das einem das Ufford gab, wie es dort vor Anker lag in dem trägen Gezeitenstrom Bayswaters.
Ohne Zweifel hatte Onkel Giles zu diesem letzteren, nach rückwärts gerichteten und entschieden bedrückenden Wesenszug des Hotels in einem geringen Maße selbst beigetragen. Sicherlich aber hatte er nichts getan, um das Haus von der Atmosphäre geheimer, melancholischer Schuld zu befreien. Die Korridore erschienen wie die Katakomben einer Hölle, bestimmt für das unterdrückte Bedauern all jener, denen im Leben das Einkommen gefehlt hatte, auf das sie selbst einen Anspruch zu haben meinten; und diesen leisen Verdacht, dass die beiden Häuser eine Heimstatt der Toten seien, verstärkte noch die Tatsache, dass man dort nie einen Menschen erblickte, nicht einmal an der Rezeption. Die Stockwerke der ehemals getrennten Gebäude lagen jeweils auf verschiedenen Höhen, waren aber jetzt durch unerwartete Stufen und enge, steil ansteigende Korridore miteinander verbunden. Die Eingangshalle war stets in Schweigen gehüllt; die Briefe hinter den sie überkreuzenden Bändern an dem mit grünem Fries bespannten Brett gilbten dahin, nie abgeholt, auf immer ungelesen, unverändert.
Onkel Giles selbst aber hing an diesem Quartier. »Der alte Kasten ist gerade das Richtige für mich«, hatte ich ihn einmal leise murmeln hören – eine große Anerkennung seitens eines Mannes, der so sparsam mit Lob umging wie er; doch wie jede andere Institution, mit der er in Berührung kam, fiel natürlich auch das Ufford bei ihm von Zeit zu Zeit in Ungnade, gewöhnlich, weil ihm die Geschäftsleitung oder das Personal irgendeine ›Grobheit‹ angetan hatte. Vera, zum Beispiel, eine Kellnerin, war eine alte Feindin von ihm, die oft versuchte, ihm seinen Lieblingstisch nahe der Tür zu verweigern, »wo man etwas frische Luft atmen« konnte. Wenigstens einmal, in einem Anfall von Verärgerung, hatte er sich im De Tabley auf der anderen Seite der Straße einquartiert. Aber früher oder später kehrte er immer wieder zum Ufford zurück, widerwillig eingestehend, dass dieses Hotel, obwohl es mit ihm seit den Tagen, als er es kennengelernt hatte, ständig bergab ginge, ohne Zweifel praktisch sei für die Zwecke seines ziellosen, unbehaglichen, doch in einem gewissen Sinne auch konzentrierten Lebens.
Konzentriert, so könnte man fragen, auf was? Das wäre nicht leicht zu beantworten. Konzentriert vielleicht auf seine Selbstbezogenheit, auf seine Entschlossenheit, völlig anders zu sein als jeder andere Mensch – ohne aber das dazu angemessene moralische und intellektuelle Rüstzeug zu besitzen. Darin mochte eine Erklärung für sein Verhalten liegen. Wie auch immer, er wurde von einer Macht umhergetrieben, die stärker schien als der bloße Instinkt, sich am Leben zu erhalten; und das Ufford kam dem, was er als ein Zuhause anerkannte, am nächsten. Oft ließ er wochen-, monate-, sogar jahrelang sein Gepäck dort zurück, beschwerte sich aber später, wenn er es auspackte, darüber, dass ein Smoking nicht nur zerknittert, sondern auch von Motten zerfressen sei; dass Öl in seinen Reisekorb hatte eindringen können und dort seine Tropenkleidung ruiniert habe; dass, noch schlimmer – obwohl verlässliche Beweise stets fehlten –, die Anzahl der Gepäckstücke, die er dem Hotel in Verwahrung gegeben hatte, um wenigstens eine Leinwandtasche oder eine lederne Hutschachtel oder einen Uniform-Koffer aus schwarzem Blech vermindert sei.
Bei den meisten meiner Besuche im Ufford waren Halle und Empfangsräume so völlig verlassen, dass es im Innern fast Onkel Giles’ Privatresidenz hätte sein können. Wäre er ein reicher Junggeselle gewesen und nicht ein armer, hätte er wahrscheinlich in einem Haus gelebt, das diesem genau entsprach: spärlich eingerichtet, unpersönlich, altmodisch, zugig, mit schweren Mahagonischränken und Sideboards in weiten Abständen über die Korridore und Treppenabsätze verteilt: nichts, was ihn vielleicht auf irgendeine besondere Meinung hätte festlegen können – außer einer allgemeinen Missbilligung der Art und Weise, wie die Welt regiert wurde.
Wir nahmen den Tee immer in einem Raum ein, der ›die Lounge‹ hieß: die hintere Hälfte eines großen Doppelsalons, dessen Verbindungstüren permanent geschlossen blieben und so ›die Lounge‹ von dem ›Schreibzimmer‹, der anderen Hälfte, die zur Straße hin lag, abtrennte. (Vielleicht waren diese Türen, wie die Tore des Janustempels, nur in Friedenszeiten geschlossen, denn Jahre später, als ich das Ufford während des Krieges sah, standen sie weit offen.) Die mit Spitzengardinen behangenen Fenster der Lounge gingen auf einen Lichtschacht hinaus: ein trostloser Ausblick voll der düsteren Schwermut dauernder Nacht oder eines auf ewig regendunklen Himmels. Selbst im Sommer brauchte man elektrisches Licht beim Tee.
Das in Blau, Grau und Grün gehaltene verschlungene Blumendessin der Tapete führte von einem cremefarbenen Linkrustasockel hoch zu einem Sims aus ebenfalls cremefarbener Linkrusta. Das unendlich verblichene Muster der Blumen entsprach genau dem der Chintzbezüge des Sofas und der Sessel, die geräumig und unerwartet bequem waren. In einer Ecke stand eine Palme in einem Messingtopf mit verzierten Griffen. Kleine Tische in maurischem Stil waren über den Raum verteilt. Auf ihnen standen große, runde Aschenbecher mit Vorrichtungen, auf denen man eine Zigarre oder Zigarette ablegen konnte. An den Wänden hingen mehrere vergoldete runde Spiegel, aber es gab dort nur ein einziges Bild, einen Stich nach Sir Edwin Landseers »Die Abtei von Bolton in alter Zeit«, das über dem offenen Kamin hing. Unter dieser dichtgedrängten Szene mittelalterlicher Fülle – die einen schmerzlichen Kontrast bildete zu der cuisine des Ufford – zeigte eine Uhr, deren Pendel und Werk unter ihrer Glaskuppel sichtbar waren, für immer auf zwanzig Minuten nach fünf. Im Winter hielten zwei Heizkörper den Raum annehmbar warm, und die von rosa Kreppapier umgebene Kohle in dem Kamin wurde nie entzündet. Es gab kein einziges Zeichen aktiven Lebens in dem Zimmer, außer vielleicht mehreren zerlesenen Exemplaren der Zeitschrift »Die Dame«, die in einem Stapel auf einem der maurischen Tische lagen.
»Ich glaube, wir werden das Zimmer ganz für uns allein haben«, pflegte Onkel Giles stets zu sagen, so als seien wir dort zufälligerweise an einem besonders glücklichen Tag hingekommen. »Wir werden uns also ohne Störungen über unsere Angelegenheiten unterhalten können. Ich hasse nichts so sehr, wie wenn irgend so ein verdammter Kerl jedes Wort mithört, das ich sage.«
In den letzten Jahren hatten sich seine Verhältnisse, soweit seine Verwandten irgendetwas von ihnen wussten, in gewisser Weise stabilisiert, obwohl Einladungen zum Tee gewöhnlich mit seinen periodischen Anstrengungen zusammenfielen, ein wenig mehr als seinen vereinbarten Anteil aus der ›Stiftung‹ herauszuholen. Entweder ging er jetzt ruhigere Wege als zuvor, oder die Krisen fanden in längeren Abständen statt und waren offensichtlich weniger heftig. Dieser Wandel bedeutete nicht, dass er das Leben selbst in einer versöhnlicheren Haltung anging oder dass er die Überzeugung aufgegeben hätte, weltlicher Erfolg sei eine Frage von ›Beziehungen‹. Englands Aufgabe des Goldstandards zu etwa dieser Zeit – und die Bildung der Allparteienregierung – hatten ihn besonders verärgert. Er vertrat ganz gegensätzliche, weit revolutionärere ökonomische Theorien zu der Frage, wie die europäische monetäre Situation geregelt werden sollte.
In seinem persönlichen Umgang war er jedoch eine Spur weniger schroff. Die Besorgnis seiner Verwandten, er könne eines Tages in wirklich ernsthafte finanzielle Verwicklungen geraten, hatte, obwohl sie sich nie völlig legte, im Vergleich zur Vergangenheit beträchtlich abgenommen. Es hatte auch in der letzten Zeit keine dieser früher stets wiederkehrenden Gerüchte gegeben, er treffe Vorbereitungen für eine unpassende Heirat. Er trieb sich immer noch in der weiteren Umgebung Londons herum und war in Abständen in Reading, Aylesbury, Chelmsford oder Dover – und einmal an einem so weit entfernten Ort wie den Kanalinseln – gesehen worden; seine ›Arbeit‹ stand jetzt in Verbindung mit der Administration einer karitativen Hilfsorganisation, die ihm ein kleines Gehalt zahlte und ein annehmbar hohes Spesenkonto einräumte.
Angesichts einer Begegnung während einer meiner Besuche im Ufford war ich mir jedoch nicht sicher, dass Onkel Giles, obwohl er inzwischen etwa Anfang sechzig war, wirklich jede Absicht zu heiraten völlig aufgegeben hatte. Es gab da Umstände, die auf sein anhaltendes Interesse an einem solchen Plan hindeuteten oder die zumindest vermuten ließen, dass er immer noch gern mit dem Gedanken an eine Ehe spielte, wenn er sich in der Gesellschaft einer Vertreterin des anderen Geschlechts befand.
Bei dieser besonderen Gelegenheit – ich hatte die drei Fischpasten-Sandwiches und das Stück Gewürzkuchen bereits vertilgt – war unser Gespräch gerade im Begriffe gewesen, sich den Geldfragen zuzuwenden. Onkel Giles selbst nahm nie den Nachmittagstee ein, doch pflegte er, wenn serviert war, gewöhnlich den Deckel der Kanne hochzuheben und zu bemerken: »Einen schönen starken Tee hat man dir da gebracht«, ließ aber den Topf manchmal wieder in die Küche zurückgehen, wenn ihm irgendetwas auf der Oberfläche des Getränks besonders missfiel. Er hatte sich, als eine Einleitung zu der Diskussion über die Finanzen, gerade einige Male die Nase geschneuzt, als sich die Tür der Lounge leise öffnete und eine Dame still in das Zimmer trat.
Sie war zwischen vierzig und fünfzig, vielleicht näher an der Fünfzig, obwohl – in einer Zeit, als es als modern galt, dünn zu sein – ihr voller Busen und der Stil ihres Kleides sie vielleicht einige Jahre älter erscheinen ließen, als sie in Wirklichkeit war. Ihr dunkelrotes Haar, das sie in einer, wie mir schien, altmodischen Frisur hoch aufgetürmt trug, und ihre guten, seltsam verschwommenen Züge, aus denen immens große, verschleierte, haselnussbraune Augen schauten, machten sie zu einer eindrucksvollen Erscheinung. Auch ihre Bewegungen waren ungewöhnlich. Sie schien mehr über den Teppich zu gleiten, als zu gehen, und gab einem fast den Eindruck, sie sei ein Phantom, ein Wesen aus einer anderen Welt. Diese Illusion wurde zweifellos noch verstärkt durch die geheimnisvolle, düstere ambience des Ufford und durch die Tatsache, dass ich außer Onkel Giles selbst oder einem gelegentlichen Mitglied des Personals zuvor kaum jemanden in den Räumen des Hotels erblickt hatte.
»Aber Myra«, sagte Onkel Giles, sich hastig erhebend und das abgetragene Fischgrätenmuster seiner Tweedhose glattstreichend, »ich meinte, Sie hätten gesagt, Sie würden den ganzen Tag aus sein.«
Er klang, als ob er sich insgesamt freute, sie zu sehen, schien jedoch vielleicht ein wenig aus der Fassung gebracht, dass sie gerade in diesem Moment auftauchte. Sonst hatte er nur ganz sporadisch und, nach angemessener Vorwarnung, für ein paar Minuten, nie länger, einen gelegentlichen männlichen Bekannten mitgebracht: gewöhnlich einen älteren Mann, wahrscheinlich ein pensionierter Buchhalter, von dem er sagte, er besäße »einen sehr guten Kopf für Geschäfte«; aber nie zuvor hatte ich ihn in der Gesellschaft einer Frau gesehen, die nicht Mitglied der Familie war. Wie gewöhnlich, so verdeckte wohl auch jetzt sein übliches Gebaren kaum unterdrückter Verärgerung nahezu kosmischen Ausmaßes eine etwaige kleinere Gefühlsaufwallung. Dennoch, schwache rote Flecken, etwas sehr Seltenes bei ihm, zeigten sich einen Moment lang auf seinen Wangen, verschwanden aber fast sogleich wieder, als er, so als wisse er nicht recht, wie er die Situation am besten angehen solle, mit einer mageren, welken Hand seinen Schnurrbart betastete.
»Das ist mein Neffe Nicholas«, sagte er; und an mich gewandt: »Ich glaube nicht, dass du Mrs. Erdleigh schon begegnet bist.«
Er sprach langsam, so als habe er mich nach langem Nachdenken aus einer immens großen Zahl anderer Neffen ausgewählt, um ihr wenigstens ein gutes Beispiel dafür vorzuführen, was er hinsichtlich seiner Verwandten zu ertragen gezwungen sei. Mrs. Erdleigh sah mich einige Sekunden lang fest an, ehe sie meine Hand ergriff, die sie auch noch weiter umschlossen hielt, als ich den leisen Versuch machte, meinen eigenen Griff zu lockern. Ihre Handfläche war weich und warm und schien ein geheimnisvolles Beben auszustrahlen. Das Parfüm, in dem etwas undefinierbar Orientalisches mitschwang, schlug in großen, atembeklemmenden Wellen zu mir herüber. Ihre riesigen, feucht schimmernden Augen schienen in die Tiefen meiner Seele zu blicken und weit, weit darüber hinaus auf die namenlosen unerforschten Perspektiven des Unendlichen.
»Aber er gehört zu einer anderen Ordnung«, stellte sie sofort fest.
Sie sagte das ohne Erstaunen und offensichtlich mit großer Entschiedenheit, ja so, als sei diese Feststellung die logische Schlussfolgerung aus dem längeren Kontakt unserer Hände. gewesen. Gleichzeitig wandte sie ihren Kopf zu Onkel Giles, der in seiner Kehle einen missbilligenden Laut erzeugte, ohne jedoch eine Bestätigung oder Ablehnung ihrer Hypothese vorzubringen. Es war augenscheinlich, dass sie in ihrer Vorstellung, oder wohl besser gesagt: in ihrem inneren Bewusstsein, ihn und mich in einem heftigen Gegensatz zueinander stehen sah. Ob sie sich dabei auf einen unbestimmten Unterschied der sozialen Klasse oder des Verhaltens bezog oder ob die Unterscheidung unsere moralischen Maßstabe betraf, war völlig unklar. Und ich wusste ebensowenig, ob der Vergleich zu meinen eigenen oder zu meines Onkels Gunsten ausfiel. Wie auch immer, ich musste unwillkürlich denken, dass ihre Behauptung, so wahr sie auch sein mochte, als ein Eröffnungszug nach einer Bekanntmachung unpassend sei.
Ich hatte fast erwartet, dass Onkel Giles an ihren Worten Anstoß nehmen würde, aber er schien ganz im Gegenteil überhaupt nicht verärgert oder erstaunt; ihre Anwesenheit war ihm offenbar nun angenehmer als vorher. Es war beinahe so, als wisse er jetzt, dass das Schlimmste vorüber sei, dass sich von nun an die Beziehungen zwischen uns dreien unbefangener entwickeln würden.
»Soll ich schellen und um mehr Tee bitten?«, fragte er, ohne diesem Vorschlag durch den Ton seiner Stimme die geringste Dringlichkeit zu verleihen.
Mrs. Erdleigh schüttelte verträumt den Kopf. Sie hatte neben mir auf dem Sofa Platz genommen.
»Ich hatte bereits Tee«, sagte sie leise, als sei diese Mahlzeit für sie ein in der Tat wundervolles Erlebnis gewesen.
»Wirklich?«, fragte mein Onkel in einem zweifelnden Ton und bekräftigte durch seine Gesten, dass er ein solches Phänomen für fast unglaublich hielt.
»Bestimmt.«
»Gut, dann schelle ich nicht.«
»Bitte nicht, Captain Jenkins.«
Ich hatte den Eindruck dass die beiden einander recht gut kannten, sicherlich aber weit besser, als sie bereit waren, in diesem Augenblick vor mir zuzugeben. Nach der ersten Überraschung über ihr Auftauchen nannte Onkel Giles Mrs. Erdleigh nicht länger ›Myra‹, und er machte nun eine Reihe unverbundener konventioneller Bemerkungen, so als wolle er zeigen, wie formell ihre Beziehung in Wirklichkeit sei. Er erklärte zum hundertsten Mal, dass er nie den Nachmittagstee einnehme, wie sehr er auch von denen ermuntert würde, die dieser Gewohnheit verfallen seien; gab einige unzusammenhängende Kommentare zum Wetter und beschrieb ihr in großen Zügen einige der äußeren Umstände meines Lebens und meiner beruflichen Beschäftigung.
»Kunstbücher, nicht wahr?«, sagte er. »Das ist es doch, was deine Firma verlegt, oder?«
»Richtig.«
»Er verkauft Kunstbücher«, sagte Onkel Giles, als erkläre er einem Besucher die seltsamen Gewohnheiten der Ureinwohner des Landes, in dem er sich niedergelassen hat.
»Und auch andere Arten von Büchern«, fügte ich hinzu, denn wie er das gesagt hatte, klang es, als sei das Verlegen von Kunstbüchern ein schimpflicher Beruf.
Ich wandte mich mit dieser Antwort an Mrs. Erdleigh: ein wenig so, wie ein vom Staatsanwalt ins Kreuzverhör genommener Zeuge seine Erwiderungen zum Richter hin spricht. Sie schien diese Trivialitäten kaum in sich aufzunehmen, lächelte jedoch die ganze Zeit still, fast verzückt, so als genieße sie gerade ein warmes Bad nach einem anstrengenden Einkaufstag. Ich bemerkte, dass sie keinen Ehering trug; an seiner Stelle steckte an ihrem Ringfinger ein großer Opal, den eine Schlange aus gediegenem Gold umschloss, die ihren eigenen Schwanz verschluckte.
»Ich sehe, Sie wundern sich über meinen Opal«, sagte sie, als sie plötzlich wahrnahm, wohin ich sah.
»Ich hab den Ring bewundert.«
»Ich bin natürlich im Oktober geboren.«
»Sonst brächte er Unglück?«
»Aber nicht, wenn man eine Waage ist.«
»Ich bin ein Schütze.«
Ich hatte diese Tatsache ein oder zwei Wochen zuvor aus der astrologischen Kolumne einer Sonntagszeitung erfahren, und dies schien mir ein guter Moment, mein Wissen anzuwenden. Mrs. Erdleigh freute sich offensichtlich selbst über dieses Körnchen esoterischen Verständnisses. Sie nahm wieder meine Hand und hielt die offene Innenfläche gegen das Licht.
»Sie interessieren mich«, sagte sie.
»Was sehen Sie?«
»Viele Dinge.«
»Angenehme?«
»Einige gute, einige weniger gute.«
»Sagen Sie sie mir.«
»Soll ich?«
Onkel Giles rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her. Zuerst dachte ich, er langweile sich, denn das Gespräch lief für einen Moment an ihm vorbei. In seiner zurückhaltenden, unaufdringlichen Art konnte er es nämlich nie ertragen, nicht im Mittelpunkt des Interesses zu stehen – selbst wenn diese Position vielleicht etwas für ihn Unangenehmes bedeutete, wie das manchmal bei Zusammenkünften unserer Familie der Fall war. Jetzt jedoch hatte er etwas anderes im Sinn.
»Warum legen Sie nicht Karten?«, platzte er plötzlich mit gewollter Fröhlichkeit heraus. »Das heißt, wenn Sie dazu in der Stimmung sind.«
Mrs. Erdleigh reagierte nicht sogleich auf diesen Vorschlag. Sie lächelte weiter und fuhr fort mit der Untersuchung der Linien meiner Hand.
»Soll ich?«, sagte sie wieder leise, fast zu sich selbst. »Soll ich die Karten über Sie beide befragen?«
Ich schloss mich der Bitte meines Onkels an. Sich die Zukunft voraussagen zu lassen befriedigt ja schließlich die meisten der oberflächlichen Forderungen unseres Egoismus. Die ewig währende Beliebtheit der Wahrsagerei hat nichts Geheimnisvolles. Dennoch, es erstaunte mich, dass Onkel Giles ein solches Treiben billigte. Ich war mir sicher, er hätte seine laute Verachtung zum Ausdruck gebracht, wenn man ihm von irgendjemand anderem berichtet hätte, er lasse sich gern die Zukunft voraussagen. Mrs. Erdleigh dachte einige Sekunden nach, stand dann, immer noch lächelnd, auf und glitt davon. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, saßen wir einige Minuten lang schweigend da. Onkel Giles grunzte mehrere Male. Ich vermutete, er schämte sich vielleicht dafür, diese Bitte an sie gerichtet zu haben. Ich erkundigte mich über seine Freundin.
»Myra Erdleigh?«, sagte er, als sei es sonderbar, jemandem zu begegnen, dem die Lebensumstände von Mrs. Erdleigh nicht vertraut waren. »Sie ist Witwe, natürlich. Ihr Mann hatte irgendeine Stellung im Fernen Osten. Beim chinesischen Zoll, glaube ich, oder bei der Polizei in Birma. Etwas dieser Art.«
»Und sie wohnt hier?«
»Sie ist eine wundervolle Wahrsagerin«, sagte Onkel Giles, die letzte Frage überhörend. »Wirklich wundervoll. Ich lass mir von ihr hin und wieder die Karten legen. Es macht ihr Freude, weißt du, und es interessiert mich zu sehen, wie oft sie Recht behält. Nicht dass ich erwartete, sie werde mir viel zu versprechen haben, bei meinem Alter.«
Er seufzte, jedoch, so dachte ich, nicht ohne eine gewisse Selbstzufriedenheit. Ich fragte mich, wie lange die beiden einander wohl schon kannten. Offensichtlich schon so lange, dass das Thema der Wahrsagerei häufig zwischen ihnen aufgetaucht war.
»Übt sie das Wahrsagen professionell aus?«
»Das hat sie, glaube ich, in der Vergangenheit getan«, gab Onkel Giles zu. »Aber natürlich besteht nicht die geringste Gefahr, dass wir heute Abend fünf Guineen Honorar für die Sitzung bezahlen müssen.«
Er stieß ein kurzes, ärgerliches Lachen aus, um zu zeigen, dass er scherze, und fügte ein wenig schuldbewusst hinzu: »Es ist wohl unwahrscheinlich, dass jemand hier hereinkommt. Doch selbst wenn, können wir immer so tun, als spielten wir eine Partie Drei-Personen-Bridge.«
Ich fragte mich, ob Mrs. Erdleigh Tarockkarten benutze. Wenn ja, würde unser Bridge zu dritt auf einen Hereinkommenden wohl kaum sehr überzeugend wirken, wenn zum Beispiel einer von uns den ›ertrunkenen phönizischen Seemann‹ mit dem ›Gehenkten‹ trumpfen würde. Wie dem auch sei, ich sah keinen Grund, warum wir uns nicht in der Lounge die Karten legen lassen sollten. Das Zimmer würde so wenigstens einem gewissen Nutzen zugeführt. Die Art, wie Onkel Giles gesprochen hatte, ließ vermuten, dass er dem Kartenlegen mehr abgewann, als er zuzugeben bereit war.
Mrs. Erdleigh kam nicht sofort zurück. Wir erwarteten sie in einer Atmosphäre der Spannung, die durch die unverhohlene Erregung meines Onkels erzeugt wurde. Ich hatte ihn noch nie zuvor in einem solchen Zustand gesehen. Er atmete schwer. Mrs. Erdleigh erschien noch immer nicht. Sie musste wenigstens schon zehn Minuten oder eine Viertelstunde fort sein. Onkel Giles begann, vor sich hin zu summen. Ich nahm eines der zerlesenen Exemplare der »Dame« auf. Endlich öffnete sich wieder die Tür. Mrs. Erdleigh hatte ihren Hut abgelegt, das blaue Make-up unter ihren Augen erneuert und sich umgezogen. Jetzt trug sie ein salbeigrünes Kleid. Sie war sicher eine auffällige, vielleicht sogar eine etwas unheimliche Erscheinung. Die Karten, die sie mitgebracht hatte, waren grau und schmierig vom vielen Gebrauch. Es waren keine Tarockkarten. Nach einem kurzen Hin und Her einigten wir uns darauf, dass Onkel Giles als Erster in die Zukunft blicken solle.
»Sie glauben nicht, dass der Zeitabstand zu kurz gewesen ist?«, fragte er. Offensichtlich kamen ihm im letzten Augenblick Bedenken.
»Fast sechs Monate«, antwortete Mrs. Erdleigh in einem nüchterneren Ton, als sie ihn bisher benutzt hatte; und sie fügte, während sie zu mischen begann, hinzu: »Obwohl man natürlich die Karten nicht zu oft befragen sollte, wie ich Sie manchmal gewarnt habe.« Onkel Giles rieb langsam seine Hände aneinander und beobachtete sie genau, so als wolle er jede Täuschung verhindern und ganz sicher sein, dass sie nicht absichtlich eine Karte untermischte, die ihm Unglück bringen würde. Das Ritual hatte etwas Feierliches an sich, etwas unendlich Altes, so als habe Mrs. Erdleigh lange vor den uns bekannten Göttern existiert, sogar vor denen, die zur entferntesten Vergangenheit gehören. Ich fragte sie, ob sie immer dieselben Karten benutze.
»Immer dieselben lieben Karten«, sagte sie lächelnd, und an meinen Onkel gewandt in einem ernsthafteren Ton: »Gibt es irgendetwas Besonderes?«
»In Geschäften muss ich gewöhnlich vorausschauen«, sagte er schroff. »Das wäre also Karo, nehme ich an, oder Kreuz?«
Mrs. Erdleigh lächelte weiter, ohne eines ihrer Geheimnisse preiszugeben, und legte die Karten in verschiedenen kleinen Häufchen auf einen der maurischen Tische. Onkel Giles behielt sie scharf im Auge und rieb sich noch immer die Hände. Er machte mich genauso nervös, wie er selbst es war angesichts des Gedankens, was die Vorhersagen wohl beinhalten mochten. Bei jemandem mit seinem unsteten, sprunghaften Weg durchs Leben konnte man immer mit bedenklichen Möglichkeiten konfrontiert werden. Allerdings war ich natürlich weit mehr an dem interessiert, was sie über mich selbst sagen würde. Ja, ich war damals noch so weit davon entfernt, die unwandelbare Form der menschlichen Natur zu begreifen, dass ich es sogar erstaunlich fand, wie er in seinem Alter voraussetzte, dass es für ihn etwas gab, das man ›Zukunft‹ nennen konnte. Was mich selbst betraf, schien dagegen für eine Zügelung selbst der wildesten Absurditäten der Phantasie hinsichtlich dessen, was in dem allernächsten Augenblick geschehen mochte, kein Grund zu bestehen.
Als Onkel Giles’ Karten dann untersucht wurden, schienen ihre Geheimnisse jedoch nicht im Entferntesten so unheilvoll zu sein, wie man es wohl hätte befürchten können. Wir hörten eine Menge von – vielleicht nicht überraschenden – Widerständen gegenüber seinen ›Plänen‹; allerdings umgab ihn auch viel Klatsch, sogar ein wenig Verleumdung.
»Vergessen Sie nicht, Sie haben Saturn im zwölften Haus«, sagte Mrs. Erdleigh in einer Nebenbemerkung. »Heimliche Feinde.«
Im Gegensatz zu diesen bedrohlichen Möglichkeiten werde ihm jemand ein Geschenk machen, wahrscheinlich Geld: eine kleine, aber annehmbare Summe. Es schien, als werde diese Gabe von einer Frau kommen. Die Stimmung von Onkel Giles, dessen Wangen angesichts all des Klatsches und der Verleumdung eingefallen waren, hellte sich darüber wieder etwas auf. Ihm wurde gesagt, dass er in einer Frau einen guten Freund habe – möglicherweise die, welche ihm das Geschenk machen werde, genauer gesagt: die Herzdame. Auch dies hörte Onkel Giles nur allzu gern.
»Das war doch die Ehekarte, die Sie dort aufgeschlagen haben, oder?«, fragte er an einer Stelle.
»Das könnte so sein.«
»Nicht notwendigerweise?«
»Andere Einflüsse müssen in Betracht gezogen werden.«
Keiner von ihnen ging weiter auf diese Sache ein, doch bezogen sich beider Worte auf eine Frage, die offensichtlich schon in der Vergangenheit untersucht worden war. Einige Momente lang spürte man vielleicht den schwachen Hauch zusätzlicher Spannung. Dann wurden die Karten wieder eingesammelt und erneut gemischt.
»Jetzt wollen wir etwas über ihn hören«, sagte Onkel Giles.
Aus seinen Worten klang eher Erleichterung, dass seine eigenen Qualen jetzt vorüber waren, als ein brennendes Interesse an meinem Schicksal.
»Ich nehme an, er möchte etwas über die Liebe hören«, sagte Mrs. Erdleigh und kicherte wieder vor sich hin.
Onkel Giles grunzte ein missbilligendes Lachen hervor, um seine allgemeine Zustimmung zu dieser Annahme zu zeigen. Ich versuchte einige formelle Dementis, doch war es völlig richtig, dass mich diese Frage besonders interessierte. Im Augenblick war meine Lage in dieser Hinsicht verworren. Ja, was die ›Liebe‹ anbetraf, hatte ich in den letzten Jahren in so etwas wie einer Notbehelfssituation gelebt. Das war nicht deshalb so, weil ich nur geringes Interesse an der Sache gehabt hätte – etwa wie ein Mann, den es kaum kümmert, was er isst, solange nur sein Hunger gestillt wird; oder wie jemand, der bereitwillig über Malerei diskutiert, wenn dieses Thema angeschnitten wird, der jedoch nie in Versuchung käme, eine Galerie zu betreten. Im Gegenteil, mein Interesse an der Liebe war äußerst heftig, aber in ihrer eigentlichen Form schien mir diese Sache nicht gerade einfach zu erreichen zu sein. In dieser Hinsicht waren andere Leute offensichtlich leichter zufriedengestellt als ich. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck. Und doch, trotz meines wählerischen Getues waren meine Erfahrungen, bei späterer Prüfung, keineswegs bewundernswürdiger als jene, auf die Templer oder Barnby zum Beispiel keinen weiteren Gedanken verschwendet hätten; sie waren nur der Anzahl nach geringer. Ich hoffte, die Karten würden nichts enthüllen, was für meine Selbstachtung allzu demütigend wäre.
»Es besteht eine Verbindung zwischen uns«, sagte Mrs. Erdleigh, während sie die kleinen Kartenhäufchen legte. »Im Augenblick kann ich nicht ausmachen, was es ist – aber es besteht eine Verbindung.«
Dieses vermutete Bindeglied stellte sie offensichtlich vor ein Rätsel.
»Sind Sie musikalisch?«
»Nein.«
»Dann schreiben Sie – ich glaube, Sie haben ein Buch geschrieben.«
»Ja.«
»Sie leben zwischen zwei Welten«, sagte sie. »Vielleicht sogar zwischen mehr als zwei Welten. Sie können Ihre Gefühle nicht immer meistern.«
Mir fiel keine mögliche Antwort auf diese Beschuldigung ein.
»Man hält Sie für kalt, aber Sie hegen tiefe Zuneigungen, manchmal für Leute, die an sich wertlos sind. Sie sind oft uneins mit Menschen, die Ihnen helfen könnten. Sie mögen Frauen, und Frauen mögen Sie, aber Sie finden die Gesellschaft von Männern oft unterhaltsamer. Sie erwarten zu viel, und doch geben Sie sich auch zu rasch zufrieden. Sie müssen versuchen, das Leben zu verstehen.«
Leicht eingeschüchtert durch diese eingehende, ja strenge Analyse, versprach ich, mich in Zukunft zu bessern.
»Die Menschen können nur so sein, wie sie sind«, sagte sie.
»Wenn sie die Qualitäten besäßen, die Sie in ihnen sehen möchten, wären es andere Menschen.«
»Ich möchte gern, dass sie das wären.«
»Manchmal sind Sie zu ernsthaft, manchmal nicht ernsthaft genug.«
»Das hat man mir schon gesagt.«
»Sie müssen sich mehr anstrengen im Leben.«
»Das sehe ich ein.«
Mir schien diese Kritik nur zu gerechtfertigt; und doch würde eine Änderung der Richtung sehr schwer zu erreichen sein. Vielleicht war ich, genau wie sie es beschrieben hatte, auf halbem Wege zwischen Ausschweifung und Schüchternheit unwiderruflich erstarrt. Während ich über dieses Problem nachdachte, ging sie zu detaillierteren Dingen über. Es erwies sich, dass eine blonde Frau nicht sehr zufrieden mit mir war, und eine dunkle war fast ebenso verärgert über mich. Wie mein Onkel – vielleicht zeigte sich hier ein uns beiden gemeinsamer Familienfehler – wurde ich von Klatsch umgeben.
»Diese Personen sind überhaupt nicht von Bedeutung«, sagte Mrs. Erdleigh, sich mit diesen Worten ziemlich unbarmherzig auf die beiden Frauen gegensätzlicher Haarfarbe beziehend. »Diese hier ist eine weit wichtigere Dame – mittleres Haar, würde ich sagen, und ich glaube, Sie sind ihr schon einige Male begegnet, allerdings nicht in letzter Zeit. Aber es scheint noch einen anderen Mann zu geben, der auch an ihr interessiert ist. Es könnte sogar der Ehemann sein. Sie mögen ihn nicht besonders. Er ist ziemlich groß, vermute ich. Blond, vielleicht rothaarig. Er ist Geschäftsmann und hält sich oft im Ausland auf.«
Ich ging im Geiste alle Frauen durch, denen ich je begegnet war.
»Es gibt da eine kleine Sache in Ihrem Geschäft, die Unannehmlichkeiten verursachen wird«, fuhr sie fort. »Sie hat mit einem älteren Mann zu tun – und zwei jüngeren, die mit ihm verbunden sind.«
»Sind Sie sicher, dass es sich nicht um zwei ältere Männer und einen jungen Mann handelt?«
Mir war sofort der Gedanke gekommen, sie sei möglicherweise en rapport mit den wachsenden Schwierigkeiten meiner Firma hinsichtlich St. John Clarkes Einleitung zu »Die Kunst Horace Isbisters«. Die älteren Männer wären dann St. John Clarke und Isbister selbst – oder vielleicht St. John Clarke und einer der Gesellschafter meiner Firma – und der junge Mann natürlich Mark Members, St. John Clarkes Sekretär.
»Ich sehe die beiden jungen Männer ganz deutlich«, sagte sie. »Ein ziemlich unangenehmes Paar, würde ich sagen.«
All diese Dinge waren, einschließlich der Skizze meines Charakters, sicher sehr glaubhaft, wenn vielleicht auch nicht besonders interessant. Solche trivialen, mit einigen peinlichen Wahrheiten persönlicher Natur vermischten Kommentare bilden ja, das hatte ich bereits erkannt, die Gemeinplätze der Wahrsagerei. Das war alles, was mir von dem im Gedächtnis blieb, was Mrs. Erdleigh bei dieser Gelegenheit prophezeite. Vielleicht hat sie mir noch mehr vorausgesagt. Wenn das so war, dann habe ich ihre Worte vergessen. Ich fand zwar ihre Einsichten wirklich nicht besonders aufregend, doch beeindruckte sie mich als eine Frau mit einer dominierenden, sogar auf eine seltsame Weise attraktiven Persönlichkeit – trotz einer gewissen Absurdität in ihrem Betragen. Sie selbst schien sehr zufrieden mit ihrer Vorstellung.
Am Ende der Sitzung wurde es Zeit für mich zu gehen. Ich war für das Abendessen mit Barnby verabredet und sollte ihn in seinem Studio abholen. Ich stand auf, um mich zu verabschieden, und bedankte mich für die Mühe, die sie auf sich genommen hatte.
»Wir werden uns wiedersehen.«
»Das hoffe ich.«
»In etwa einem Jahr.«
»Vielleicht schon früher.«
»Nein«, sagte sie und lächelte mit der Selbstgefälligkeit einer Person, der lange zuvor die Geheimnisse menschlicher Existenz auf magische Weise enthüllt worden sind. »Nicht früher.«
Ich ging nicht weiter darauf ein. Onkel Giles begleitete mich zur Eingangshalle. Er war inzwischen wieder auf Geld zu sprechen gekommen, ein Thema, dessen mystique ihn mindestens in gleicher Weise fesselte wie jene Riten, die unsere Aufmerksamkeit kurz zuvor in Anspruch genommen hatten.
»… und dann konnte man ja nicht voraussehen, dass die Obligationen der San-Pedro-Lagerhäuser völlig wertlos werden würden«, sagte er gerade. »Die Enteignungen waren nur die Folge davon, dass ein liberaler Diktator an die Macht gekommen ist. Mit solchen Veränderungen muss man sich abfinden. Es gab eine dieser ganz natürlichen Reaktionen gegen das ausländische Kapital …«
Er brach mitten im Satz ab. Da ich vermutete, unser Treffen sei nun zu Ende, wandte ich mich von ihm weg, um mich durch die undurchsichtigen Türen in das Meer der Straßen zu stürzen, in dessen Auf und Ab der Dünung das Ufford träge dahintrieb. Onkel Giles legte seine Hand auf meinen Arm.
»Ach übrigens«, sagte er, »ich glaube, ich würde deinen Eltern gegenüber nicht erwähnen, dass man dir die Karten gelegt hat. Ich möchte nicht, dass sie mir vorwerfen, ich verleite dich zu schlechten Gewohnheiten, abergläubischen, meine ich. Außerdem würden sie wohl nicht besonders viel von Myra Erdleigh halten.«
Sein braunes zerknittertes Gesicht zog sich ein wenig zusammen. Er hatte sich einiges von seinem guten, dem Typ nach leicht militärischen Aussehen bewahrt. Vielleicht war es jene – durch das Alter verstärkte – Andeutung vergangener militärischer Würde in irgendeiner vergessenen Garnisonsstadt, was Mrs. Erdleigh an ihm bewunderte. Weder meine Eltern noch sonst jemand von Onkel Giles’ Verwandten wären wahrscheinlich über sein Verhalten besorgt, wenn er nie etwas Schlimmeres getan hätte, als Mitglieder der Familie dazu zu überreden, sich die Karten legen zu lassen. Dennoch, ich sah ein, dass Schweigen zu dem Thema Mrs. Erdleigh wohl eine vernünftige Bitte war, und versicherte ihm, dass ich über unsere Begegnung nicht sprechen würde.
Ich hätte gern gewusst, welche Beziehung die beiden zueinander unterhielten. Möglicherweise planten sie zu heiraten. Die ›Ehekarte‹ hatte ganz eindeutig Onkel Giles’ Interesse erregt. Etwas vage Unschickliches umgab Mrs. Erdleigh, und das schien fast Absicht zu sein; aber es war eine Unschicklichkeit von einer vergessenen, viktorianischen Art: eine Villa in St. John’s Wood vielleicht, und ausgefallenes Treiben hinter verschlossenen Türen und hinter Spitzenvorhängen an schwülen Sommernachmittagen. Onkel Giles war für seine Fähigkeit bekannt, sich bei Damen der verschiedensten Sorte beliebt zu machen; und es ging das Gerücht, dass einige von ihnen sogar manchmal ein wenig zu seinen Unkosten beigetragen hatten – zu jenen vielen Unkosten, denen er immer ausgesetzt war und die er nie müde wurde im Einzelnen aufzuzählen. Mrs. Erdleigh sah nicht besonders ›wohlhabend‹ aus, erweckte aber den Eindruck, äußerst gut in der Lage zu sein, wirkungsvoll ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Möglicherweise hielt Onkel Giles sie für eine gute Investition. Sie ihrerseits wusste zweifellos auch, wozu sie ihn gebrauchen konnte. Abgesehen von materiellen Erwägungen war er offensichtlich von ihren okkulten Kräften fasziniert, die ihn fast mit Andacht zu erfüllen schienen. Wie in all solchen Verbindungen gab es wahrscheinlich auch bei ihnen heftige Willenskämpfe. Es würde interessant sein zu sehen, wer den Sieg davontragen würde. Für den Gesamtausgang setzte ich da auf Mrs. Erdleigh. Ich dachte noch einige Tage über die beiden nach, dann schwanden sie mir aus dem Gedächtnis.
Auf meinem Weg in die Umgebung des Fitzroy Square erfüllte mich wieder jenes Gefühl der Erleichterung, das ich immer verspürte, wenn ich mich von Onkel Giles verabschiedet hatte. Meine Gedanken kamen nun auf die geschäftlichen Schwierigkeiten zurück, die die Karten für die nahe Zukunft vorausgesagt hatten. Wie ich schon sagte, schien sich dies auf St. John Clarkes Einleitung zu »Die Kunst Horace Isbisters« zu beziehen, eine schon jetzt leidige Angelegenheit, die aber wohl noch schlimmere Formen annehmen würde. Wir warteten inzwischen seit wenigstens einem Jahr auf die Einleitung, und es bestand kaum Aussicht, das Manuskript in der nahen Zukunft zu bekommen. Diese Verzögerung bereitete der Firma eine Menge Unannehmlichkeiten, denn es waren bereits Druckstöcke für eine Serie von achtundvierzig schwarzweißen Tafeln und für vier dreifarbige Reproduktionen angefertigt worden; ihnen sollten St. John Clarkes biografische Reminiszenzen im Umfang von vier- bis fünftausend Wörtern hinzugefügt werden.
Isbister selbst kränkelte seit einiger Zeit, so dass wir über ihn keinen Druck auf St. John Clarke ausüben konnten, obwohl der Maler ein alter Freund des Schriftstellers war. Vielleicht hatten die beiden sogar zusammen die Schule besucht. Jedenfalls hatte Isbister mehrere Porträts von St. John Clarke gemalt, eines davon zeigte ihn als ziemlich jungen Mann, in einem hohen Kragen und mit einer schlaff herunterhängenden gepunkteten Schleife. Aus Reklamegründen hatten sie beide ihre jeweiligen Biografien zu der des jungen Mannes vom Lande stilisiert, der es ›zu etwas gebracht‹ hatte, und in ihren Publikationen pflegten sie manchmal auf ihre gemeinsamen frühen Mühen zu verweisen. St. John Clarke hatte zunächst beträchtliche Anstrengungen unternommen, um zu erreichen, dass er selbst den Auftrag für die Einleitung bekam und nicht einer der passenden Schreiberlinge aus der alten Garde der Kunstkritiker, von denen mehrere das Honorar, das meine Firma für die Arbeit zahlte, eine nicht gerade fürstliche Summe, sicher weit nötiger gehabt hätten.
Dass ein bekannter Romanschriftsteller etwas übernahm, das, zumindest zu einem gewissen Grad, einen anerkannten Experten der Malerei erforderte, war nicht ganz so erstaunlich, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mochte, denn St. John Clarke hatte, obwohl in den letzten Jahren sicherlich ruhiger geworden, in der Vergangenheit bei öffentlichen Kontroversen um die bildenden Künste oft eine Rolle gespielt. Zum Beispiel hatte er sich in den Jahren vor dem Krieg aktiv für die Errichtung der Peter-Pan-Statue in den Kensington Gardens eingesetzt, um dann ein Dutzend Jahre später die Aufstellung der Rima-Figur in der ›Vogelzuflucht‹ im Hyde Park nebenan heftig zu bekämpfen. Ich erinnerte mich, dass auf einer der Abendgesellschaften der Walpole-Wilsons die Rede war von St. John Clarkes Stellungnahme zu der Frage des Denkmals für General Haig, das damals viel diskutiert wurde. Diese Beispiele deuten auf ein besonderes Interesse an der Bildhauerkunst, aber St. John Clarke äußerte sich auch oft mit gleicher Verve über Malerei und Musik. Sicher war, dass er 1910 zu den Gegnern der Nachimpressionisten gehört und dass er nach dem Waffenstillstand von 1918 auch in Opernkreisen einige kleine Scharmützel ausgetragen hatte.
Ich selbst hätte nicht bestreiten können, etwa kurz vor dem Ende meiner Schulzeit eine Vorliebe für St. John Clarkes Romane gehabt zu haben. Ja, Le Bas, mein Hausdirektor, war einmal in mein Zimmer gekommen, während ich einen von ihnen las. Er hatte ihn mir aus der Hand genommen und flüchtig durchgeblättert.
»Ziemlich morbides Zeug, nicht wahr?«, hatte er bemerkt. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage gewesen, doch bezweifle ich, dass Le Bas je einen Roman St. John Clarkes gelesen hatte. Er hatte nur das in gewisser Hinsicht richtige Gefühl, dass etwas an ihnen nicht stimmte. Er hatte jedoch keinen Versuch gemacht, das Buch zu verbieten oder zu konfiszieren. Wie dem auch sei, ich zog es schon lange vor, die Zeit zu vergessen, in der ich St. John Clarkes Werk für ziemlich gewagt gehalten hatte. Ja, es war mir längst zur Gewohnheit geworden, über ihn und seine Bücher mit jener grausamen Härte zu sprechen, die, wenn man jung ist, vielleicht zu Recht die einzig angemessene und ernsthafte Haltung jedem, vor allem einem älteren Menschen gegenüber ist, der die Künste auf eine unzulängliche oder veraltete Weise ausübt.
Obwohl er einige Jahre jünger war als die Generation H. G. Wells’ und J. M. Barries, hatte meine Vorstellung St. John Clarke mit diesen beiden Autoren verbunden, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich die drei einmal zusammen auf einer Fotografie gesehen hatte, die in den Memoiren einer bekannten Dame der Gesellschaft der Zeit kurz nach der Jahrhundertwende abgedruckt war. Die Dame hatte wahrscheinlich das Bild selbst aufgenommen. Die Schriftsteller standen in einer Gruppe zusammen auf dem Rasen eines riesengroßen, mit ziemlich reizlosen Spitztürmchen versehenen Landsitzes. St. John Clarke hatte sich ein wenig zu einer Seite des Bildes hin postiert. Ein großer, ausgemergelter Mann mit Brille und langem Haar und einem Panamahut auf dem Hinterkopf, lehnte er auf einem Stock und beobachtete seine eher winzigen Mitgäste mit einem Ausdruck unbehaglichen Interesses: ein wenig so, als sei er ein Forschungsreisender oder Missionar, der diese mächtigen Medizinmänner eines benachbarten und insgesamt feindseligen Stammes gerade aus dem Urwald gelockt hat. Er schien, nach diesem Ausdruck zu urteilen, das Gefühl zu haben, dass dauernde Aufsicht notwendig sei, um Ungezogenheiten oder Fluchtversuche der beiden anderen zu vereiteln. Es lag etwas Priesterhaftes in seiner Erscheinung.