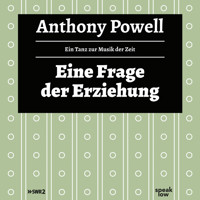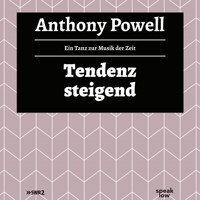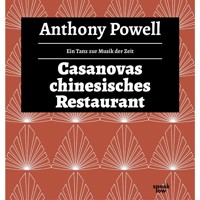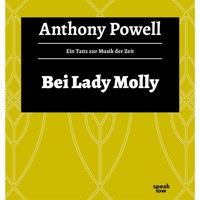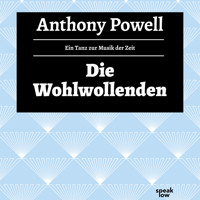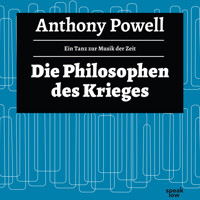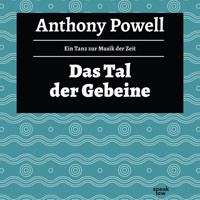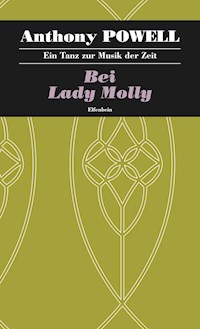
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Tanz zur Musik der Zeit
- Sprache: Deutsch
Der zwölfbändige Zyklus »Ein Tanz zur Musik der Zeit« — aufgrund seiner inhaltlichen wie formalen Gestaltung immer wieder mit Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« verglichen — gilt als das Hauptwerk des britischen Schriftstellers Anthony Powell und gehört zu den bedeutendsten Romanwerken des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von dem gleichnamigen Bild des französischen Barockmalers Nicolas Poussin, zeichnet der Zyklus ein facettenreiches Bild der englischen Upperclass vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten sechziger Jahre. Aus der Perspektive des mit typisch britischem Humor und Understatement ausgestatteten Ich-Erzählers Jenkins — der durch so manche biografische Parallele wie Powells Alter Ego anmutet — bietet der »Tanz« eine Fülle von Figuren, Ereignissen, Beobachtungen und Erinnerungen, die einen einzigartigen und aufschlussreichen Einblick geben in die Gedankenwelt der in England nach wie vor tonangebenden Gesellschaftsschicht mit ihren durchaus merkwürdigen Lebensgewohnheiten. Im vierten Band besucht der Erzähler während eines Wochenendaufenthalts ein Schloss, wo er seine zukünftige Frau kennenlernt. Der historische Hintergrund scheint dabei immer wieder überraschend schlaglichtartig auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Powell
Bei Lady Molly
Roman
Ein Tanz zur Musik der Zeit –Band 4
Aus dem Englischen übersetzt von Heinz Feldmann
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel
»At Lady Molly’s« bei William Heinemann, London.
Band 4 des Romanzyklus »A Dance to the Music of Time«
At Lady Molly’s
©John Powell and Tristram Powell, 1957
© 2015 / 2016 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-79-4 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-39-8 (Druckausgabe)
1
Wir waren mit General Conyers seit undenklichen Zeiten bekannt gewesen – nicht etwa, weil mein Vater je unter ihm gedient hätte, sondern durch eine lang vergessene Verbindung mit den Eltern meiner Mutter, mit denen er sogar entfernt verwandt gewesen sein mochte. Wie auch immer, es stand fest, dass er in jener weit zurückliegenden Ära, als man Linienregimenter noch mit einer Nummer statt mit dem Namen einer Grafschaft bezeichnete, wenn auch damals Offizierspatente wohl nicht länger käuflich waren, in ihrem Hause zu verkehren pflegte. Obwohl er dieser dunklen, archaischen Periode zugehörte, von der sich auch manchmal Spuren in seiner Kleidung und seiner Sprechweise offenbarten – er war zum Beispiel einer der Letzten, die von der Gardekavallerie als »die Hüpfer« sprachen –, hatte er in unseren Familiengeschichten einen Platz nicht nur als ein Soldat, dessen Interessen über seinen Beruf hinausgingen, sondern auch als ein Mann von Welt, der immer »mit den neuesten Entwicklungen Schritt hielt«. Diese Neigung, mit der Mode zu gehen und zu jedem Thema seine Meinung beizusteuern, wurde ihm von einigen Leuten übelgenommen – besonders von Onkel Giles, der zeitnahes Denken nie liebte und aus Prinzip misstrauisch gegenüber jedem weltlichen Erfolg war, wie bescheiden dieser auch sein mochte.
»Aylmer Conyers hatte ein Gespür dafür, Karriere zu machen«, pflegte er zu sagen. »Das ist eigentlich nichts Schlimmes, meine ich. Jemand muss ja die Befehle geben. Ich persönlich hab mir nie viel daraus gemacht, im Mittelpunkt zu stehen. Es gab genug andere, die sich nach vorn drängten. Hatte ’ne hohe Meinung von sich selbst, Conyers. Stattlicher Mann, sagten die Leute immer, neigt ein bisschen zu sehr dazu, sich aufzutakeln. Ist auch nicht ganz ohne Freunde in hohen Stellen. Ganz im Gegenteil, ob im Krieg oder im Frieden, Conyers kannte immer die richtigen Leute.«
Ich hatte mich einmal bei ihm über die Feldzüge des Generals erkundigt.
»Afghanistan, Burma – als Leutnant. Ich hab mal gehört, wie er groß über Zululand angegeben hat. Er war eine Zeitlang im Sudan, als der Khalifa dort Ärger machte. Übernahm gerne Aufgaben im Ausland. Angeblich soll er einem Eingeborenenherrscher bei irgendeinem lokalen Krawall das Leben gerettet haben. Rüstete die Palasteunuchen mit Vogelflinten aus. Der Mann schenkte ihm dann einen mit Juwelen besetzten Krummsäbel – Halbedelsteine natürlich.«
»Ich hab den Krummsäbel gesehen, die Geschichte kannte ich noch nicht.«
Onkel Giles, der diese Unterbrechung ignorierte, erzählte mir dann, wie Aylmer Conyers Südafrika, das Grab so vieler militärischer Reputationen, zu seinem Vorteil genutzt hatte. Da mein Onkel selbst, infolge eigener Unbedachtsamkeiten, kurz vor Ausbruch des Krieges in Transvaal seinen Abschied von der Armee genommen hatte und da er zudem, wie es für einen Mann, der sich für »so etwas wie einen Radikalen« hielt, angemessen war, ›pro-burische‹ Ansichten vertrat, sprach er immer mit einer zweifellos in großem Maße berechtigten Schärfe von der Art, wie die Operationen des Feldzugs geführt worden waren.
»Nachdem French den Modder-Fluss überquert hatte, erhielt die gesamte Kavalleriedivision den Befehl zum Angriff. Etwas noch nie Dagewesenes. Wie ein Reitsportfest.«
»Ja?«
Er verlor für ein oder zwei Minuten den Faden, versunken in die Vorstellung, wie staubige Reiterschwadronen auf dem ›Veldt‹ von der Kolonne in die Linien schwenkten; oder, was wahrscheinlicher war, geplagt von eigenen Erinnerungen, weniger dramatisch, wenn auch bitterer.
»Was passierte?«
»Was?«
»Was passierte, als sie angriffen?«
»Cronje beurteilte ausnahmsweise die Lage falsch. Er schickte nur einige Abteilungen los. Wir brachen durch bis Kimberley, mit mehr Glück als Verstand.«
»Aber was war mit General Conyers?«
»Irgendwie gelang es ihm, die Attacke mitzumachen. Eigentlich hatte er bei den Kavalleriebrigaden nichts zu suchen; er erfand irgendeinen Vorwand. Dann, ein oder zwei Tage später, ging er dahin zurück, wo er von Anfang an hätte gewesen sein sollen. Er machte sich bei den Transportwagen äußerst wichtig. Bei der Marschkolonne sah es aus wie zur Hochsaison im Hyde Park, weißt du: Kutsche an Kutsche am Albert Gate – das sagte mir jemand, der beim Vormarsch dabei war; und Conyers rannte herum und fluchte und schimpfte, als ob er der Besitzer des Ganzen sei.«
»Hat nicht Lord Roberts etwas über seine Arbeit im Stab gesagt?«
»Bobs?«
»Ja.«
»Wer hat das gesagt, dein Vater?«
»Ich glaube, ja.«
Onkel Giles schüttelte den Kopf.
»Vielleicht hat Bobs was gesagt. Wäre nicht das erste Mal, dass ein General die Zusammenhänge falsch verstanden hätte. Man sagt, Conyers sei auch ganz schön hinter den Frauen her gewesen. Manche Leute dachten, er würde deiner Großtante Harriet einen Heiratsantrag machen.«
Andere, im Allgemeinen verlässlichere Erinnerungen widersprechen dieser letzteren Mutmaßung. In der Tat, Conyers blieb Junggeselle, bis er fast fünfzig war. Er war inzwischen Brigadegeneral geworden, und alle erwarteten, dass er noch weit höher aufsteigen werde, als er – zur Überraschung seiner Freunde – eine fast zwanzig Jahre jüngere Frau heiratete und achtzehn Monate danach seinen Abschied nahm. Vielleicht war er es müde, auf den Krieg gegen Deutschland zu warten, den er so oft prophezeit hatte und in dem ihm, wäre er früher ausgebrochen, gewiss ein hohes Kommando angeboten worden wäre. Möglicherweise gefiel seiner Frau das Nomadendasein des Soldaten nicht, auch nicht als Frau eines Generals. Es ist unwahrscheinlich, dass sie dem Armeeleben viel Geschmack abgewonnen hatte. Andererseits mag der General selbst vielleicht der militärischen Routine müde gewesen sein. Wie viele fähige Soldaten besaß er eine exzentrische Seite. Obwohl nicht gerade ein Virtuose, hatte er immer sehr gern Cello gespielt, und nach seiner Pensionierung nahm die Musik einen großen Teil seiner Zeit ein; außerdem experimentierte er mit seiner Lieblingstheorie, dass Pudel wegen ihrer angeborenen scharfen Intelligenz sehr gut zu Jagdhunden abgerichtet werden könnten. Er begann auch, ein reges gesellschaftliches Leben zu führen und wurde zum Mitglied der Leibgarde ernannt – eine Rolle, in der ich ihn mir aufgrund früher Gedankenassoziationen immer vorstelle.
»Komisch, dass ein Mann Gefallen daran findet, eine Art Hoflakai zu sein«, pflegte Onkel Giles zu sagen. »Für mich wäre es undenkbar, mich mit ’ner Menge Purpur und Gold aufzutakeln, in königlichen Palästen herumzuhängen und mit Scharen junger Damen mit Straußenfedern zusammenzuhocken. Er hat es seiner Frau zuliebe getan, nehme ich an.«
Mrs. Conyers mochte in der Tat eine indirekte Rolle bei dieser Ernennung gespielt haben. Sie war die älteste Tochter Lord Vowchurchs, des Freundes von König Edward VII., und hatte zur Zeit der Hochzeit ihren dreißigsten Geburtstag bereits hinter sich. Von ihrem Vater, einem jener in der viktorianischen Zeit so seltsam häufig anzutreffenden Männer, die durch Clownerien persönlich Macht zu erreichen suchten, werden – oder wurden – endlos viele, nicht immer erbauliche Geschichten erzählt. Die bleibendste Erinnerung an ihn (sie hängt zusammen mit Bildern anderer Honoratioren der siebziger Jahre in dem feuchten, verlassenen Billardzimmer auf Thrubworth) ist Leslie Ward Spys Karikatur in der »Vanity Fair«-Serie, die diesen spaßigen Lord in grauem Gehrock und grauem Zylinder zeigt: die Übellaunigkeit, für die er zu Hause so berüchtigt war wie für seinen sprühenden Witz in der Gesellschaft, geschickt angedeutet durch die Linien des Mundes unter dem Backenbart. In späteren Jahren wurde Lord Vowchurch dann ruhiger, besonders nach einem ziemlich ernsthaften Unfall, den er, als ein Pionier auf diesem Gebiet, in den frühen Tagen des Automobils hatte. Nach diesem Missgeschick hinkte er. Dies und die übrigen Verletzungen, die er davontrug, scheinen jenen gewohnheitsmäßigen, selten gutmütigen Schabernack angespornt zu haben, der ihn bei König Edward, als dieser noch Prince of Wales war, so oft in Schwierigkeiten gebracht hatte, ihm aber ebenso oft wieder verziehen worden war. Seine Töchter hatten ihre Kindheit und Jugend in dauernder Ungnade verlebt, weil keine von ihnen als Junge zur Welt gekommen war.
Meine Eltern verkehrten nicht sehr häufig mit dem General und seiner Frau. Sie kannten sie etwa so gut wie die Walpole-Wilsons; doch war die Beziehung zu den Conyers, wegen des in entfernter, mythischer Vergangenheit gelegten Fundaments, wenn auch nicht intimer, so doch in gewisser Weise tiefer und befriedigender.
Wie alle Ehen barg auch die Verbindung der Conyers Elemente des Rätselhaften. Es wurde weithin angenommen, dass der General so lange Junggeselle geblieben sei, weil er die Überzeugung vertrete, eine Karriere lasse sich am besten allein aufbauen. Vielleicht befürwortete er (wie de Gaulle, den er noch als Führer des Freien Frankreich erlebte) ein zölibatäres Corps von Offizieren, die sich wie Priester ganz ihrer militärischen Berufung widmen. Er veröffentlichte einmal etwas dieser Art im »United Service Magazine«. Diese Theorie beruhte keineswegs auf einer Ablehnung des anderen Geschlechts als solches. Im Gegenteil: Wie Onkel Giles angedeutet hatte, glaubte man allgemein, dass er sich als junger Offizier in Indien und anderswo in einem beträchtlichen, wenn auch unauffälligen Maße um die Gunst der Frauen bemüht habe. Manche meinten, dass ihn eine eher andere Art von Ehrgeiz – das Gefühl, nie einige der guten Seiten des Lebens genossen zu haben – schließlich dazu bewegt habe, zu heiraten und seinen Abschied zu nehmen. Einige unheilbar romantisch Veranlagte vermuteten sogar, er habe sich an der Schwelle zu seinem fünfzigsten Lebensjahr zum ersten Mal verliebt.
General Conyers und seine Frau schienen ebenso gut miteinander auszukommen wie viele vergleichbare Paare, die schon in jüngeren Jahren geheiratet hatten – wenn nicht besser. Sie verkehrten vornehmlich in einem Zirkel, der auf, man darf wohl sagen: ganz unprätentiöse Weise (denn nichts hätte – wie Chips Lovell etwa dieses Wort gebrauchte – weniger »smart« gewesen sein können als der Haushalt der Conyers) mit dem Hof verbunden war: mit Familien wie den Budds und den Udneys. In den begrenzten, aber intensiven – und manchmal dekorativen – Tätigkeiten dieser berufsmäßigen Höflinge schien der General eine angemessene Alternative zu dem Leben eines hohen Offiziers gefunden zu haben. Sie hatten eine Tochter namens Charlotte, ihr einziges Kind, ein etwas farbloses Mädchen, das einen Korvettenkapitän heiratete. Ich nahm manchmal mit ihr den Tee ein, als wir beide noch Kinder waren.
Kurz vor Weihnachten 1916, zu einer Zeit, als Mrs. Conyers dabei war, ›Liebesgaben‹ für die sich im Ausland befindenden Truppen zu sammeln (eine Aufgabe, die damals noch in den Händen von Amateuren lag und noch nicht von der Organisation übernommen worden war, die nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg Onkel Giles beschäftigte), nahm mich meine Mutter, während ich auf meinem Weg von der Schule nach Hause in London Station machte, mit in Mrs. Conyers’ Wohnung in der Nähe des Sloane Square. Meine Mutter machte diesen Besuch entweder, um den Stapeln von Socken, Schals oder Kopfschützern ihren eigenen gestrickten Beitrag hinzuzufügen oder um bei dem Verteilungsverfahren zu helfen. In einer Ecke des Zimmers, in dem all diese Bündel übereinandergeschichtet wurden, stand das Cello in einem Kasten. Neben ihm bemerkte ich sofort eine große Fotografie des Generals; er hatte eine Hellebarde in der Hand und trug den federgeschmückten Helm und den Frack mit den schweren Goldepauletten eines Leibgardisten. Das ist der Grund, warum ich ihn mir immer als eine statuenhafte Gestalt bei königlichen Audienzen und Hofbällen vorstelle, und nicht als den Mann der Tat, der er während des größten Teils seines Lebens gewesen sein musste. Vor zu langer Zeit aus der Armee ausgeschieden, um für die Wiedereinstellung auf einen Posten höchster Bedeutung in Frage zu kommen, hatte er doch bald nach Ausbruch des Krieges eine Stellung erhalten, die zwar weit davon entfernt war, großes Gewicht zu besitzen, die man jedoch aus Respekt mit dem Rang eines Generalmajors verbunden hatte.
Wir hatten den Tee beendet, und Mrs. Conyers zeigte mir gerade den von Onkel Giles erwähnten juwelenbesetzten Krummsäbel, den sie aus irgendeinem Grund in der Londoner Wohnung behielten statt in dem kleinen Haus in der Grafschaft Hampshire, wo die Pudel abgerichtet wurden. Ich durfte das Stück als Entschädigung dafür sehen, dass Charlotte sich auf dem Lande befand, obwohl doch eine Entschuldigung gar nicht notwendig war, denn ich fand es amüsanter ohne sie. Ich bewunderte gerade die mit Samt bezogene Scheide und fragte mich, ob es wohl erlaubt sei, den Säbel aus dieser Hülle zu ziehen, als das Hausmädchen jemanden ins Zimmer führte. Der Neuankömmling war eine Frau in der Uniform des Freiwilligen Hilfsdienstes. Sie kam hereingeschritten wie ein Grenadier. Es handelte sich um Mildred Blaides, Mrs. Conyers’ jüngste Schwester.
Der Altersunterschied zwischen den beiden muss mindestens so groß gewesen sein wie der zwischen Mrs. Conyers und ihrem Mann. Ja, diese Miss Blaides stellte die letzte, erfolglose Anstrengung ihrer Eltern dar, einen männlichen Erben zu bekommen, ehe dann Lord Vowchurch seinen Autounfall erlitt und sich endgültig damit abfand, dass der Titel auf einen Cousin übergehen würde. Sie war hochgewachsen, hatte eine lange Nase und war nicht hübscher, in meinen Augen allerdings unendlich fescher als Mrs. Conyers. Sie hatte ein lebhaftes Gesicht, der Maske eines Fuchses nicht unähnlich. Sie nahm fast sofort ein Zigarettenetui aus einem lackartigen Material aus ihrer Tasche und zündete sich eine Zigarette an. So etwas war zu jener Zeit, besonders wenn es eine so junge Dame tat, noch ein Zeichen bewusster weiblicher Emanzipation. Ich vermute, sie war damals etwa zwanzig.
»Mildred ist jetzt auf Dogdene«, erklärte uns Mrs. Conyers. »Sie müssen wissen, dass die Sleafords ihr Haus als Lazarett für Offiziere zur Verfügung gestellt haben, als der Krieg ausbrach. Sie selbst wohnen jetzt in dem Ostflügel. Auch in dem Park stehen dort jetzt überall Baracken.«
»All diese Knilche in den Baracken sind eine wirkliche Pest«, sagte Miss Blaides. »Neulich abends waren einige der Landser schicker und haben eine der Steinurnen von der italienischen Brücke in den See gestoßen. Das war einfach gemein von ihnen. Sie sind sowieso eine miese Einheit. Alle Offiziere tragen ›gorblimeys‹.«
»Was in aller Welt ist das, Mildred?«, fragte Mrs. Conyers nervös.
Nachdem sie die Frage gestellt hatte, fürchtete sie, glaube ich, es handele sich vielleicht um etwas, über das man nicht in Gegenwart eines kleinen Jungen sprechen könne, denn sie hob ihre Hand, als ob sie eine allzu schreckliche Offenbarung verhindern wolle.
»Ach, diese schlappen Soldatenmützen«, sagte Miss Blaides leicht dahin. »Sie haben das Steifmaterial rausgenommen, weißt du. Natürlich müssen sie das tun, wenn sie an der Front sind, um zu verhindern, dass ihnen die Drahtstücke in ihren Kürbis geblasen werden; aber sie könnten wenigstens versuchen, hier bei uns anständig auszusehen.«
Sie zog heftig an ihrer Zigarette.
»Ich muss wirklich meinen Glimmstängelverbrauch drosseln«, sagte sie und schnippte die Asche auf den Teppich. »Ich bin jetzt bei etwa dreißig pro Tag angelangt. Das geht einfach nicht mehr. Übrigens, Molly Sleaford möchte dich besuchen kommen, Bertha. Es geht um die Verteilung der ›Liebesgaben‹. Ich hab ihr gesagt, sie soll am Mittwoch bei dir hereinschauen, wenn sie das nächste Mal wieder in London ist.«
Aus irgendeinem Grund versetzte diese Ankündigung Mrs. Conyers in einen Zustand großer Verwirrung.
»Aber ich kann Lady Sleaford am Mittwoch unmöglich sehen«, sagte sie. »Ich hab drei Komiteesitzungen an diesem Tag; und Aylmer möchte, dass fünf serbische Offiziere zum Tee herkommen. Außerdem ist Lady Sleaford Red Cross; wie du, Liebes – und du erinnerst dich, dass ich durch Lady Bridgnorth sehr eng mit den Maltesern verbunden bin. Weißt du, ich kenne Lady Sleaford doch kaum. Sie hält sich immer so sehr für sich, und ich möchte gegenüber Mary Bridgnorth nicht illoyal erscheinen. Ich –«
Ihre Schwester schnitt ihr das Wort ab.
»Ach ja, was für ein verflixter Mist«, bemerkte sie. »Ich hatte das mit den ekelhaften alten Maltesern ganz vergessen. Die sind aber auch überall dabei. Ich bin fest davon überzeugt, die hindern uns mehr daran, den Krieg zu gewinnen, als die Deutschen.«
Nach dieser alarmierenden Vermutung schritt sie schnell im Zimmer auf und ab und stieß dabei lange Wirbel von Qualm aus ihren Nasenlöchern – der Rauchfahne eines Schiffes gleich, das flott am Horizont entlangzieht. Mir wurde in wachsendem Maße bewusst, dass eine sich verhärtende Missbilligung das Zimmer erfüllte – schon unmittelbar nach Miss Blaides’ Ankunft, vielleicht soeben erst wahrnehmbar, doch jetzt überhaupt nicht mehr abzuleugnen. Ja, ein Gefühl eindeutiger Unbehaglichkeit fegte so kraftvoll durch den kleinen Salon, dass sich stummer Tadel in einer dicken Wolke über den ›Liebesgaben‹ zu erheben schien, bis ihr verwirrender Geruch die Decke erreichte und in ärgerlichen, unwiderstehlichen Wellen über der ganzen Wohnung hing. Diese Missbilligung zeigte sich nicht nur bei Mrs. Conyers, sondern – das fühlte ich ganz deutlich – auch bei meiner Mutter, die nun Anstalten traf zu gehen.
»Ein blöder Mist«, sagte Miss Blaides und warf ihren Zigarettenstummel in den offenen Kamin, wo er glimmend auf den Kacheln liegenblieb. »Das ist es doch. Ich werd Molly also wohl sagen müssen, dass es ’ne Pleite ist. Gib mir noch ’ne Tasse Tee, Bertha. Ich kann nicht allzu lange bleiben. Ich hab vor, mich heute Abend in meine beste Kluft zu schmeißen, und dann geht’s ab in eine Show.«
Danach verabschiedeten wir uns, meinerseits mit tiefem Bedauern. Später im Zug sagte meine Mutter: »Es ist doch schade, dass ein Mädchen wie Miss Blaides so viel Make-up auflegt und so viel Slang spricht. Dennoch, es war sehr interessant, sie kennenzulernen. Ich hatte von verschiedenen Leuten so viel über sie gehört.«
In meiner Antwort erwähnte ich es nicht, aber Miss Blaides war mir, um die Wahrheit zu sagen, als eine ausgesprochen romantische Gestalt erschienen, bei der sich die Krankenpflegefunktion einer jungen Florence Nightingale mit etwas weit Erregenderem und vielleicht auch leicht Bedrohlichem verband. Ich war mir damals auch nicht der tieferen Bedeutung bewusst, die der Ausdruck ›viel über jemanden gehört haben‹ beinhaltet, wenn er sich auf eine Person von Miss Blaides’ Alter und Art bezieht. Doch die Episode insgesamt – die Wohnung der Conyers’, die Fotografie des Generals, der juwelenbesetze Krummsäbel, die überall im Zimmer aufgestapelten ›Liebesgaben‹, Miss Blaides in ihrer Uniform des Freiwilligen Hilfsdienstes – machte einen lebhaften Eindruck auf mich; allerdings traten diese Dinge, wie es nur natürlich ist, bald in den entfernten Hintergrund meines Gedächtnisses zurück und schienen vergessen. Erst spätere Ereignisse belebten sie wieder mit kräftigen Farben.
An jenem Nachmittag hörte ich auch zum ersten Mal von Dogdene. Wenn später Leute darüber sprachen, wusste ich natürlich, dass es sich um den Namen eines ›großen Hauses‹ handelte. Es spielte in verschiedenen Memoirenbänden eine Rolle, etwa in dem von Lady Amesbury, den ich (mit einiger Enttäuschung) in einem frühen Alter las, nachdem ich gehört hatte, wie ein Erwachsener das Buch als ›unflätig‹ beschrieb. Ich kannte auch Constables Bild in der National Gallery, das diesen Herrensitz von einer mittleren Entfernung aus gesehen darstellt: ein Märchenschloss zwischen riesigen Bäumen, jenseits der dunstigen Flusswiesen des Vordergrundes, auf denen die impastierten Rinder grasen – ganz anders, als man sich ein Militärkrankenhaus vorstellt. Ich kannte dieses Bild, lange bevor ich erfuhr, dass das Haus Dogdene war. Damals verband ich das Schloss in meinem Bewusstsein schon lange nicht mehr mit Miss Blaides. Mir war nur vage bekannt, dass die Besitzer Sleaford hießen.
Eines Tages dann, viele Jahre später, erinnerte mich ein zufälliger Hinweis auf Dogdene wieder an Miss Blaides in ihrer ursprünglichen Verkörperung eines Mitglieds des Freiwilligen Hilfsdienstes – ein Status, der sozusagen verborgen und vergessen war wie die Überreste einer frühen Kultur, die von einem wachsenden Komplex späterer architektonischer Ablagerungen verdeckt werden. Das war so trotz der Tatsache, dass der Name Mildred Blaides manchmal nach den gelegentlichen Begegnungen zwischen meinen Eltern und General Conyers oder seiner Frau in Gesprächen aufzutauchen pflegte. Wenn in solchen Unterhaltungen über sie gesprochen worden war, hatte ich sie mir immer als eine irgendwie andere Person als das den Kriegszeit-Slang plappernde Mädchen jenes Winternachmittags vorgestellt. Eigentlich kam mir das ursprüngliche Bild Miss Blaides erst an einem Morgen wieder ins Gedächtnis zurück, an dem ich in der cremefarbenen, neonbeleuchteten, nackten, aseptischen, grellen, trostlosen, kleinen Zelle in dem Filmstudio saß. An diesem Ort konnte einen leicht tiefe Verzagtheit erfassen. Manchmal unter künstlich erhöhtem Druck zu leistende Arbeit wechselte mit Zeitabschnitten, in denen ein chaotisches Nichts herrschte. Umgeben von den Albernheiten und Missverständnissen der Filmwelt fand ich während solcher Perioden bei verhältnismäßig realistisch angelegten Büchern einen gewissen Trost in meiner Verzweiflung.
Während einer dieser Zwischenzeiten der Muße las ich in einem Band des Tagebuchs von Samuel Pepys und entdeckte, dass er einmal Dogdene besucht hatte. Aus einer Anmerkung ging hervor, dass sein Gönner, Lord Sandwich, mit der damaligen Gräfin Sleaford – das Marquisat datiert erst von der Krönung Williams iv. – durch Heirat verschwägert war.
»Dann gegen Mittag erreichten wir Dogdene, woselbst es mich gar sehr gelüstete, das Schloß zu sehen, und jenen neuerbaueten Theil, worvon Dr. Wren zuvor mit mir gesprochen und mir gesagt, es sei eines der ersten Schlößer Englands, die als Sitz eines Adelsmannes geplant, und nicht mehr als Wasserburg für die Kriegsführung. Lord Sleaford weilet noch in London, wo man sagt, daß er Lady Castlemaine den Hof mache, worüber der König nicht wenig verärgert ist, obwohl man annimmt, daß sie schon lange seine Gunst verloren. Der Kastellan war überaus gütig und zeigete uns die Große Halle und die prächtigen Galerien und das Bild von P. Veronese, das ihrer Lordschaft Großvater aus Italien mitgebracht, ein gar exzellentes, vortreffliches Stück. Dann in die Gärten und Gewächsstuben, woselbst es mich sehr verwunderte, wie empfindlich die Sinnpflanze reagiret. Danach in die Vorrathskammer, in welcher ein großes, dunkles Hausmädchen mir ein köstlich Glas Honigwein kredenzt. Ich scherzete ein wenig mit ihr und bat sie, mir das bemalte Kabinett zu zeigen, worvon der Kastellan gesprochen, das wir aber noch nicht gesehen. Das kecke Weibsbild führte mich auch bereitwillig dorthin, woselbst ich sie zwei- oder dreimal küßte und lose mit ihr schäkerte. Ich merkte, daß sie mir gewißlich nicht verwehren würde, qui je voudray, doch war ich ängstlich und es mangelte an Zeit. Später besorgete ich aber, sie möchte darüber sprechen und ihre Gefährten sich über mich belustigen, wenn wir uns wieder auf unseren Weg gemacht.«
Jeder Mensch kennt das Phänomen, dass manchmal ein bestimmter Name mehrere Male in schneller Reihenfolge und von verschiedenen Seiten erwähnt wird. Das ist Teil jener unerklärlichen, das ganze Leben durchziehenden Kraft, die uns dazu bringt, plötzlich an jemanden zu denken, ehe wir um die Straßenecke biegen und ihm oder ihr von Angesicht zu Angesicht begegnen. Auf ähnliche Weise fallen einem beim Lesen eines Buches eine obskure Stelle oder obskure Zeilen eines Gedichtes auf, nur um sie vierundzwanzig Stunden später ganz unerwartet wieder zitiert zu finden. Der Zufall wollte es, dass ich bald nach meiner Lektüre von Pepys’ Bericht über Dogdene mit Chips Lovell, einem weiteren Drehbuchautor, zusammenarbeiten musste. Dabei ergab sich die Frage, ob in einem Szenario ein Landhaus erscheinen solle.
»Meinst du ein Haus wie Dogdene?«, fragte ich.
»So etwas Ähnliches«, sagte Lovell.
Nicht ohne berechtigte Genugtuung erklärte er mir dann, seine Mutter, die Schwester des gegenwärtigen Lord Sleaford, sei dort aufgewachsen.
Das geschah während jenes Abschnitts in meinem Leben, als ich zwei Romane geschrieben hatte und von einer Firma, die Kunstbücher publizierte, zu einer Gesellschaft, die Beifilme produzierte, übergewechselt war. Für einen Autor galt diese letztere Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu jener Zeit als etwas ganz Natürliches, ja, der zeitweilige Dienst als Drehbuchschreiber wurde fast als eine Pflichtphase im Leben eines Schriftstellers angesehen. Lovells Erscheinen in dem Studio hatte dagegen über einen gewundeneren Weg geführt. Neben einer exzellenten persönlichen Erscheinung und einer großen Portion Unverfrorenheit bestand sein hauptsächliches Rüstzeug in seiner großen Fähigkeit, eine gewaltige Horde von Verwandten zu manipulieren. Weit mehr am Tagesjournalismus als am Verfassen von Drehbüchern interessiert, richtete sich sein ganzes Begehren darauf, für die Klatschspalte einer Zeitung zu schreiben. Ich war mit Sheldon, einem Redakteur der Abendzeitung, auf die Lovell es abgesehen hatte, flüchtig bekannt und hatte versprochen, wenn eben möglich eine Begegnung zwischen den beiden zu arrangieren.
Es bereitete Lovell großes Vergnügen, über seine Verwandtschaft zu sprechen. Seine Eltern waren wegen des Widerstandes der Familie gegen ihre Heirat durchgebrannt. Es war nicht genug Geld da gewesen. Lovell Senior, »nicht ganz ohne Freunde in hohen Stellen«, wie Onkel Giles gesagt hätte, war Maler. Seine faden, nicht völlig bedeutungslosen kleinen Landschaften im Stile der Barbizon-Schule ließen sich außerhalb seines eigenen Freundeskreises nie verkaufen. Dem Paar wurde bald vergeben, aber Lovell junior war fest entschlossen, selbst nie in eine solche Lage zu geraten. Er wollte im Leben vorankommen, sagte er, und in einigen Jahren ›eine gute Partie‹ machen. Bis dahin sah er sich um und amüsierte sich, soweit seine Arbeit ihm das erlaubte. Da es damals für junge Männer nur sehr wenige Jobs gab, hatten ihn seine – ganz beträchtlichen – Energien vorübergehend ins Filmgeschäft geführt, für das er nach allgemeiner, auch von ihm selbst geteilter Auffassung kein besonderes Talent besaß. Irgendetwas Besseres würde sich ergeben. Es blieb ein Geheimnis, wie er es überhaupt geschafft hatte, in diesen überlaufenen Beruf hineinzukommen. Unser Kollege Feingold ließ durchblicken, dass die amerikanischen Bosse der Firma davon träumten, irgendwelche berauschenden gesellschaftlichen Vorteile daraus ziehen zu können, dass sie einen akzeptablen jungen Mann solcher Herkunft beschäftigten. Feingold mochte recht gehabt haben; allerdings war er nicht frei von einer Spur jüdischer Romantik. Ohne Zweifel wäre es einem schwergefallen, sich irgendwelche Phantasien vorzustellen, und seien sie noch so außergewöhnlich, denen sich diese hohen Manager nicht hingegeben hätten.
An einem Abend nicht lange nach unserem Gespräch über Dogdene war ich zusammen mit Lovell, Feingold und Hegarty widerwillig länger als gewöhnlich in dem Studio geblieben. Wir bemühten uns, eine jener ›Bearbeitungen‹ eines Filmstoffes zu Ende zu bringen, deren Ödheit nur von denen wirklich beurteilt werden kann, die Erfahrung darin haben, wie sie zusammengebraut werden. An diesem besonderen Abend litt Feingold, der einen malvenfarbenen Anzug und eine karmesinrote Krawatte trug, unter einem unüblichen Anfall von Depressionen. Er war verhältnismäßig kurze Zeit vorher aus dem Schneideraum aufgestiegen – zuerst voller Enthusiasmus für diese neue Sparte seines Gewerbes. Die rosafarbene Haut seines vollen, runden Gesichts hing jetzt schlaff herab und bildete Beutel um sein bläuliches Kinn herum, während er sich auf seinem Stuhl zurücklehnte, einen enormen Stapel bekritzelter Papierbögen vor sich. Er sah aus wie ein farbenfrohes Plakat, das Mitleid für die Leiden seines Volkes wecken soll. Auch Hegarty war an diesem Tag in schwacher Form. Er hatte – inzwischen mit drei, wenn nicht vier Frauen belastet, an die alle er Alimente zahlte – den größten Teil seines Erwachsenendaseins als Drehbuchautor verbracht und besaß, wenn er einigermaßen nüchtern war, eine außerordentliche Geschicklichkeit im Konstruieren von Filmszenarios. An diesem Tag konnte man ihn nicht als einigermaßen nüchtern bezeichnen. Er hatte den ganzen Nachmittag über stöhnend in der Ecke des Zimmers gesessen und die Wand angestarrt. Wir bearbeiteten ein Theaterstück, das zwanzig oder dreißig Jahre zuvor drei Wochen lang im Londoner Westend gelaufen war und dessen Banalität einem Regisseur die Überzeugung vermittelt hatte, es ließe sich ein Film daraus machen. Dies war die neunte Bearbeitung, die wir gemeinsam produziert hatten. Schließlich brach Hegarty zum dritten Mal innerhalb einer Stunde in kalten Schweiß aus. Er nahm das Aspirin jetzt dutzendweise. Wir beschlossen, die Arbeit für den Tag zu beenden.
Lovell und ich wechselten uns immer darin ab, wer von uns sein Auto (beide Fahrzeuge waren von bescheidenem Aussehen) zum Studio mitzubringen hatte. An jenem Abend war Lovell an der Reihe, mich nach Hause zu fahren. Wir verabschiedeten uns von Feingold, der Hegarty zur Kneipe am Ende der Straße schleppte. Lovell hatte zwölfeinhalb Pfund für sein Auto bezahlt. Er setzte es jetzt in Gang, allerdings mit Mühe. Ich kletterte auf den Sitz neben ihm. Wir fuhren durch den Dunst in Richtung London. Blaugraue Wolkentaschen trieben unheilvoll vom Fluss herauf.
»Sollen wir zusammen zu Abend essen?«
»Gut. Aber lass uns irgendwo hingehen, wo es billig ist.«
»Da bin ich auch sehr dafür«, sagte Lovell. »Warst du schon mal bei Foppa’s?«
»Ja, aber lass uns da nicht hingeben.«
Obwohl die Sache mit Jean schon seit einiger Zeit ›zu Ende‹ war, schien mir Foppa’s Restaurant doch noch irgendwie zu sehr mit Erinnerungen an sie befrachtet, als dass ich mich dort völlig wohl gefühlt hätte; und ich war der festen Überzeugung, dass ich selbst dem geringsten Rest von Nostalgiegefühlen für die unmittelbare Vergangenheit besser aus dem Wege gehen sollte.
Was ich jetzt brauchte, war ein erfrischender Blick in die Zukunft, nicht vergebliches Bedauern. Ich gratulierte mir zu der Fähigkeit, die Sache in einem so forschen Licht zu sehen. Lovell und ich einigten uns auf ein Restaurant und kamen dann auf die Frage zurück, ob Sheldon in der Lage sein würde, Lovell den Job in genau dem richtigen Augenblick anzubieten, nämlich wenn sein Vertrag mit der Filmgesellschaft auslief, nicht vorher und auch nicht zu lange danach.
»Ich werde nach dem Essen eine Tante besuchen«, sagte Lovell, schließlich müde, über seine eigenen Berufsaussichten zu sprechen. »Warum kommst du nicht mit? Es sind immer Leute da. Selbst wenn nichts los ist, es gibt zumindest was zu trinken. Wenn ein paar hübsche Mädchen da sind, können wir nach Schallplatten tanzen.«
»Warum glaubst du, dass hübsche Mädchen da sein werden?«
»Bei Tante Molly kannst du alles Mögliche finden, selbst hübsche Mädchen. Kommst du mit?«
»Sehr gern.«
»Es ist aber leider in South Kensington.«
»Macht nichts. Erzähl mir von deiner Tante.«
»Sie heißt Molly Jeavons. Früher hieß sie mal Molly Sleaford, weißt du.«
»Ich wusste es nicht.«
Da ich mir sicher war, dass Lovell mir sehr gerne weitere Informationen geben würde, fragte ich ihn aus. Er besaß jenen tiefen Sinn für Familienbeziehungen und ihre Verzweigungen, der eine ungewöhnliche Gabe ist – wie die Musikalität oder der Instinkt für den Wert von Pferden oder Juwelen. Lovell selbst zog starken Nutzen aus dieser Gabe; sehr häufig aber fällt dieses Talent Menschen zu, die nicht das Geringste um einen persönlichen gesellschaftlichen Aufstieg geben, während es ebenso oft Personen abgeht, die von der Welt zu Recht als snobistisch angesehen werden. Lovell, der fast genauso sehr an der Familie jedes anderen interessiert war wie an seiner eigenen, konnte einem darlegen, wie die verschiedensten Menschen in Wirklichkeit sehr eng miteinander verwandt waren.
»Als mein erster Sleaford-Onkel starb«, sagte er, »heiratete seine Witwe, Molly, einen Mann namens Jeavons. Kein schlechter Kerl, überhaupt nicht, obwohl er aus einem ziemlich glanzlosen Milieu kommt. Man kann ihn auch nicht als besonders intelligent bezeichnen, trotz der Tatsache, dass er ganz gut Billard spielt. Er ist nicht gerade der Vitalsten einer, ehrlich gesagt. Molly dagegen ist ein richtiges Energiebündel.«
»Wo kommt sie her?«
»Sie ist eine Ardglass.«
»Ist sie mit Bijou Ardglass verwandt?«
»Ihre Schwägerin – bevor Jumbo Ardglass sich von Bijou scheiden ließ, die natürlich seine zweite Frau war. Kennst du sie? Du hast wahrscheinlich mit ihr geschlafen? Das haben die meisten meiner Freunde.«
»Ich hab sie nur hin und wieder mal gesehen. Sonst keine Privilegien.«
»Natürlich. Du wärst auch nicht reich genug für Bijou«, sagte Lovell in einem nicht unfreundlichen Ton. »Aber wie gesagt, Bijou brachte das, was von dem Geld der Ardglass noch übrig war – es war nicht viel –, durch und verließ Jumbo, der selbst inzwischen auch genug hatte. Seitdem ist sie die Begleiterin von einer ganzen Reihe von Leuten gewesen – Prinz Theodoric, Gott weiß wer noch. Sie kommt aber, glaube ich, immer noch und besucht Molly. Molly ist so. Sie weist nie jemanden zurück.«
»Aber warum nennst du ihn deinen ›ersten‹ Sleaford-Onkel?«
»Weil er gestorben ist und ich noch immer einen Onkel namens Lord Sleaford habe – der gegenwärtige heißt Geoffrey, der erste hieß John. Onkel Geoffrey war zu arm, um zu heiraten, ehe er den Titel erbte. Er konnte sich nur so eben in einem der billigeren Kavallerieregimenter über Wasser halten. Es gab noch zwei weitere Brüder zwischen ihm und dem Titel. Der eine ist im Krieg gefallen, der andere wurde von einem Bus überfahren.«
»Es scheint nicht gerade ihre starke Seite zu sein, am Leben zu bleiben.«
»Das Problem bei den Sleafords ist«, sagte Lovell, »dass sie immer so wild auf der Primogenitur bestanden haben. Einerseits ist das ja auch ganz in Ordnung, aber sie sind so verdammt knauserig gegenüber ihren Witwen und jüngeren Kindern gewesen, dass sie aussterben werden. Sie sind ein glänzendes Beispiel für den Geiz der Oberklasse. Geoffrey hat dann sofort geheiratet – wie Leute das gewöhnlich tun, wenn sie einen solchen Titel erben, so ärmlich das damit verbundene Vermögen auch sein mag. Natürlich, in diesem Fall – mit Dogdene als Zugabe – lohnte es sich schon, ihn zu haben. Unglücklicherweise aber ist es ihnen nicht gelungen, einen Erben zu produzieren.«
Dann beschrieb mir Lovell seinen »ersten Sleaford-Onkel«, der ein frostiger, ernsthafter, fähiger Lord gewesen zu sein scheint, ein großer Organisator karitativer Institutionen, der in jeder sozialen Schicht seinen Weg gemacht hätte. Eine Zeitlang hatte er sich der Politik gewidmet und unter den Premierministern Campbell-Bannerman und Asquith Regierungsämter innegehabt.
»Er trat während des Marconi-Skandals zurück«, sagte Lovell. »Nicht, dass er dabei irgendwie auch etwas für sich auf die Seite gebracht hätte; aber er meinte, einige seiner Kollegen von den Liberalen seien in der Ethik ihrer eigenen Finanzgeschäfte ein bisschen zu liberal gewesen. Er war ein selbstsüchtiger alter Mann, doch er besaßdas, was man ein übertriebenes Ehrgefühl nennt.«
»Ich glaube, ich habe Isbisters Porträt von ihm gesehen.«
»In der Robe des Hosenbandordens. Er nahm sich selbst ganz schön wichtig. Molly hat ihn vom Ballsaal weg geheiratet. Sie war erst achtzehn. Hatte noch nie vorher einen Mann gesehen.«
»Wann ist er gestorben?«
»1919, an der Spanischen Grippe«, sagte Lovell. »Molly ist Jeavons zum ersten Mal begegnet, als Dogdene während des Krieges ein Lazarett war. Er war ziemlich schwer verwundet, weißt du. Das Erstaunliche ist, dass sie damals überhaupt nichts miteinander hatten. Wäre Onkel John nicht gestorben, wäre sie immer noch – in den Worten eines Songs vom Anfang des Jahrhunderts, den mein Vater immer summt, wenn ihr Name erwähnt wird – ›Molly die Marquise‹.«
»Wo ist sie dann ihrem zweiten Mann wieder begegnet?«
»Auf der Automobilausstellung. Sie ist in ihrer Trauerkleidung nach Olympia gegangen und sah da Jeavons wieder. Er arbeitete dort als Polierer an einem der Stände. Ich hab vergessen, welche Marke, aber es war sicher kein Auto, auf dessen Besitz irgendjemand stolz sein würde. Das stellte so ungefähr das Höchste dar, das er im Zivilleben erreichen konnte. Sechs Monate später haben sie geheiratet.«
»Wie läuft es zwischen ihnen?«
»Sehr gut. Molly scheint ihrer Zeit auf Dogdene nicht im Geringsten nachzutrauern. Ich bezweifle, dass sie viel Geld haben, denn wie ich die Sleafords kenne, ist das, was sie ihr als Witwenrente zahlen, nicht sehr hoch – und ich glaube nicht, dass sie hundert Pfund pro Jahr an eigenem Geld hat. Seit dem Irischen Ländereiengesetz ist die Familie Ardglass hoffnungslos insolvent. Dennoch, irgendwie schafft sie es, sich – und Jeavons – über Wasser zu halten. Und auch Spaß am Leben zu haben.«
»Steuert Jeavons denn nichts bei?«
»Keinen Pfennig. Ich glaube, die meiste Zeit fühlt er sich ziemlich krank. Er sieht oft aus wie der Tod persönlich. Außerdem ist er für eine geregelte Arbeit ganz ungeeignet. Es stimmt eigentlich nicht ganz, dass er nichts tut. Gelegentlich hat er irgendeine Sache, mit der er Handel treibt – einen automatischen Stiefelknecht oder ein neues Schnupfenmittel. Etwas, für das er eine Provision kriegt oder für das ihm vielleicht eine Firma eine kleine Summe bezahlt, damit er das Ding empfiehlt.«
Die Beschreibung erinnerte mich ein wenig an Onkel Giles. Mein Bild von Jeavons nahm festere Umrisse an – sie waren nicht besonders attraktiv. »Eine gute Herkunft macht realistisch«, pflegte Lovell zu sagen, und was seine eigenen Verhältnisse anging, bewies er selbst auch sicherlich diese Qualität. Es mag vielleicht schwer sein, die Allgemeingültigkeit seiner Feststellung zu beweisen, aber durch die Anerkennung von Verhaltensgesetzen, die innerhalb des Mikrokosmos eines großen Netzwerks miteinander verwandter Familien, wie lose es auch immer geknüpft sein mag, wirksam sind, gewinnt der Einzelne, der in eine solche Welt hineingeboren wird, ein unsentimentales Verständnis menschlichen Betragens – ein Verständnis, das manchmal dem scharfsichtigerer Personen, deren Geist nicht durch frühen Umgang auf das dauernde Geben und Nehmen eines alten und zählebigen gesellschaftlichen Organismus eingestimmt wurde, überlegen ist. Natürlich, das trifft nicht immer zu, aber Lovell mit seinen vielen Schwächen repräsentierte selbst ein gutes Beispiel für das Prinzip.
»Der eigentliche Grund, warum ich Tante Molly besuchen will«, sagte er, »ist, dass ich mir Priscilla Tolland noch mal ansehen will. Sie kommt ziemlich oft dorthin.«
»Eine Schwester von Blanche Tolland?«
»Ja. Kennst du Blanche?«
»Nur vom Sehen. Und das war vor Jahren. Sie ist ein wenig spleenig, nicht wahr?«
»Sehr spleenig«, sagte Lovell. »Sie lebt in einer völlig eigenen Welt. Ist aber ziemlich glücklich dabei, glaube ich.«
»Es gibt noch eine Tolland, Norah, nicht wahr? Sie lebt mit einem ziemlich seltsamen Mädchen zusammen, das ich früher mal kannte. Es heißt Eleanor Walpole-Wilson.«
»Genau. Sie ist auch ein wenig spleenig, aber auf eine andere Art. Man sagt, die beiden seien eine ménage. Dann ist da noch Isobel. Die ist ganz anders. Priscilla ist die Jüngste. Sie ist eigentlich noch nicht ›eingeführt‹.«
Ich war damals etwa achtundzwanzig oder neunundzwanzig, Lovell dagegen dreiundzwanzig oder vierundzwanzig; und durch ihn war mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass mir eine jüngere Generation dicht auf den Fersen folgte. Ich sagte ihm, ich fühlte mich viel zu alt und passé, um mich noch für so grünes Gemüse wie junge Damen zu interessieren, die noch nicht ›eingeführt‹ seien.
»Ja, das sehe ich wohl ein«, sagte Lovell nachsichtig. »Es werden aber bestimmt auch ältere Personen da sein, für Burschen wie dich, die lieber ernsthafte Gespräche führen. Vielleicht magst du Isobel. Ich glaube, sie ist so etwas wie eine Intellektuelle, wenn sie nicht gerade in Nachtclubs geht.«
Wir fuhren holprig die Gloucester Road hinunter. Das Auto stieß ein langes, furchterregendes Knattern und bösen Qualm aus, während Lovell mir offen seine langfristigen Pläne darlegte, wie er Priscilla Tolland zu verführen gedachte. Irgendwo in der Nähe der Ubahnstation bogen wir ab. Mir gefiel die Vorstellung, für vielleicht eine Stunde zu diesem unbekannten Haus zu fahren, wo die freudlose Atmosphäre des Studios möglicherweise weggespült werden würde. Lovell hielt vor einem ziemlich großen, dunkelroten Backsteinhaus, das entfernte, nicht besonders ermutigende Anklänge an die Hochrenaissance aufwies. Nachdem wir einige Zeit auf der Stufe vor der Haustür gewartet hatten, wurde uns von einem Mann unbestimmten Alters in Hemdsärmeln und Pantoffeln geöffnet. Er stellte wohl so etwas wie einen Butler dar. Von blassem, ungesunden Aussehen, erweckte er den Eindruck eines Menschen, der monatelang in ungelüfteten, überheizten Räumen unter der Erde verbracht hatte. Er zog die Dünste von Bier und Käse hinter sich her. Bei genauer Betrachtung dieses ungepflegten, übellaunigen Kerls zeigte es sich, dass er älter war, als es auf den ersten Blick den Anschein gehabt hatte.
»Guten Abend, Smith«, sagte Lovell ein wenig großspurig.
»’n Abend«, sagte Smith ohne die geringste Spur von Wärme.
»Wie geht es Ihnen, Smith?«
Smith sah Lovell von oben bis unten an, als ob er die Frage nicht nur für bloß dümmlich, sondern auch für ausgesprochen beleidigend halte. Er gab keine Antwort.
»Ist ihre Ladyschaft oben?«
»Wo soll sie denn sonst sein – im Souterrain?«
Der Ton von Smiths Stimme ließ nicht die geringste Andeutung eines Versuchs erkennen, die Schärfe dieser Erwiderung zu mildern. Lovell schien nicht im Mindesten überrascht über einen so bissigen Empfang und überspielte diese unfreundliche Antwort mit einem herzhaften Lachen. Smith schlurfte davon. Er murmelte vor sich hin, während er die Treppe hinunterging. Er schien alles völlig satt zu haben. Nicht nur Lovell, auch seinen eigenen Job.
»Smith ist wundervoll, nicht wahr?«, sagte Lovell, während wir die Treppe hinaufstiegen. »Tante Molly borgt ihn manchmal von Erridge aus, wenn Thrubworth aus irgendeinem Grund zugemacht wird. Ich muss dich warnen, dass auf der Toilette unten immer die Glühbirne fehlt und manchmal auch das Papier.«
Ich folgte ihm in einen Doppelsalon im ersten Stock, in dem acht oder neun Personen herumstanden oder -saßen. Von der Einrichtung ging, noch unterstützt durch eine Fülle orientalischer Schalen und Krüge, ein allgemeiner, allerdings nie präzise bestimmbarer Eindruck von Chinoiserie aus. Einige der Möbelstücke waren offensichtlich sehr wertvoll, der Rest ziemlicher Plunder. Die Gemälde waren von ähnlich unterschiedlicher Qualität. Ein Richard Wilson und ein Greuze (diese bemerkte ich erst später) hingen zwischen Pastellbildern marokkanischen Typs. Eine dunkelhaarige, hübsche, gemessen an dem abgemagerten Schönheitsideal der Zeit leicht rundliche Frau kam auf uns zu.
»Na, Chips«, sagte sie, »da bist du ja endlich. Wir dachten, du würdest früher kommen.«
»Ich konnte mich nicht eher freimachen, Tante Molly«, sagte Lovell. »Das ist Mr. Jenkins. Er und ich plagen uns zusammen beim Drehbuchschreiben ab.«
»Was möchtet ihr trinken«?, fragte sie. »Teddy, hol schnell was zu trinken. Sie haben es sicher bitter nötig.«
Sie lächelte mich an, als sei sie ziemlich stolz auf diese letzte Formulierung. Jeavons erschien jetzt bei uns und machte einige eher hoffnungslose Gesten in Richtung auf verschiedene Flaschen und Karaffen, die auf einem Tisch am hinteren Ende des Zimmers standen. Es war sofort ganz offensichtlich, dass er ein Relikt des vergangenen Krieges war. Ich fand es fast unmöglich zu glauben, dass er dem Bild, das Lovells Beschreibung von ihm in meiner Vorstellung heraufbeschworen hatte, so sehr glich. Wie eines jener Mammuts – oder, im Falle Jeavons’ eine der etwas weniger gigantischen Formen urzeitlichen Lebens –, die, in einem Gletscher gefangen, körperlich intakt in eine Zeit herübergerettet wurden, in der ihre Art nur noch durch versteinerte Knochen oder durch Zeichnungen an den Wänden unterirdischer Höhlen bekannt ist, hatte er es irgendwie geschafft, noch genauso auszusehen, wie er 1917 ausgesehen haben musste – kaum einen Tag älter. Vielleicht wäre aber auch das Bild eines in Bernstein eingeschlossenen seltenen Insekts ein besserer Vergleich, um den Eindruck des Abgesondertseins zu verdeutlichen, den er erzeugte, wie er dort so stand, mit einem leeren Ausdruck auf dem Gesicht und seinen Händen in den Taschen. Er trug einen winzigen Charlie-Chaplin-Schnurrbart, und sein dunkles, glänzendes Haar, in dem sich eine Spur Rot zeigte, rollte von seiner Stirn weg wie die Steinlocken auf dem Kopf einer Skulptur Caracallas.
In diesem Augenblick wurde mir plötzlich bewusst, dass mir zumindest einer der anwesenden Gäste bereits bekannt war, nämlich Mrs. Conyers, die alte Freundin meiner Familie. Ich hatte sie in letzter Zeit zwar nicht mehr gesehen, aber wir waren uns seit jenem fernen Tag, als meine Mutter mich mit in ihre Wohnung genommen und sie mir den Krummsäbel gezeigt hatte, doch hin und wieder begegnet, gewöhnlich in Abständen von mehreren Jahren. Die letzte Gelegenheit war die Hochzeit ihrer Tochter Charlotte mit dem Korvettenkapitän gewesen. Mrs. Conyers hatte offensichtlich bei den Jeavons diniert. Sie schien sie jedoch nicht gut zu kennen und war, vielleicht weil sie sich in ihrer Gesellschaft nicht besonders wohl fühlte, sichtlich erleichtert, in mir jemanden zu finden, den sie schon lange kannte. Ich dagegen war mir gar nicht so sicher, dass ich mich ebenfalls freute, denn obwohl ich Mrs. Conyers sehr mochte, zog ich es doch vor, neues Terrain wie das Haus der Jeavons unbeobachtet von alten Freunden meiner Eltern zu erkunden. Allerdings hätte nichts weniger ermahnend sein können als Mrs. Conyers’ Betragen mir gegenüber – wenn denn Ermahnung richtig als die Haltung definiert ist, die einem, wenn man jung ist, durch die Gegenwart alter Familienfreunde droht.
In Mrs. Conyers’ Erscheinung hatte sich, ohne Zweifel von ihrer Kindheit her, der gehetzte, unsichere Ausdruck von Menschen erhalten, die über viele Jahre hin die enge Gegenwart von Personen zu ertragen haben, für die es zwanghaft geworden ist, Streiche zu spielen. Wie ihre Schwestern muss sie in einem nicht geringen Maß unter der Vorliebe ihres Vaters für derbe Scherze gelitten haben. Sie war eine von sechs Töchtern, und ihre Eltern hatten sich bereits damit abgefunden, dass sie ›sitzengeblieben‹ sei, als der General ihr den Heiratsantrag machte. Sie hatte wahrscheinlich selbst schon jeden Gedanken an die Ehe aufgegeben, denn sie widmete inzwischen den größten Teil ihrer Zeit der Gesellschaft einer älteren, eigensinnigen Verwandten, Sybil, Lady Amesbury, deren Memoiren ich bereits erwähnt habe. Eine der ›Heldentaten‹ von Mrs. Conyers’ Vater ist in diesem Buch erwähnt, nämlich die Geschichte, wie Lord Vowchurch in seinen jüngeren Jahren ein halbes Dutzend Affen in Fracks und weißen Schleifen auf einem Botschaftsball losließ – ein zufälliges Überbleibsel aus einer großen Zahl ähnlicher Anekdoten, die der Vergessenheit anheimgefallen sind.
Obwohl nie eigentlich hübsch, hatte Mrs. Conyers doch das Aussehen trauriger Vornehmheit. In der Öffentlichkeit unterwarf sie sich dem Urteil ihres Gatten; aber es war bekannt, dass sie durchaus einen eigenen Willen besaß, der sich in der fuchsartigen, fast nagetierähnlichen Form ihres Gesichtes verriet, das, an Lebhaftigkeit dem ihrer Schwester gleich, nicht unangenehm war. Man sagte, sie habe das Leben des Generals von Grund auf umgestaltet, nachdem er die Armee verlassen hatte, und zwar sehr zum Besseren hin. Als ich zu ihr hinüberging, um mit ihr zu sprechen, zog sie leicht die Augenbrauen hoch, was, wenn es auch nicht genau Missbilligung andeutete, doch zumindest ein heimliches Signal dafür war, dass sie sich hier nicht besonders heimisch fühlte. Die Botschaft besagte, dass sie jede Hilfe benötige, die sie bekommen könne.
Lovell hatte sich zu einem älteren Herrn mit rotem Gesicht und grauem Schnurrbart begeben, der wie Mrs. Conyers an dem Abendessen hier teilgenommen zu haben schien. Die Person hatte etwas seltsam Altweltliches an sich, das an eine Epoche denken ließ, die beträchtlich weiter zurücklag als die Kriegszeit, welche durch die äußere Erscheinung unseres Gastgebers vermittelt wurde. Obwohl nicht so alt wie General Conyers, schien sie, zumindest was den Geist betraf, mehr zu dem gleichen Jahrgang zu gehören wie dieser. Ich fing die Worte ›Onkel Alfred‹ auf. Lovell nannte so viele Männer ›Onkel‹, dass man nie sicher sein konnte, wie eng sie jeweils mit ihm verwandt waren. Dieser Onkel erwiderte Lovells Gruß ziemlich kurz angebunden. Es lag etwas Vertrautes in seinem roten Gesicht, dem weißen Schnurrbart und der gedämpften, unsicheren Art. Dann wurde mir bewusst, dass es sich um Tolland handelte, jene einsame verlassene Gestalt, die immer die jährlichen Essen der Ehemaligen von Le Bas’ Haus besuchte. Ich hatte bei einem dieser Treffen selbst einmal neben Tolland gesessen, damals nämlich, als ich mich dazu entschlossen hatte, nie wieder an einem weiteren teilzunehmen.