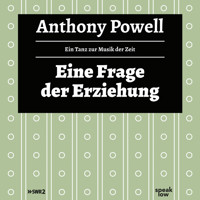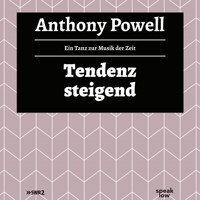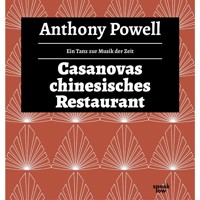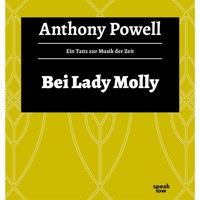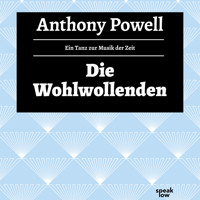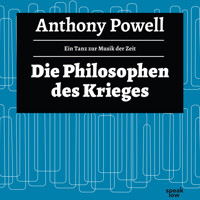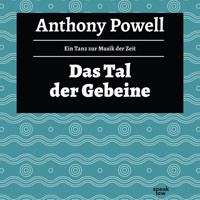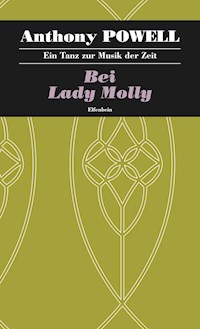Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Tanz zur Musik der Zeit
- Sprache: Deutsch
Der zwölfbändige Zyklus »Ein Tanz zur Musik der Zeit« — aufgrund seiner inhaltlichen wie formalen Gestaltung immer wieder mit Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« verglichen — gilt als das Hauptwerk des britischen Schriftstellers Anthony Powell und gehört zu den bedeutendsten Romanwerken des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von dem gleichnamigen Bild des französischen Barockmalers Nicolas Poussin, zeichnet der Zyklus ein facettenreiches Bild der englischen Upperclass vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten sechziger Jahre. Aus der Perspektive des mit typisch britischem Humor und Understatement ausgestatteten Ich-Erzählers Jenkins — der durch so manche biografische Parallele wie Powells Alter Ego anmutet — bietet der »Tanz« eine Fülle von Figuren, Ereignissen, Beobachtungen und Erinnerungen, die einen einzigartigen und aufschlussreichen Einblick geben in die Gedankenwelt der in England nach wie vor tonangebenden Gesellschaftsschicht mit ihren durchaus merkwürdigen Lebensgewohnheiten. So eröffnet Powell seinen »Tanz« in dem Band »Eine Frage der Erziehung« mit Szenen der Jugend: Jenkins in der Abschlussklasse des College, während eines Sprachaufenthalts in Frankreich sowie beim Five O'Clock Tea seines Universitätsprofessors. Der historische Hintergrund, hier die 1920er Jahre, scheint dabei immer wieder überraschend schlaglichtartig auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Powell
Eine Frage der Erziehung
Roman
Ein Tanz zur Musik der Zeit –Band 1
Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen vonHeinz Feldmann
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1951 unter dem Titel
»A Question of Upbringing« bei William Heinemann, London.
Band 1 des Romanzyklus »A Dance to the Music of Time«
A Question of Upbringing
©John Powell and Tristram Powell, 1951
© 2015 / 2016 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-76-3 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-36-7 (Druckausgabe)
1
Die Männer, die an der Ecke der Straße arbeiteten, hatten sich eine Art Lager aufgeschlagen, wo – durch rote, an dreibeinigen Ständern hängende Sturmlampen markiert – ein tiefes Loch in der Fahrbahn zu dem Netzwerk der unterirdischen Abwasserrohre hinabführte. Um den Eimer mit brennendem Koks vor dem Schutzzelt scharten sich mehrere Gestalten. Mit großen, pantomimischen Gebärden, wie Komiker, die durch Gesten die Vorstellung extremer Kälte vermitteln wollen, rieben sie sich die Hände und schlugen die Arme um ihre Körper. Einer von ihnen, ein hagerer Kerl in blauem Monteuranzug, größer als die übrigen, von spaßigem Gebaren und mit langer, spitzer Nase wie ein Shakespeare’scher Narr, trat plötzlich hervor und warf, als vollzöge er einen Ritus, einen Gegenstand – offensichtlich die lose in Zeitungspapier eingewickelten Reste zweier Bücklinge – auf die glühenden Kohlen. Die Flammen züngelten wild auf, und der Rauch drehte sich hoch in die Wirbel des Nordostwindes. Während der dunkle Qualm über die Häuser glitt, begann es leise aus einem trüben Himmel zu schneien, wobei jede der Flocken kurz aufzischte, wenn sie den Kokseimer erreichte. Die Flammen fielen wieder in sich zusammen, und die Männer wandten sich alle – so als ob die religiösen Pflichtverrichtungen für den Augenblick beendet seien – vom Feuer ab, ließen sich umständlich in die Grube hinab oder zogen sich in das Dunkel ihres Zeltunterstandes zurück. Der Schnee fiel weiter in grauen, zögernden, nicht sehr dichten Flocken, während ein scharfer Geruch bitter und gasig die Luft durchdrang. Der Tag neigte sich dem Ende zu.
Irgendwie weckt der Anblick von Schnee, der auf Feuer fällt, in mir immer Gedanken an die Welt der Antike: an Legionäre in Schafsfellen, die sich an einem Feuerkorb wärmen; an Bergaltäre, auf denen Opfergaben zwischen eisbedeckten Säulen glühen; an Zentauren, die Fackeln tragen und leicht an einem gefrorenen Meer entlanggaloppieren – an verstreute, unzusammenhängende Gestalten aus einer mythischen Vergangenheit also, die von dem gegenwärtigen Leben unendlich entfernt sind und die doch Erinnerungen an Reales und Erdichtetes mit sich bringen. Diese Projektionen aus klassischer Vergangenheit, aber auch etwas in der Körperhaltung der Männer selbst, als sie sich von dem Feuer abwandten, beschworen plötzlich die Szene des Gemäldes von Poussin, in der die Jahreszeiten, Hand in Hand und nach außen gewandt, zu der Musik der Leier tanzen, die der geflügelte, nackte Graubart spielt. Und diese allegorische Darstellung der Zeit weckte dann Gedanken an das irdische Leben: an die Menschen, wie sie, nach außen gewandt wie die Jahreszeiten, sich Hand in Hand in verschlungenem Rhythmus bewegen; wie sie langsam, methodisch und manchmal leicht unsicher schreiten in Wendungen, die erkennbare Formen annehmen, oder wie sie ausbrechen in wilde, scheinbar sinnlose Drehsprünge, während ihre Partner verschwinden, nur um dann wieder zu erscheinen und erneut dem Schaustück eine Struktur zu geben; wie sie unfähig sind, die Melodie, und unfähig vielleicht auch, die Schritte des Tanzes zu bestimmen. Die klassischen Assoziationen riefen aber auch Gedanken an die Zeit in der Schule in mir wach, wo so viele zuvor unvertraute Kräfte allmählich unerbittliche Klarheit angenommen hatten.
Wenn der Winter in jenes Flusstal vorrückte, stiegen gewöhnlich am späten Nachmittag die Nebel auf und streckten sich über das überflutete Gras, bis das Haus und all die Außenbezirke der Stadt eingehüllt waren in undurchsichtigen, frostigen, zigarrenrauchfarbigen Dunst. Das Haus sah auf andere mietskasernenähnliche Gebäude, die – Experimente in architektonischer Bedeutungslosigkeit – sich hineindrängten in den den Mittelpunkt bildenden Komplex eindrucksvoller, altertümlicher Bauten, die in vierseitigem, aber unregelmäßigem Stil angelegt waren. Angeschwemmte Rückstände der Jahre schwelten ungestört – und nicht ohne Melancholie – in dem rotbraunen Backsteingemäuer dieser mittelalterlichen Einfriedungen. Auch jenseits ihrer Kopfsteinpflaster und Bogengänge, mehr nach Norden hin, zwischen den Wiesen am Fluss und den Baumalleen, brütete, nicht weniger rätselhaft und untröstlich, die Erinnerung; und manchmal wurde ich fast erdrückt von der Dringlichkeit, mit der die Vergangenheit ihre schwermütigen Forderungen erhob.
Vor der Eingangstür verlief nach Westen hin eine Schotterstraße ins offene Land hinaus, das rauer war als diese gotische Parklandschaft: Weiden, Eisenbahnbrücken, ein Gaswerk, dann noch mehr Weiden – eine Art Steppe, wo das Klima immer extrem zu sein schien, wo es Schneeregen gab, oder Wind, oder drückende Hitze. Ein weites Gebiet, nur lose begrenzt durch die Windungen des Flusses, über dem immer – mal stärker, mal schwächer – der Geruch des Gasometers wehte, jetzt vielleicht in Erinnerung gerufen durch den Qualm des Koksfeuers. In den Anfangstagen des Monats konnte man noch Scharen von Jungen, in Grüppchen und einzeln, diesen Pfad entlangziehen sehen – die Wandervölker der Region, in ewiger Unrast ins Exil hinausstapfend bis zu der Stunde, wenn feuchte Wolken erneut begannen, die roten Häuser zuzudecken und die dahinterliegenden Zinnen und Spitztürme zu verzerren oder in Schleier zu hüllen. Dann, mit der Rückkehr des Nebels, zogen auch diese Nomaden, mit hängenden Köpfen und in lang auseinandergezogenen Reihen, immer wieder zurück in ihre verlassenen Behausungen.
Jetzt aber, zu diesem Zeitpunkt des Jahres, da Schulsport nicht mehr an fünf Tagen pro Woche stattfand, war die Straße leer; nur Widmerpool hoppelte, in einem einst weißen Pullover und mit einer mindestens eine Nummer zu kleinen Mütze, auf den flachen Absätzen seiner Spikes holprig, doch zielstrebig daher. Langsam, aber stetig hob er sich aus der Dämmerung heraus auf mich zu, während ich, gut eingepackt, wie ich mich erinnere, von einer Expedition zur Hauptstraße der Stadt zurückkam.
Es war bekannt, dass Widmerpool freiwillig jeden Nachmittag allein einen »Dauerlauf« machte. Jetzt kehrte er zurück von seinem Trab über die Äcker in dem Nieselregen, der seit den frühen Schulstunden gefallen war. Ich hatte ihn natürlich vorher schon oft gesehen, denn wir gehörten zu demselben Haus; selbst gesprochen hatte ich mit ihm schon, obwohl er ein wenig älter war als ich. Mir waren auch die Anekdoten über seine allgemein anerkannte Seltsamkeit vertraut. Bis zu diesem Augenblick hatten jedoch solche Geschichten ihn mir nicht zu einer lebendigen Person machen können. Erst auf dem trüben Dezemberasphalt jenes Samstagnachmittags im Jahre, ich glaube, 1921 nahm Widmerpool, mit seiner ziemlich stämmigen Figur, mit seinen dicken Lippen und seiner Metallbrille, die dem Gesicht wie gewöhnlich einen gekränkten Ausdruck gaben, feste Gestalt in meiner Vorstellung an. Während die feuchte, durchdringende Kälte von der Straße hochsprang, trieben zwei dünne Dampfstöße aus seinen von Natur aus weiten Nasenlöchern, und plötzlich schien er eine schmerzliche Mitmenschlichkeit zu besitzen, die die Gespräche über ihn mir nie hatten vermitteln können. Etwas Unbehagliches, Unelegantes in seiner Erscheinung drängte sich plötzlich dem Beobachter auf, als Widmerpool sich steif und fast majestätisch auf seinen Absätzen aus dem feinen Nebel herausschob.
Sein Ansehen war nicht hoch. Er war nicht Mitglied in einer Schulmannschaft; und obwohl bei weitem kein Trottel, war er doch kein besonders guter Schüler. Zu jeder Zeit des Jahres konnte man ihn für die Sportart trainieren sehen, die gerade ihre Saison hatte: im Winter einsame Läufe mit oder ohne Fußball; im Sommer »Streckenrudern« auf dem Fluss, wobei er heftig atmete und der Schweiß seine dicken Brillengläser beschlug, während er das schmale Boot durchs Wasser trieb. Soweit ich weiß, hat er nie auch nur das Semifinale in jenen Wettkämpfen erreicht, für die er immer meldete. Meistens war er allein, und auch wenn er mit anderen daherging, schien er irgendwie von ihnen getrennt. Im Hause wurde man eher auf ihn aufmerksam als im Freien, denn er hatte eine hohe Stimme und artikulierte sehr schlecht – so als ob die Zunge zu groß für den Mund sei. Diese Art zu sprechen gab seinen Worten immer den Anschein von Protest, den man auch schon fast erwartete, wenn man in sein Gesicht blickte. Zusätzlich zu seiner ausgeprägt lauten Sprechweise erzeugten die Gummiverstärkungen an den Sohlen und Absätzen seiner Halbstiefel, die er öfter trug als das, was Stringham immer »Widmerpools solide, vernünftige Schuhe« nannte, ein ununterbrochenes Quietschen. Ihr schrilles, rhythmisches Aufheulen, im Lautumfang begrenzt wie der Klang eines barbarischen Orchesters, kündigte warnend sein Näherkommen auf dem Linoleum entfernter Korridore an. Und ihr übelgelaunter, jaulender Klagegesang war erdacht, so schien es, als musikalischer Ausdruck einer Existenz voller Mühen und Verzicht, getrennt verbracht von dem täglichen Leben des Stammes. Vielleicht klingt das alles so, als sei er eine groteske und auffällige Erscheinung gewesen. Im Übermaß war Widmerpool weder das eine noch das andere. Er lebte sein Leben – wie viele andere auch – außerhalb meines engeren Gesichtskreises. Wegen des Altersunterschiedes kannte ich das meiste über ihn nur aus zweiter Hand. Und obwohl er mir an jenem Abend so jäh als Person bewusst geworden war, wäre er mir doch nur als undeutlicher Umriss im Gedächtnis verblieben, hätte er nicht zu einem früheren Zeitpunkt, noch bevor ich selbst zu der Schule kam, schon als Neuer dadurch Denkwürdigkeit erlangt, dass er die falsche Art von Mantel trug.
Aus dieser zeitlichen Distanz kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie der Mantel war, den Widmerpool zuerst getragen haben soll. Geschichten darüber hatten sich zu einer Legende ausgewachsen, und zwar in einem solchen Maße, dass selbst fünf oder sechs Jahre später ein aufdringliches oder unangemessenes Kleidungsstück gelegentlich noch als »ein Widmerpool« bezeichnet werden konnte. Templer, zum Beispiel, sagte manchmal: »Leider trage ich heute eher Widmerpool-Socken«, oder: »Ich habe einen wunderschönen Widmerpool-Binder gekauft, den ich tragen werde, wenn ich nach Hause fahre.« Ich habe den Eindruck, dass die ursprüngliche Abweichung vom Normalen bei diesem Mantel nur gering war und ihren Grund hatte in der Existenz oder dem Fehlen eines Gürtels im Rücken, oder in der Tatsache, dass er als Einreiher oder Zweireiher geschnitten war; vielleicht hatte die Regelwidrigkeit auch etwas mit dem Kragen zu tun, oder der Stoff hatte gar die falsche Farbe oder das falsche Gewebe.
Genau genommen war der Mantel als solcher nur bemerkenswert als Vehikel für die Kommentare, die er hervorrief, während es doch eigentlich ein Element in Widmerpool selbst war, das sich für die Gemeinschaft als unverdaubar erwiesen hatte. Ein Mantel, der nie den geringsten Anstoß erregte und einem Jungen namens Offord gehörte, dessen Eltern in Madeira lebten, wo sie dieses Kleidungsstück möglicherweise gekauft hatten, wurde mir in der Tat einst als »dem von Widmerpool sehr ähnlich« gezeigt. Zu keiner Gelegenheit ist Widmerpool je wegen dieser Sache tyrannisiert oder auch nur ernsthaft gehänselt worden. Im Gegenteil; seine Abweichung scheint ihm gegenüber kaum erwähnt worden zu sein – außer von gröberen Geistern; denn der Mantel war fast sofort anerkannt als ein traditionell lächerlicher Aspekt des täglichen Lebens. Wenn man Jahre später seine gleichaltrigen Mitschüler zu diesem Thema befragte, gaben sie vage Antworten; sie lachten nur immer und sagten, dass er den Mantel zwei Trimester lang getragen habe; als es dann wieder Winter geworden sei, habe man festgestellt, dass er jetzt einen von der konventionelleren Sorte besaß.
Dieser Mantel gab Widmerpool eine bleibende negative Berühmtheit, die seine sonst glanzlose Karriere an der Schule nie völlig vergessen machen konnte. In welchem Maße er selbst sich seines Rufes bewusst war, ist schwer zu sagen. Sein Verhalten ließ sicherlich darauf schließen, dass er auf solideres Ansehen hoffte als allein deshalb bekannt zu sein, weil er für einige Monate ein außergewöhnliches Kleidungsstück getragen hatte. Wenn das sein Ziel war, blieb er erfolglos; und das einzige mir bekannte Mal, dass seine Bemühungen darum ein gewisses Maß an öffentlicher Anerkennung fanden, ereignete sich etwa einen Monat vor meiner Erfahrung jener, sozusagen transzendentalen, Manifestation seiner Person in dem Nebel. Alle waren in dem Aufenthaltsraum der älteren Schüler zusammengekommen, um sich die Beschwerden anzuhören, die Parkinson, der Sportsprecher, zum Thema unseres mangelnden Einsatzes vorbringen wollte. Parkinson, eine etwas schwächliche Person, die leicht errötete, hatte seine kleine Rede mit den Worten beendet: »Es ist schade, dass einige von euch nicht so eifrig sind wie Widmerpool.« Ein lautes Gelächter war die Reaktion darauf gewesen. Parkinson selbst grinste verlegen und wurde wie üblich rot, so als ob er etwas gesagt hätte, das man, selbst in seinen Augen, für ziemlich unschicklich halten könnte; dabei befühlte er, wie es seine Gewohnheit war, die Gruppe von Pickeln, die sich auf einem seiner Backenknochen angesammelt hatte.
Widmerpool selbst hatte nicht gelächelt, doch konnte ihm wohl kaum das Lachen entgangen sein. Er hatte ernsthaft auf seine Halbstiefel mit den Gummiverstärkungen gestarrt, offensichtlich um so jedem Vorwurf pedantischer Bravheit zu entgehen. Dabei zuckten seine Finger. Seine Hände waren klein und knorrig, mit kurzen, abgewetzten Nägeln, so als ob er seine Freizeit damit verbrächte, mit ihnen tief in die Erde hineinzugraben. Stringham hatte gemeint, dass die Nägel des Heiligen, der ohne Werkzeuge sein eigenes Grab ausgehoben hatte, in einem Maniküre-Wettbewerb sehr gut mit denen Widmerpools hätten konkurrieren können. Wenn Widmerpool nicht, kurz nachdem diese Lobesbrosamen für ihn abgefallen waren, an Geschwüren erkrankt wäre, hätte er es wohl bis zum Ende der Fußballsaison noch geschafft, in die Hausmannschaft zu kommen. Ein solcher Erfolg war ihm dann doch nicht beschieden, obwohl er von dem Augenblick an, in dem sein Leiden nachzulassen begann, so hart wie immer trainierte. Irgendein beliebterer Schüler wurde zum ersten Ersatzmann ernannt.
Ich grübelte noch über die Begegnung mit Widmerpool nach, während ich das Haus betrat, wo mir in der Halle, fast einladend nach dem Nebel draußen, ihre vertraute Ausdünstung von Karbolseife, lüftenden Decken und kaltem Irish Stew entgegenschlug. Ich stieg die Treppe hinauf und freute mich auf den Tee. Ein dicker, schwarzer Farbstreifen teilte die obere, gelbe Hälfte der Wand von dem magentaroten Sockel darunter. Über dieser schwarzen war eine weitere, diesmal gesprenkelte und wellenförmige Linie, wo die Vorübergehenden beim Treppauf und Treppab Arm oder Schulter anlehnten und so die Leimfarbe zu einem schrägen Streifen von Grau verfärbten. Wie gewöhnlich standen zwei oder drei Jungen vor dem Anschlagbrett im ersten Stock, ihre Augen auf die halben Papierseiten gerichtet, die mit Heftzwecken an dem grünen Fries befestigt waren. Sie starrten auf die flüchtig hingekritzelten Listen und Vorschriften, als ob sie in Bann geschlagen seien von einem Fernschreiber, der jeden Augenblick den Gewinner verkünden würde. Es hing dort nichts Neueres als eine jener stets wiederkehrenden Verfügungen, die von Le Bas, unserem Hausdirektor, ausgingen. Diesmal verlangte er, dass alle Schuhe auf dem Kratzeisen abgekratzt und dann beim Betreten der Halle noch einmal auf der Fußmatte abgescheuert werden sollten, um die Verbreitung des Schmutzes durchs ganze Haus zu vermeiden. Auf die Ecke dieses schmuddeligen Befehls hatte Stringham einige Tage zuvor mit Rotstift ein Gesicht gezeichnet. Mehrere Augenpaare ruhten nun gläsern auf diesem äußeren Protest gegen die Stimme der Autorität.
Seit Anfang des Trimesters nahm ich zusammen mit Stringham und Templer den Tee ein, und ich hatte schon eine Menge von ihnen gelernt. Beide waren ein wenig älter als ich, Stringham um etwa ein Jahr. Die Gruppierung ergab sich teilweise aus den Umständen und war diktiert durch die innere Ökonomie des Hauses: in diesem Falle die der Verteilung der Speisen für den Tee. Ich mochte und bewunderte Stringham; bei Templer war ich mir noch nicht sicher. Seine prahlerische Behauptung, er habe noch nie im Leben ein Buch zum Vergnügen gelesen, stimmte mich nicht besonders günstig gegen ihn, obwohl er viel mehr als ich von den Dingen wusste, über die Bücher geschrieben werden. Er war auch sehr geschickt darin, Vorschriften zu verletzen oder sie zu Zwecken zu dehnen, die von den Verfassern sicher nicht beabsichtigt waren. Da Templer, offensichtlich auf Wunsch seiner Eltern, die Erlaubnis erwirkt hatte, einen Augenarzt zu konsultieren, verbrachte er diesen Tag in London. Es war unwahrscheinlich, dass er seinen Besuch so kurz halten würde, dass er noch rechtzeitig zum Tee zurück sein konnte, ein Mahl, das wir immer in Stringhams Zimmer einnahmen.
Als ich hereinkam, kniete Stringham, ein wie ein Krummsäbel geformtes Papiermesser als Toastgabel benutzend, vor dem Kaminfeuer. Ohne aufzusehen, sagte er: »Wir haben eine Marmeladenkrise.«
Er war groß und dunkel und sah ein wenig aus wie einer von jenen steifen, traurigen jungen Männern mit Halskrause, deren lange Beine auf den Porträtbildern des 16. Jahrhunderts so viel Raum einnehmen; oder vielleicht wie eine jüngere – und weit schmächtigere – Version von Veroneses Alexander, der nach der Schlacht von Issus die Kinder des Darius empfängt: die gleiche hohe Stirn und die gleiche Andeutung einer Verdünnung des Haars an den Schläfen. Seine Gesichtszüge schienen eindeutig in jene Epoche der Malerei zu gehören. Sie ähnelten den Gesichtern in elisabethanischen Miniaturen: lebendig, eigensinnig, großzügig, nicht sehr glücklich, völlig unerbittlich. Er konnte andere hervorragend nachahmen; und obwohl er an längeren Anfällen von Melancholie litt, sprach er eine Menge, wenn er nicht von einer dieser Depressionen befallen war. Und er spielte ungewöhnlich wilde Streiche, wenn er gereizt wurde. Im Cricket war er gut genug, um ohne große Schwierigkeiten zurechtzukommen. Fußball ging er bei jeder Gelegenheit aus dem Wege. Ich nahm die Scheibe Toast, die er mir hinhielt.
»Ich habe ein paar Würstchen gekauft.«
»Leih dir wieder die Bratpfanne. Wir können sie über dem Feuer zubereiten.«
Das Zimmer enthielt zwei Buntdrucke von Rennpferden (»Trimalchio« und »The Pharisee« und ihre Jockeys mit bläulichem Kinn) aus dem späten 18. Jahrhundert, die über einem Bild hingen, das aus einer der illustrierten Wochenzeitschriften ausgeschnitten und in einem Passepartout gerahmt war. Es zeigte die Hochzeit von Stringhams Schwester. Der Bräutigam war in Khaki-Uniform und hatte einen Ärmel mit einer Nadel an dem Waffenrock befestigt. Über dem offenen Kamin hing eine große, ausgesprochen dekorative Fotografie von Stringhams Mutter, bei der er lebte, einer Schönheit und reichen Erbin, die sich im Jahr zuvor, nach der Trennung von Stringhams Vater, wieder verheiratet hatte. Sie stammte aus Südafrika. In der Ecke des Rahmens steckte ein Schnappschuss von Stringham senior, einem angenehm aussehenden Mann in offenem Hemd, der eine Pfeife rauchte und dem die Sonne in den Augen stand. Auch er hatte wieder geheiratet und seine zweite, jüngere, Frau, eine Französin, mit sich nach Kenia genommen. Stringham sprach nicht oft über sein Zuhause, und damals war das alles, was ich über seine Familie wusste; außer dass Templer einmal die Bemerkung gemacht hatte, dass »in jener Richtung eine ganze Menge Geld zur Verfügung« stehe, und er hatte hinzugefügt, dass Stringhams Eltern in Kreisen verkehrten, in denen »mit dem Geld ganz schön herumgeschmissen« würde.
Ich war noch so betroffen von meinem plötzlichen Gewahrwerden der Person Widmerpool, die sich mir kurz vorher auf der Straße vor dem Haus fast wie eine Neugeburt enthüllt hatte, dass ich, während die Würstchen brieten, die Art beschrieb, wie er, von den Merkmalen der Verzweiflung gezeichnet, in einer Folge kurzer Schübe aus dem Schatten heraus Gestalt angenommen hatte. Stringham hörte zu und stach dabei mit dem Krummsäbel Löcher in jedes der Würstchen. Er sagte langsam: »Widmerpool leidet – oder litt – an einer Gesäßmuskelverkrampfung. Dickinson hat mir erzählt, dass sie damals, als die diensttuenden jüngeren Schüler zur Teezeit immer im Aufenthaltsraum der älteren Schüler aufmarschierten, einmal alle an der Wand standen, als plötzlich unartikulierte Schreie ertönten. Als Folge dieser Krankheit waren Widmerpool unerwartet die Beine weggesackt.«
»Ist er hingefallen?«
»Er klammerte sich an den Wandvorsprung, seine Beine hingen völlig in der Luft.«
»Und dann?«
»Er wurde weggeschafft.«
»Ach so. Haben wir Senf?«
»Jetzt erzähl ich dir, was letzten Sommer passiert ist«, fuhr Stringham fort; er lächelte dabei in sich hinein und stach weiter in die Würstchen. »Peter Templer und ich hatten uns – aus einem unerfindlichen Grund – den letzten Teil eines Cricket-Matches angesehen und dann auf dem Weg zurück angehalten, um etwas zu trinken. Wir trafen auf Widmerpool, der dort für sich allein stand und ein Glas Limonade vor sich hatte. Am hinteren Ende der Theke alberten einige aus der Cricket-Mannschaft herum. Eine geschälte Banane flog durch die Luft. Sie verfehlte ihr Ziel und traf Widmerpool. Es war ein Volltreffer. Die Banane war überreif. Sie zerbarst über sein ganzes Gesicht und schlug seine Brille zur Seite. Seine Mütze fiel herunter, und er verschüttete den größten Teil seiner Limonade vorn über seine Kleidung.«
»Typisch für die Wurfkünste der Cricket-Mannschaft.«
»Budd selbst war verantwortlich. Widmerpool zog sein Taschentuch heraus und begann, die Schmiere abzuwischen. Budd kam, noch lachend, den Laden herunter und sagte: ›Tut mir leid, Widmerpool. Diese Banane war nicht für dich bestimmt!‹ Widmerpool war offensichtlich erstaunt, sich von keinem Geringeren als dem Kapitän der Cricket-Mannschaft – der nur wegen des berühmten Mantels gewusst haben konnte, wie Widmerpool hieß – mit seinem Namen, und so höflich, angeredet zu hören. Budd stand lächelnd da, zeigte ’ne Menge seiner Filmstar-Zähne und sah mehr denn je aus wie der Held einer Abenteuergeschichte für Jungen.«
»Diese edle Stirn.«
»Sie scheint ihm nicht dabei zu helfen, eine Menge Punkte für die Mannschaft zu holen«, sagte Stringham, »ebenso wenig wie seine schön geschnittenen Schläge, die sich so gut auf Fotos ausmachen.« Er hielt einen Moment inne und schüttelte den Kopf, anscheinend traurig über den Gedanken an Budds Unzulänglichkeiten als Cricketspieler; dann fuhr er fort: »Wie auch immer – Budd, der aus jeder Pore Charme ausströmte, sagte: ›Ich fürchte, ich hab dir ’ne ziemliche Schweinerei gemacht, Widmerpool‹, und er stand da und besah sich die Verheerung, die er gerade angerichtet hatte. Weißt du, ein absolut sklavischer Blick erschien auf Widmerpools Gesicht. ›Macht nichts‹, sagte er, ›ist überhaupt nicht schlimm, Budd. Macht nicht das Geringste.‹«
Stringhams Geschicklichkeit im Nachahmen von Widmerpools Sprechweise war erstaunlich. Er unterbrach seine Erzählung, um etwas Brot in das Fett zu legen, in dem die Würstchen brieten, und sagte danach: »Es war, als ob Widmerpool irgendeine geheime und scheußliche Freude empfunden habe. Er hatte seine Brille abgenommen und wischte an ihr herum, wobei er seine Augen, um die noch Spuren der Banane hingen, zu Schlitzen zusammenkniff. Er begann seine Gläser zu behauchen und sie unter deutlicher Zurschaustellung von Fröhlichkeit zu reiben. Die Wirkung war völlig anders, als er vielleicht gehofft hatte. Vielmehr breitete diese ganze Herzlichkeit eine entsetzliche Schwermut über den Laden. Budd ging zu seinen Freunden zurück und beendete, was immer er dort aß oder trank, in tödlichem Schweigen. Die anderen Mitglieder der Mannschaft, oder wer sie auch waren, hörten auf zu lachen und murmelten nervös und unsicher etwas über die bevorstehenden Cricket-Begegnungen in sich hinein. All ihr Schwung war dahin. Ich hab noch nie so etwas gesehen. Dann nahm Budd seinen Schläger, seine Beinschoner, seine Handschuhe und was ihm sonst noch gehörte auf und sagte: ›Ich muss jetzt gehen. Ich hab heute Abend die Musikalische Gesellschaft‹, und dann gab’s das übliche ›Tschüs, Bill … tschüs –‹«
»›Tschüs, Guy … tschüs,Stephen … tschüs, John … tschüs, Ronnie … tschüs, George …‹«
»Genau«, sagte Stringham. »›Tschüs, Eddie … tschüs, Simon … tschüs, Robin …‹ und so weiter und so weiter, bis sie sich alle gemeinsam und einzeln tschüs gesagt hatten und zusammen, Arm in Arm, abzogen. Templer wollte gehen, denn er musste noch vor Ende der Ausgehzeit in die Stadt. So überließen wir Widmerpool sich selbst. Er hatte seine Brille wieder aufgesetzt und seine Mütze geradegerückt, und während wir durch die Tür gingen, rieb er seine rauen Fingerknöchel aneinander und lächelte noch immer über seine großartige Begegnung mit Budd.«
Der Bericht über diesen Zwischenfall, der Licht auf eine andere Seite Widmerpools warf, machte in diesem Augenblick keinen besonders tiefen Eindruck auf mich. Er ähnelte einer Anzahl anderer Anekdoten, die über diesen Gegenstand von Zeit zu Zeit im Umlauf waren, und unterschied sich von ihnen nur durch die Geschicklichkeit, mit der Stringham seine Geschichten erzählte. Mein eigenes erneutes Gewahrwerden der Persönlichkeit Widmerpools schien mir näher und realer. Aber Stringham war mit der Sache noch nicht zu Ende. Er sagte: »Als wir an den Fives Courts vorbeikamen, bemerkte Templer: ›Ich finde es prima, dass sich dieser Esel Widmerpool die Banane eingefangen hat.‹ Ich fragte ihn, warum er ihn nicht leiden könne – denn schließlich ist der arme Kerl doch so übel auch nicht –, und es zeigte sich, dass es Widmerpool gewesen war, der veranlasst hatte, dass Akworth geschasst wurde.«
Stringham hielt einen Moment inne, um diese Feststellung wirken zu lassen, während er die Würstchen zu einem neuen Muster zusammenschob. Ich wusste nur noch sehr vage, worum es bei der Akworth-Geschichte gegangen war. Doch ich erinnerte mich, dass er kurz nach meiner Aufnahme die Schule in Unehren verlassen hatte und dass damals verschiedene Gerüchte über seine Missetaten im Umlauf waren.
»Akworth versuchte, in seinem Zimmer Feuer zu legen, nicht wahr? Oder hat er nicht alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war?«
»Er mag sehr wohl beides getan haben«, sagte Stringham, »aber er wurde vor allem deshalb rausgeschmissen, weil er Peter Templer ein Briefchen zukommen lassen wollte. Widmerpool fing es ab und zeigte es Le Bas. Ich muss zugeben, dass mir das neu war, als Peter es mir erzählte.«
»Und das war der Grund, warum Peter eine Abneigung gegen Widmerpool gefasst hatte?«
»Nicht nur das, aber Widmerpool nahm Peter beiseite und hielt ihm eine fürchterliche Moralpredigt.«
»Das muss gut für ihn gewesen sein.«
»Die Predigt dauerte so lange, und Widmerpool kam ihm so nahe, dass Templer sagte, er glaubte, Widmerpool selbst würde nun etwas anfangen.«
»Peter denkt das immer von jedem.«
»Das stimmt. Seine hohe Meinung von sich ist unübertrefflich«, sagte Stringham, und er wendete die Würstchen gedankenverloren, so als ob er über Templers Eitelkeit nachsinne.
»Und hat Widmerpool etwas angefangen?«, fragte ich.
»Das ist ein fürchterlicher Gedanke, nicht wahr?«
»Was ist die Antwort?«
Stringham lachte. Er sagte: »Peter machte eine absolut typische Templer-Bemerkung, als ich ihm dieselbe Frage stellte. Er sagte: ›Gott sei Dank nicht, aber er ging im Zimmer auf und ab und atmete dabei so schwer wie der weiße Pekinese meiner Schwester. Hast du gesehen, wie glücklich er vorhin darüber war, dass Budd von ihm Notiz nahm? Er sah aus, als sei er gerade unter dem Mistelzweig geküsst worden. Verdammter Narr. Der ist so behämmert, dass man gut ein Schmiedetor aus ihm machen könnte.‹ Kannst du dir einen exquisiteren Templer-Ausdruck vorstellen? Wie auch immer – so sieht Widmerpool in den Augen unseres kleinen Zimmergenossen aus.«
»Aber wie ist er wirklich?«
»Wenn du dir nicht sicher bist, wie Widmerpool ist«, sagte Stringham, »dann sieh ihn dir am besten noch einmal an. Du wirst heute bei der Abendandacht dazu Gelegenheit haben. Die Würstchen sind fertig.«
Er hörte auf zu sprechen, hielt das Papiermesser, das er wieder in die Hand genommen hatte, gerade nach oben und zog überrascht die Augenbrauen hoch, denn in diesem Augenblick gab es draußen eine Art Scharren, dem ein Klopfen an die Tür folgte – ein an sich schon erstaunlicher Laut. Eine Sekunde später sagte von draußen eine zitternde, unendlich traurige Stimme: »Darf ich hereinkommen?«
Offensichtlich war das kein Schüler. Und die Art des Herankommens war auch nicht die eines Lehrers. Das Scharnier quietschte, und als sich die Tür zu öffnen begann, spähte ein Verzeihung heischendes, forschendes Gesicht durch den engen Spalt, der sich zwischen Tür und Wand auftat. Ein spärlicher Schnurrbart, grau oder sehr blond, war zu erkennen, und ein abgetragener, ziemlich sportlicher Tweedanzug. Ich erfasste sofort, und nicht ohne ängstliche Bedrückung, dass mein Onkel Giles den Raum zu betreten versuchte.
Ich hatte meinen Onkel seit dem Ende des Krieges nicht mehr gesehen, und damals hatte er irgendeine Art Uniform getragen, allerdings nicht die einer leicht erkennbaren Waffengattung. Sein plötzliches Erscheinen in Stringhams Zimmer war ein noch nicht dagewesener Überfall: Es war das erste Mal, dass er seinen Weg hierhergefunden hatte. Er zögerte kurze Zeit seinen Eintritt hinaus und presste die Kante der Tür gegen seinen Kopf, dessen andere Seite die Wand berührte. So war er bewegungslos, als ob er gefangen sei in einer grausamen, nur für ihn und seinesgleichen entworfenen Falle, in einer raffinierten Schlinge mit brutalem Mechanismus, die aber gleichzeitig darauf berechnet war, die Haut solch seltener Geschöpfe vor Verletzung zu bewahren. In Wirklichkeit war die Haut von Onkel Giles nicht so leicht zu verletzen; doch jahrelange Erfahrung ließ ihn zögern, als selbstverständlich anzunehmen, dass seine Gesellschaft überall willkommen sei – überall dort zumindest, wo andere Mitglieder seiner Familie versammelt sein mochten. Zuerst riskierte er deshalb nicht, weiter in das Zimmer hereinzukommen – wohl weil er sich bescheidenerweise bewusst war, dass seine unerwartete Ankunft vielleicht, und nicht ohne Grund, von den Anwesenden als Quelle möglicher Verlegenheiten betrachtet werden würde.
»Ich bin auf dem Weg nach Reading hier durchgekommen«, sagte er. »Dachte, ich könnte dich mal besuchen.«
Er stand an der Tür und schien ein wenig benommen. Vielleicht war er überwältigt von dem satten Geruch der Würstchen, der die Atmosphäre des Zimmers durchdrang und ihn möglicherweise an sein zu früherer Tageszeit eingenommenes, vermutlich kärgliches Mittagessen erinnerte. Warum er nach Reading fuhr, war unerfindlich. Wenn er von London gekommen war, konnte das hier kaum »auf dem Weg« genannt werden; aber es mochte gut sein, dass Onkel Giles nicht von London gekommen war. In der Regel machte er seine Aufenthaltsorte nicht publik. Stringham stand auf und schob die Würstchen auf einen Teller.
»Das ist mein Onkel – Hauptmann Jenkins.«
Während er die Würstchen mit dem Papiermesser prüfte, sagte Stringham: »Ich hole noch eine Tasse. Sie leisten uns doch Gesellschaft beim Tee, nicht wahr?«
»Nein danke. Ich nehme nie den Tee ein. Leute, die diese Mahlzeit zu sich nehmen, verschwenden den halben Nachmittag. Wollte mir das nie angewöhnen.« Er fügte hinzu: »Ich spreche natürlich nicht von eurer Art von Tee.«
Er sah zu uns herüber, als ob er Zustimmung erheische – ein wenig unsicher, ob diese Erklärung eine gerechtfertigte Haltung gegenüber dem Tee ausdrückte oder nicht; unsicher auch, und mit gutem Grund, ob eine Behauptung, er mache Anstrengungen, wie klein diese auch sein mochten, seine Zeit nicht zu vergeuden, sich selbst in der Gesellschaft, in der er sich nun befand, als wirklich glaubwürdig erweisen würde. Wir liehen uns einen Stuhl von nebenan; er setzte sich und schnäuzte mit einer Reihe kleiner Grunzer seine Nase in ein großes, buntes Taschentuch.
»Lasst euch von mir nicht von euren Würstchen abhalten, Jungs«, sagte er. »Sie werden kalt. Sie sehen mir verdammt gut aus.«
Von adretter und immer noch ein wenig militärischer Erscheinung – obwohl er seit mindestens zwanzig Jahren nicht mehr Offizier und Hauptmann wahrscheinlich mehr oder weniger ein Ehrentitel war, sich selbst verliehen und darin unterstützt von den ihm geneigteren seiner Verwandten – war der Bruder meines Vaters jetzt etwa fünfzig. Seine Ankunft an diesem Abend zeigte, dass er nicht ausgewandert war. Diese Vermutung war einmal vorgebracht worden, um sein ungewöhnlich langes Verschwinden von der Bildfläche zu erklären. Es waren in der Familie auch einige ziemlich unbehagliche Scherze über die Möglichkeit gemacht worden, dass er die Grenze, die das Gesetz für die Abwicklung alltäglicher Geschäfte zieht, überschritten und sich in finanziellen Dingen einen Ausrutscher geleistet habe, der seine unfreiwillige Abwesenheit von der Szene erklären könnte. Denn Onkel Giles war von den meisten Leuten, die ihn überhaupt gut kannten, auf jenes Nebengleis abgeschoben worden, wo nichts von einer Person erwartet wird und wo selbst ungewöhnlich schändliche Taten zumindest in Gesprächen behandelt werden, als ob sie eine Reihe von Streichen darstellten, die mehr oder weniger vergnüglich sind, je nachdem, auf wen die Verantwortung fallen mochte, die Angelegenheiten wieder zu bereinigen. Das Seltsame an Menschen, denen gegenüber die Gesellschaft diese, im Wesentlichen dem Selbstschutz entspringende Haltung einnimmt, ist, dass die Existenz der Person selbst eine Stufe erreicht, auf der nichts, was sie tut, je als ernsthaft angesehen werden kann. Wenn sie Selbstmord oder einen Mord begeht, so beherrschen allein die grotesken Aspekte das Bild der Umstände, denn insgesamt gesehen ist das Meiden solch schwerwiegender Konsequenzen ein wesentlicher Teil ihrer Lebensbedingung. Mein Onkel war ein gutes Beispiel für die Wirksamkeit dieses Gesetzes; doch sah ich ihn natürlich damals nicht einmal annähernd mit dieser Klarheit des Blicks. Falls Reading sein Ziel war, gab es kein Anzeichen für seine unmittelbare Absicht, das Land zu verlassen; und er stand, sofern er nicht einen Urlaubsschein bekommen hatte, offensichtlich unter keinerlei gesetzlichen Beschränkungen seiner Freiheit. Er beendete sein Naseputzen, schob das Taschentuch zurück in seinen Ärmel und sagte, die Redensart ohne den zu der Zeit populären Nebensinn benutzend: »Wie geht’s deinem Vater?«
»Gut.«
»Und deiner Mutter?«
»Sehr gut.«
»Schön«, sagte Onkel Giles, als ob es eine Erleichterung für ihn persönlich bedeute, dass es meinen Eltern gut ging, selbst wenn der Rest der Welt vielleicht anders über diese Sache denken mochte.
Es entstand eine Pause. Ich fragte ihn, wie es seiner eigenen Gesundheit ergangen sei, worauf er verächtlich lachte.
»Ach, ich«, sagte er, »bei mir war es immer so dasselbe. Werd’ auch nicht jünger. Altes Geschwür am Zwölffingerdarm macht mir Kummer. Ich hätte gerne deinen Vater zu fassen gekriegt, wegen Unterschriften unter einigen Papieren. Er ist noch in Paris, nehme ich an?«
»Dieser Teil der Konferenz ist beendet.«
»Wo ist er?«
»In London.«
»Auf Urlaub?«
»Ja.«
»Die im Kriegsministerium haben noch nicht entschieden, wo sie ihn hinschicken werden?«
»Nein.«
Mein Onkel schien durch diese Neuigkeit irritiert. Es war äußerst unwahrscheinlich, ja fast undenkbar, dass er wirklich beabsichtigte, seine Gesellschaft meinem Vater aufzudrängen, der seit vielen Jahren enge Verbindungen zu seinem Bruder zurückgewiesen hatte – außer wenn er von dem gelegentlichen und unkontrollierbaren Verlangen ergriffen wurde, Onkel Giles ins Gesicht zu sagen, was er von ihm dachte; und diese Stimmung dauerte selten länger als sechsunddreißig Stunden. Bis zum Ende eines solchen Zeitabschnittes kehrte wieder die Einsicht in die von vornherein feststehende Wirkungslosigkeit irgendwelcher derartiger Kontakte zurück.
»In London ist er also«, sagte Onkel Giles und kräuselte die trockene, rötliche Haut an den Seiten seiner Nasenlöcher, unter der ein in die Nase geätztes Gewebe kleiner grauer Äderchen die vorläufigen Umrisslinien für eine Partie »Nullen und Kreuze« anzudeuten schien. Er zog ein ledernes Zigarettenetui hervor und zündete sich, ehe ich es verhindern konnte, eine Zigarette an.
»Besucher dürfen hier eigentlich nicht rauchen.«
»Oh, nicht?«, sagte Onkel Giles und guckte sehr erstaunt. »Warum nicht?«
»Nun, wenn das Zimmer nach Rauch riecht, kann man nicht sagen, ob jemand anderes auch geraucht hat.«
»Natürlich kann man das nicht«, gab Onkel Giles sofort zu und blies einen langen Rauchstrom in die Luft. Er schien verwirrt.
»Le Bas denkt vielleicht, dass ein Schüler geraucht habe.«
»Wer ist Le Bas?«
»Unser Hausdirektor.«
Wie er es fertiggebracht hatte, das Haus ausfindig zu machen, ohne die Identität von Le Bas zu kennen, war unklar, ja unerklärlich. Es stand jedoch durchaus im Einklang mit der Art, wie mein Onkel sein Leben führte, dass er seinen Bestimmungsort erreichte, ohne den Namen des Ziels zu wissen. Mit kurzen Zügen rauchte er weiter an seiner Zigarette.
»Ach so«, sagte er.
»Schüler dürfen nicht rauchen.«
»Und richtig so. Hindert das Wachstum. Es ist ein großer Fehler zu rauchen, ehe man einundzwanzig ist.«
Onkel Giles richtete sich gerade auf und straffte die Schultern. Man hatte den Eindruck, er sei sich sehr wohl bewusst, dass die jungen Leute der Gegenwart kaum versuchen konnten, es mit den strengen Maßstäben aufzunehmen, die seine Jugend beherrscht hatten. Er schüttelte den Kopf und schnippte etwas Asche auf einen der schmutzigen Teller.
»Es steht hundert zu eins, dass Le Bas nicht hereinkommen wird«, sagte Stringham. »Ich würde es riskieren.«
»Was riskieren?«, fragte Onkel Giles.
»Zu rauchen.«
»Sie meinen, ich sollte sie wirklich ausmachen?«
»Bemühen Sie sich nicht.«
»Ich werde mich sehr wohl bemühen«, sagte Onkel Giles. »Ich würde nicht im Traum daran denken, eine Regel dieser Art zu verletzen. Regeln sind gemacht, damit sie beachtet werden, wie dümmlich sie einem auch manchmal erscheinen. Die Frage ist nur, wohin am besten damit, jetzt, da die Bestimmung einmal verletzt ist.«
Als er sich schließlich dazu entschlossen hatte, die Zigarette auf der Sohle seines Schuhs auszudrücken und die Kippe ins Feuer zu werfen, war kaum noch etwas von ihr übrig. Stringham schüttete die Asche zusammen, die inzwischen ihren Weg in verschiedene Behälter gefunden hatte, und fegte auch sie auf die Glut. Während der restlichen Zeit des Tees sprach Onkel Giles, der wenigstens für den Augenblick offensichtlich sein Anliegen, mit mir Vereinbarungen für ein Treffen mit meinem Vater zu besprechen, fallengelassen hatte, weitschweifig und ziemlich unverständlich über ein Stillhalteabkommen in Verbindung mit den deutschen Reparationszahlungen und über den Kursverfall der Mark. Onkel Giles’ Sympathien waren auf Seiten der Deutschen. »Sie arbeiten hart«, sagte er. »Deshalb gebührt ihnen mein Respekt.« Warum er plötzlich so hier aufgetaucht war, hatte sich noch nicht geklärt. Als wir mit dem Tee fertig waren, murmelte er, er wolle Familienangelegenheiten besprechen, und folgte mir, nachdem er sich – in einer für meinen Onkel fast überschwänglichen Weise – von Stringham verabschiedet hatte, den Korridor hinunter.
»Wer war das?«, fragte er, als wir allein waren.
In der Regel zeigte mein Onkel nicht das geringste Interesse an irgendjemandem oder irgendetwas, außer an sich selbst und seinen eigenen Angelegenheiten. Ja, er war inzwischen fast unfähig, auch nur die kleinste Information über andere aufzunehmen, wenn sie nicht irgendeine direkte Beziehung zu ihm selbst hatte. Ich war deshalb erstaunt, dass er mit Anzeichen relativer Aufmerksamkeit dem zuhörte, was ich ihm über Stringhams Familie erzählen konnte. Als ich geendet hatte, bemerkte er:
»Ich hab seinen Großvater in Kapstadt gekannt.«
»Was hat der dort getan?«
»Den Vater seiner Mutter meine ich. Er hat ein großes Vermögen gemacht. War kein schlechter Kerl. Kannte natürlich all die richtigen Leute.«
»Diamanten?«
Ich war vertraut mit den Detektivgeschichten, in denen südafrikanische Millionäre ihr Geld mit Diamanten gemacht hatten.
»Gold«, sagte Onkel Giles und kniff die Augen zusammen.
Die Zeit meines Onkels in Südafrika war eine von mehreren Abschnitten in seiner Karriere, die die übrigen Mitglieder der Familie lieber nicht allzu genau untersuchten, oder über die sie, wenn sie sie untersucht hatten, es vorzogen zu schweigen; und so hoffte ich, dass er vielleicht jetzt etwas über die Erfahrungen berichten würde, die nicht zu erforschen ich immer ermahnt worden war. Er sagte jedoch nur: »Ich habe die Mutter deines Freundes einmal gesehen, als sie noch mit Lord Warrington verheiratet war; und sie war wirklich eine sehr attraktive Frau.«
»Wer war Lord Warrington?«
»War viel älter als sie. Er starb dann. Hatte kein gutes Leben, der Warrington. Und du also nimmst immer mit dem jungen Stringham den Tee ein?«
»Und mit einem anderen Jungen, der Templer heißt.«
»Wo war denn Templer?«, fragte Onkel Giles ziemlich misstrauisch, so als ob er vermute, dass jemand ihn vielleicht unbemerkt bespitzelt habe oder dass er um etwas betrogen worden sei.
»In London, um sich seine Augen untersuchen zu lassen.«
»Was ist los mit seinen Augen?«
»Sie tun ihm weh, wenn er was lesen muss.«
Mein Onkel sann über diese Feststellung nach, die in Templers eigenen Worten die persönliche Diagnose seiner Augenbeschwerden wiedergab. Onkel Giles fühlte sich offensichtlich an eine ähnliche eigene Erfahrung erinnert, denn er schwieg für mehrere Sekunden. Ich erzählte mehr über Stringham, aber Onkel Giles hatte die Grenze seiner Fähigkeit erreicht, Mitteilungen über andere Personen aufzunehmen. Er begann, mit den Fingerknöcheln gegen die Fensterscheibe zu klopfen, und ließ das Trommeln erst, als ich meinen Versuch aufgegeben hatte, ihm, soweit sie mir bekannt waren, die Familienumstände Stringhams zu beschreiben.
»Es ist wegen der Stiftung«, sagte Onkel Giles und hörte abrupt mit dem Klopfen auf. Er hatte eine zugleich anklagende und unterwürfige Haltung eingenommen.
Die Stiftung also war der eigentliche Grund seines Besuches. Die Stiftung erklärte sein Erscheinen an diesem Winterabend. Wenn ich angestrengter nachgedacht hätte, wäre mir diese Erklärung vielleicht schon früher eingefallen. Ich muss jedoch zugeben, dass mich damals die Stiftung – ein Thema, das so oft in meiner Gegenwart zur Sprache gebracht worden war – nicht besonders interessierte. Vielleicht hatte der enorme Aufwand an Zeit und Einfallsreichtum, den andere Mitglieder meiner Familie der Untersuchung der unzähligen Aspekte der Stiftung widmeten, für mich den ihr innewohnenden Reiz sogar vermindert. Genau genommen langweilte mich das Thema. In der Rückschau kann ich die Faszination verstehen, die die Stiftung auf meine Verwandten ausübte, besonders auf solche wie Onkel Giles, die in größerem oder kleinerem Maße Nutzen aus ihr zogen. Zu jener Zeit jedoch schien mir die Heftigkeit ihres Interesses eher dem Wahnsinn verwandt.
Das Geld kam von einer Großtante, die es in einer Weise festgelegt hatte, aus der sich einige, wie ich glaube, sehr interessante Fragen juristischer Definition ergaben. Hinzu kam, dass einer der anderen Brüder meines Vaters, Onkel Martin, ebenfalls ein Nutznießer und in der zweiten Schlacht an der Marne als Junggeselle gefallen, die Angelegenheit noch weit komplizierter gemacht hatte, indem er, obwohl es nicht viel Geld zu verteilen gab, ein von ihm selbst aufgesetztes Testament hinterließ, das das Kapital noch weiter sicherte, ohne aber zweifelsfrei zu klären, wer in den Genuss der Erträge kommen sollte. Mein Vater und Onkel Giles hatten daraufhin ein Gentleman’s Agreement über ihre jeweiligen Anteile geschlossen (die jährlich etwa 185 oder in einem guten Jahr fast 200 Pfund einbrachten). Aber Onkel Giles war nie davon überzeugt gewesen, dass er die volle Summe dessen erhielt, worauf er dem Gesetz nach Anspruch hatte. Und so pflegte er, wenn die Zeiten schlecht waren – was etwa alle achtzehn Monate geschah –, Druck auszuüben mit dem Ziel, ein paar Pfund mehr als seinen vereinbarten Anteil herauszupressen. Die Wiederholung dieser Taktik, die immer eine Zeitlang vergessen war und dann wieder aufbrach wie eines von Onkel Giles’ Geschwüren am Zwölffingerdarm, führte dazu, dass mein Vater äußerst ärgerlich wurde; und in Verbindung mit der übrigen Lebensführung meines Onkels hatte sie einen fast völligen Bruch der Beziehungen zwischen den beiden Brüdern zur Folge.
»Wie du wahrscheinlich weißt«, sagte Onkel Giles, »schulde ich deinem Vater eine kleine Summe Geldes. Nicht viel. War dennoch anständig von ihm, dass er sie mir überlassen hat. Nicht jeder Bruder hätte das getan. Ich wollte ihm nur sagen, dass ich die Absicht habe, ihm die fragliche Summe wieder zurückzugeben.«
Dieser Plan stellte sicher einen Schritt in Aussicht, gegen den es ganz bestimmt keinen stichhaltigen Einwand zu geben schien. Dennoch ging mein Onkel, vielleicht geleitet durch die Macht der Gewohnheit, die Sache weiterhin sehr vorsichtig an. »Es ist nur eine Frage der Treuhänder«, sagte er ein- oder zweimal und begann daraufhin mit Erklärungen, die anzudeuten schienen, dass er auf den Gedanken gekommen war, über mich die neuesten Argumente für die Anpassung seiner Stiftungserträge zu präsentieren und dabei die Rückzahlung einer alten Schuld als saftigen Köder auszulegen. Alle Gründe, die vielleicht schon früher für die mir wegen des Auslandsaufenthaltes meines Vaters zugedachte Rolle des Vermittlers in diesen Verhandlungen vorgebracht worden wären, hatten sich durch die Nachricht, dass mein Vater in London zu finden sei, als völlig gegenstandslos erwiesen. Aber Zähigkeit in gewissen Dingen, und besonders im Hinblick auf die Stiftung, war einer von Onkel Giles’ bestimmenden Wesenszügen. Aus Gewohnheit weigerte er sich auch zu glauben, dass veränderte Umstände die Dinge beeinflussen könnten, über die er sich schon eine feste Meinung gebildet hatte. Er holte deshalb aus zu einem umfassenden Bericht über die Bestimmungen der Stiftung, seine eigenen finanziellen Schwierigkeiten, die Geduld, die er in der Vergangenheit sowohl gegenüber seinen Verwandten als auch der Welt insgesamt gezeigt habe, und die Reformen, die er für die Zukunft vorschlug.
»Ich bin kein großer Fachmann in geschäftlichen Dingen«, sagte er, »und ich beanspruche auch gar nicht, ein Finanzgenie zu sein oder irgend so was. Die einzige Ausbildung, die ich je hatte, war die zu einem Soldaten. Wir wissen, wie groß ihr Nutzen ist. Dennoch, ich hab auch so meine Erfahrungen gemacht. Ich bin in der Welt herumgekommen und hab mich hart durchgeschlagen. Vielleicht bin ich nicht ganz so grün, wie ich aussehe.«
Für einen Mann von einem normalerweise so ruhigen Betragen nahm mein Onkel eine fast wild-herausfordernde Haltung ein, als er das sagte; so als ob er erwarte, dass ich behaupten wolle, er sei in der Tat ›grün‹ oder wegen eines anderen ähnlichen Mangels ungeeignet, seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung zu halten. Ich aber glaubte ganz im Gegenteil, es müsse zugegeben werden, dass er in gewisser Hinsicht außergewöhnlich gut dafür ausgerüstet sei, für sich selbst zu sorgen. Jedenfalls war das kein Thema, zu dem ich mich mit ihm auf einen Disput eingelassen hätte. Es gab deshalb nichts anderes zu tun als zu versprechen, alles weiterzugeben, was er zu sagen hatte. Seine Meisterschaft im Erzählen seiner Unglücksgeschichte war von einer Art, wie sie nie von Leuten erreicht wird, die nicht völlig auf sich selbst konzentriert sind.
»Quand même«, sagte er nach einem gewaltigen Aufmarsch von Fakten und Zahlen, »ich glaube, es gibt so etwas wie Familiensinn?«
Ich murmelte etwas in mich hinein.
»Schließlich gab es mal den Jenkins, wegen dem der ›Krieg um Jenkins’ Ohr‹ gekämpft wurde.«
»Ja.«
»Wir stammen alle von ihm ab.«
»Nicht direkt.«
»In einer Seitenlinie dann.«
»Das ist nie bewiesen worden, oder?«
»Was ich sagen will, ist dies: Er war ein Verwandter, und das sollte uns zusammenhalten.«
»Nun, unser Vorfahr, Hannibal Jenkins, von Cwm Shenkin, zahlte die Feuerstellensteuer im Jahre 1674…«
Mit Recht, vielleicht, machte Onkel Giles eine Geste, als ob er Pedanterie – und besonders genealogische Pedanterie – in all ihren wechselnden Formen von sich weisen wolle. Gleichzeitig nahm er seinen Hut in die Hand. Er sagte: »Ich meine nur: Dass ich so etwas wie ein Radikaler bin, heißt noch lange nicht, dass ich auch glaube, die Familientradition zähle überhaupt nichts.«
»Natürlich nicht.«
»Glaub das nie.«
»Keineswegs.«