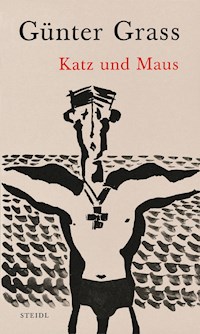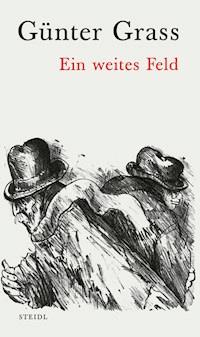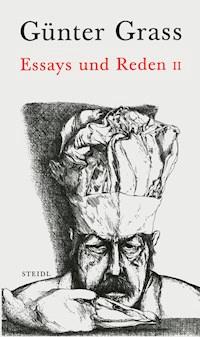Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1980: Ein Lehrerehepaar aus Itzehoe macht eine Ferienreise in den Fernen Osten. Ob in Bangkok, in Bombay oder auf Bali: Die Gedanken über ihr Heimatland werden sie trotz der andrängenden Bilder der Entwicklungsländer nicht los. Dafür sorgt schon der sich immer wieder einmischende Erzähler, dem mitten in Shanghai die Idee kommt, wie es wohl wäre, wenn nicht die Chinesen, sondern die Deutschen ein Volk von neunhundertfünfzig Millionen Menschen wären. Oder wenn, wie manche Politiker befürchten, die Deutschen ausstürben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Kopfgeburten oder
1
Zufuß zwischen Radfahrern, die sich in Haltung, Kleidung unendlich wiederholen, mitten im Radfahrerdschungel, in Shanghai, jener Stadt, in der elf von neunhundertfünfzig Millionen Chinesen leben, fremd in der Masse, fiel uns plötzlich als Spekulation eine Umkehrung an: in Zukunft habe die Welt mit neunhundertfünfzig Millionen Deutschen zu rechnen, während das chinesische Volk, nach Zählung der in zwei Staaten lebenden Deutschen, mit knapp achtzig Millionen Chinesen zu beziffern sei. Sogleich zwang sich mir eine deutschstämmige Zwischenrechnung auf, nach der, zur deutschen Masse gehörend, über hundert Millionen Sachsen und hundertzwanzig Millionen Schwaben auszögen, der Welt ihren gebündelten Fleiß anzudienen.
Wir erschraken inmitten der Radfahrervölker. Kann man sich das ausdenken? Darf man sich das ausdenken? Ist diese Welt vorstellbar: bevölkert von neunhundertfünfzig Millionen Deutschen, die sich, bei strikt eingehaltener Zuwachsrate von nur 1,2%, dennoch bis zum Jahre 2000 auf über eine Milliarde und zweihundert Millionen Deutsche auswachsen? Wäre der Welt das zuzumuten? Müßte die Welt sich nicht (aber wie?) dieser Zahl erwehren? Oder könnte die Welt so viele Deutsche (Sachsen und Schwaben inbegriffen) ertragen, wie sie zur Zeit über neunhundertfünfzig Millionen Chinesen erträgt?
Und was wäre als Ursache dieser Ausgeburt triftig? Unter welchen Voraussetzungen, nach welchem Endsieg hätten sich die Deutschen so erschreckend vermehren können? Durch Einordnen, Eindeutschen, durch Mutterkult und Lebensborn?
Um mich nicht weiter in Schlußfolgerungen zu verlieren, beruhige ich uns mit dem Gedanken: Es ließe sich, bei Wiederbelebung preußischer Traditionen, eine Milliarde Deutsche immerhin verwalten, wie die chinesische Beamtentradition ihrer Masse, trotz revolutionärer Schübe, Verwaltung garantiert.
Dann mußten Ute und ich wieder auf die Wirklichkeit, den Radfahrerverkehr achten. (Nur knapp gelang es mir, die Epiphanie zu vermeiden, inmitten deutscher Radfahrervölker zufuß bestehen zu müssen. Heil entkamen wir dem Verkehr und weiteren Erscheinungen, die uns hätten verstören können.) Doch als unsere Monatsreise uns von China her über Singapore, Manila und Kairo wieder nach München, Hamburg, Berlin brachte, war die deutsche Wirklichkeit gleichfalls von Spekulationen durchsetzt, diesmal von rückläufigen.
Um Stellen hinterm Komma wurde gestritten. Die christliche Opposition warf der Regierung vor, sie hindere die Deutschen, sich ordentlich zu vermehren. Sozialliberale Mißwirtschaft lasse die Menschenproduktion stagnieren. Schwund drohe dem deutschen Volk. Nur noch mit Hilfe der Ausländer gelinge es, sechzig Millionen zu bleiben. Das sei eine Schande. Denn wenn man von den Ausländern absehe — was nur natürlich sei und selbstverständlich sein sollte —, ließe sich das vorerst noch langsame, dann immer raschere Vergreisen, schließlich das Hinwegschwinden der Deutschen vorausberechnen, wie man ja andererseits den Millionenzuwachs der chinesischen Bevölkerung statistisch vorgewußt und bis zum Jahr 2000 hochgerechnet habe.
Es mag sein, daß jener hohe Staatsbesuch aus der Volksrepublik China, der sich mit der Bundestags- und Öffentlichkeitsdebatte über den deutschen Bevölkerungsschwund gleichzeitig hinzog, die Ängste der Opposition gefördert hat. Nun macht sie Angst. Und da die Angst in Deutschland immer gute Zuwachsraten gehabt hat und sich schneller als die Chinesen vermehrt, ist sie angstmachenden Politikern zum Programm geworden.
Die Deutschen sterben aus. Ein Raum ohne Volk. Kann man sich das vorstellen? Darf man sich das vorstellen? Wie sähe die Welt aus, gäbe es keine Deutschen mehr? Was finge die Welt mit sich an ohne die Deutschen? Müßte sie fortan am chinesischen Wesen genesen? Ginge den Völkern ohne die deutsche Zutat das Salz aus? Hätte die Welt ohne uns noch irgendeinen Sinn oder Geschmack? Müßte die Welt sich nicht neue Deutsche erfinden, inbegriffen Sachsen und Schwaben? Und wären die ausgestorbenen Deutschen im Rückblick faßlicher, weil nun in Vitrinen zur Ansicht gebracht: endlich von keiner Unruhe mehr bewegt?
Und weiter gefragt: gehört nicht Größe dazu, sich aus der Geschichte zu nehmen, dem Zuwachs zu entraten und nur noch Lehrstoff für jüngere Völker zu sein?
Da diese Spekulation langlebig zu sein verspricht, ist sie mir Thema geworden. Ich weiß noch nicht: wird es ein Buch oder Film? »Kopfgeburten« könnte der Film oder das Buch oder beides heißen und sich auf den Gott Zeus berufen, aus dessen Kopf die Göttin Athene geboren wurde; ein Widersinn, der männliche Köpfe heutzutage noch schwängert.
Im Reisegepäck hatte ich ein anderes Thema. Auf vierzehn Seiten Manuskript ausgebreitet, lag es obendrein in englischer Fassung bereit: »Die beiden deutschen Literaturen« — oder wie der Untertitel hätte heißen können: »Deutschland — ein literarischer Begriff«. Denn meine These, die ich in Peking, Shanghai und anderenorts vortragen wollte, sagt: Als etwas Gesamtdeutsches läßt sich in beiden deutschen Staaten nur noch die Literatur nachweisen; sie hält sich nicht an die Grenze, so hemmend besonders ihr die Grenze gezogen wurde. Die Deutschen wollen oder dürfen das nicht wissen. Da sie politisch, ideologisch, wirtschaftlich und militärisch mehr gegen- als nebeneinander leben, gelingt es ihnen wieder einmal nicht, sich ohne Krampf als Nation zu begreifen: als zwei Staaten einer Nation. Weil sich die beiden Staaten einzig materialistisch hier ausleben, dort definieren, ist ihnen die andere Möglichkeit, Kulturnation zu sein, versperrt. Außer Kapitalismus und Kommunismus fällt ihnen nichts ein. Nur ihre Preise wollen sie vergleichen.
Erst neuerdings, seitdem es mit der Zuwachsrate hapert und das liebe Öl nicht mehr fließt, wie es soll, sucht man nach positiven Inhalten: Zukost soll das leibeigne Vakuum stopfen. Man stochert nach geistigen Werten, die, um intellektuelle Spitzfindigkeiten auszuschließen, Grundwerte genannt werden. Ethik im Schlußverkauf. Tagtäglich kommt ein neuer Christusbegriff auf den Markt. Kultur ist in. Lesungen, Vorträge, Ausstellungen sind überlaufen. Theaterwochen wollen nicht enden. An Musik hört man sich satt. Wie ein Ertrinkender greift der Bürger zum Buch. Und die Schriftsteller des einen, des anderen deutschen Staates sind populärer, als es die Polizei des einen erlauben, die Demoskopie des anderen wahrhaben will; das ängstigt die Dichter.
Mit einfachen, vereinfachenden Sätzen wollte ich vom phasenverschobenen Entwicklungsprozeß der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur berichten, von ihrer unbeholfenen Direktheit und kargen Enge. Vor zweihundert (von neunhundertfünfzig Millionen) Chinesen sagte ich dann in Peking: »1945 war Deutschland nicht nur militärisch besiegt. Nicht nur die Städte und Industrieanlagen waren zerstört. Größerer Schaden lag vor: die Ideologie des Nationalsozialismus hatte die deutsche Sprache um ihren Sinn betrogen, hatte sie korrumpiert und in weiten Wortfeldern verwüstet. In dieser verletzten Sprache, alle Beschädigungen mitschleppend, begannen die Schriftsteller mehr zu stammeln als zu schreiben. Gemessen wurde ihre Hilflosigkeit an Thomas Mann, Brecht, an den Riesen der Emigrationsliteratur; gegen deren schon klassische Größe konnte nur Stottern als Form bestehen.«
Da sagte einer von den wenigen Chinesen, die sich hatten versammeln dürfen: »So geht es uns heute. Um zehn Jahre hat uns die Viererbande« (er meinte: die Kulturrevolution) »betrogen. Nichts wissen wir. Dumm stehen wir da. Alles, sogar unsere Klassiker waren verboten. Und auch die Sprache haben sie verkrüppelt. Nun beginnen einige Schriftsteller vorsichtig, oder wie Sie sagen, stammelnd, zu erzählen, was wirklich ist. Sie schreiben, was auch verboten war: über Liebe und so. Natürlich ohne die gewisse Körperlichkeit. Da sind wir noch immer ein bißchen streng. Sie wissen ja, bei uns darf man erst spät heiraten. Natürlich gibt es Gründe dafür: das Bevölkerungsproblem. Wir sind ein bißchen viele geworden, nicht wahr. Und Verhütungsmittel bekommen nur Ehepaare. Niemand hat bisher die Not der jungen Leute beschrieben. Sie haben keinen Platz für sich. Sie dürfen sich nicht haben.«
Der das in seinem blauen Zeug sagte, mochte Anfang Dreißig sein. Sein Deutsch hatte er trotz und während der Kulturrevolution aus Lehrbüchern gelernt, die er mit ideologisch üblichen Schutzumschlägen tarnen mußte. Nach dem Fall der »Viererbande« durfte er für ein Jahr nach Heidelberg, wo er seine Kenntnisse auf bundesdeutschen Stand brachte. »Wir, unsere Generation«, sagte er, »ist echt verblödet worden.« Heute ist er Lehrer, der sich weiterbilden will. »Wir lernen jetzt ziemlich viel. Achtunddreißig Unterrichtsstunden die Woche…«
Mein Lehrerehepaar — diese Kopfgeburt! — kommt aus Itzehoe, einer Kreisstadt in Holstein, zwischen Marsch und Geest gelegen, mit rückläufiger Einwohnerzahl und wachsenden Sanierungsschäden. Er ist Mitte, sie Anfang Dreißig. Geboren wurde er in Hademarschen, wo immer noch seine Mutter lebt, sie in der Kremper Marsch, wo ihre Eltern, nach Verkauf des Hofes, ihren Altenteil in Krempe bezogen haben. Beide sind anhaltend sich selbst reflektierende Veteranen des Studentenprotestes. In Kiel haben sie sich kennengelernt: bei einem Sit-in gegen den Vietnamkrieg oder gegen den Springer-Konzern oder gegen beides. Ich sage vorläufig Kiel. Es hätte auch Hamburg, womöglich Berlin sein können. Vor zehn Jahren wollten sie mit vielen Wörtern »kaputtmachen, was uns kaputtmacht«. Gewalt erlaubten sie sich allenfalls gegen Sachen. Ihre Kulturrevolution ging schneller zu Ende. Deshalb haben sie ihr pädagogisches Studium mit kaum nennenswerter Verzögerung abschließen und nach nur kurzem Hinundher — Partnerwechsel in Wohngemeinschaften — heiraten können: zwar ohne Kirche, doch mit Familie.
Das war vor sieben Jahren. Seit fünf und vier Jahren sind beide beamtet im Staatsdienst. Zwei Referendare, dann Assessoren, jetzt Studienräte. Zwei, die sich ziemlich gleichmäßig liebhaben. Ein Paar zum Vorzeigen. Ein Paar zum Verwechseln schön. Ein Paar aus dem gegenwärtigen Bilderbuch. Sie halten sich eine Katze und haben noch immer kein Kind.
Nicht, weil es nicht geht oder klappt, sondern weil er, wenn sie »nun endlich doch« ein Kind will, »noch nicht« sagt, sie hingegen, wenn er sich ein Kind wünscht — »Ich kann mir das vorstellen, theoretisch« —, wie aufs Stichwort dagegenhält: »Ich nicht. Oder nicht mehr. Man muß das versachlichen, wenn man verantwortlich handeln will. In was für eine Zukunft willst du das Kind laufen lassen? Da ist doch keine Perspektive drin. Außerdem gibt es genug davon, zu viele Kinder. In Indien, Mexiko, Ägypten, in China. Guck dir mal die Statistiken an.«
Beide unterrichten Fremdsprachen — er Englisch, sie Französisch — in der Kaiser-Karl-Schule, kurz KKS genannt, und im Nebenfach Geografie. Die Kaiser-Karl-Schule heißt so, weil Karl der Große im neunten Jahrhundert eine Strafexpedition nach Holstein geschickt hat, die sich etwa da einmauerte, wo heute Itzehoe auseinandergeht. Und weil die beiden besonders gerne Geografie unterrichten, wissen sie auch über Bevölkerungswachstum Bescheid, nicht nur über Flüsse, Gebirge, Bodenbeschaffenheit und Erzvorkommen. Er spricht mit Marx vom kapitalistischen Gesetz der Akkumulation durch Überzähligmachung, sie pocht auf Daten, Kurven, Hochrechnungen: »Hier, der Zuwachs in Südamerika. Überall drei Prozent. In Mexiko sogar fünf. Die fressen das bißchen Fortschritt auf. Und der Papst, dieser Blödmann, verbietet noch immer die Pille.«
Sie nimmt sie regelmäßig. Übrigens immer zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde. Eine Schrulle oder schrullige Demonstration ihres rationalisierten Verzichtes. Und so könnten die »Kopfgeburten« als Film anfangen: Totale der Landkarte des indischen Subkontinents. Sie, in Brusthöhe angeschnitten, verdeckt halb den Golf von Bengalen, ganz Kalkutta und Bangladesh, nimmt wie beiläufig die Pille, klappt ein Buch zu (trägt keine Brille) und sagt: »Wir können davon ausgehen, daß im Bundesstaat Indien die Geburtenkontrolle, im Sinne der angestrebten Familienplanung, gescheitert ist.«
Jetzt könnte sie die Bevölkerungszahlen und Überschüsse der Bundesstaaten Bihar, Kerala, Uttar Pradesh abfragen, ohne daß die Klasse ins Bild kommt: die in Zahlen geleierte indische Misere. Der Schulstoff Elend. Die Zukunft.
Deshalb sagte ich zu Volker Schlöndorff, den wir mit Margarethe von Trotta in Djakarta und danach in Kairo trafen: »Wir sollten, wenn wir den Film machen, in Indien drehen oder auf Java oder — nachdem ich jetzt dagewesen bin — in China, falls wir da Dreherlaubnis bekommen.«
Denn unser Lehrerehepaar soll eine Reise machen, wie Ute und ich, Volker und Margarethe unsere Reisen machen. Und wie wir soll es fremd dazwischenstehen und schwitzend die Wirklichkeit mit der Statistik vergleichen. Der Luftsprung von Itzehoe nach Bombay. Die Zeitverschiebung. Das Angelesene im Handgepäck. Ihr Vorwissen. Ihre Schutzimpfungen. Der neue Hochmut: Wir kommen, um zu lernen…
Dabei riechen sie vordringlich nach Angst. Es könnte beide (wie uns in Shanghai) mitten in Bombay, wo es wimmelt, die Spekulation anfallen: es habe die Welt, anstelle der Inder, mit siebenhundert Millionen Deutschen zu rechnen. Doch diese Zwischengröße paßt nicht zu uns. Sie ist, nach deutschem Maß, nicht spekulativ genug. Wir sterben entweder aus, oder wir werden eine Milliarde zählen. Entweder oder.
Die Schlöndorffs und wir reisen beruflich mit »Goethe«. Trotz dichten Programms ist das einfacher. Sie zeigen ihre Filme, ich lese aus meinen Büchern. Unser Lehrerehepaar will sich in den Ferien informieren, deshalb bucht es bei einem Unternehmen, das laut Prospekt »wirklichkeitsorientierte« Reisen verspricht. Wie es bei »Goethe« läuft, weiß ich; die Reisegesellschaft (und ihr »knallhartes« Programm) muß mir noch einfallen. Wir sind auf die Leiter der Goethe-Institute angewiesen; unser Lehrerehepaar wird einem angestellten Reisebegleiter folgen, der immer Bescheid weiß: wo man Ganesh-Figürchen oder javanische Marionetten kaufen kann, daß seitliches Kopfwiegen in Indien Bejahung bedeutet, was man essen soll, was nicht, wieviel Trinkgeld bei Rikschafahrten fällig ist und ob man, wenn sie zu zweit, natürlich in Begleitung eines zu honorierenden Einheimischen, diesen oder jenen Slum besichtigen, auch die Slumbewohner fotografieren darf.
Kein Wort über die Leiter der Goethe-Institute und ihre privaten Verstörungen. Von unserem angestellten Reiseleiter, der für den Film, den wir drehen wollen, Hinduistik studiert hat, läßt sich sagen: er könnte ein vergreistes Babygesicht zeigen. Sein wäßriger Blick beweist Übersicht. Eine Art lieber Gott mit Nickelbrille. Zu allem hat er zwei Meinungen.
Wie wir. Einerseits ist der Bau von Atomkraftwerken ein nicht einzuschätzendes Risiko; andererseits können nur die neuen Technologien den uns gewohnten Wohlstand sichern. Einerseits gibt die manuelle Bodenbearbeitung achthundert Millionen chinesischer Bauern Arbeit und Nahrung; andererseits kann nur eine technisierte Landwirtschaft die Hektarerträge steigern, wodurch einer- wie andererseits über die Hälfte der Bauern arbeitslos oder für andere Aufgaben — man weiß noch nicht, welche — freigestellt werden würde. Einerseits sollte man die Slums in Bangkok, Bombay, Manila und Kairo sanieren; andererseits locken sanierte Slums immer mehr Landflüchtige in die Städte. Einerseits andererseits.
Und auch unser Lehrerpaar aus Itzehoe — das liegt bei Brokdorf — ist politisch, privat und überhaupt auf das mitteleuropäische Gesellschaftsspiel »Einerseits-andererseits« abgestimmt. Sie macht bei der FDP mit; er versorgt die umliegenden Ortsvereine der SPD mit Vorträgen zum Thema »Dritte Welt«. Beide sagen: »Einerseits haben die Grünen recht, doch andererseits bringen sie Strauß an die Macht.«
Das und noch mehr ist kaum auszuhalten im Kopf. Er vermißt Perspektiven, sie eine Sinngebung allgemein. Ihre Launen, sein nachmittägliches Durchhängen. Sie wirft ihrem Vater vor, daß er den Hof »der Eierindustrie verscherbelt hat«; er will eigentlich seine Mutter, die in Hademarschen nur noch für sich sorgt, in den Lehrerhaushalt aufnehmen, sucht aber dennoch, nach seinen Worten »vernünftigerweise«, ein gut geführtes Altersheim. Sie, die prinzipiell auf Mutterschaft fixiert ist, sieht sich, seitdem der indische Subkontinent ihren Geografieunterricht belastet, wieder einmal dem Verzicht auf das Kind verpflichtet. Er, dem die Schulkinder genug und zum Wochenende mehr als genug sind, meint neuerdings: »Also groß genug für drei ist unsere Altbauwohnung mit Gartenauslauf allemal, selbst wenn Mutter hierherzieht.«
Sie machen es sich nicht leicht. Das Kind bleibt Thema. Ob sie in Itzehoes Holstein-Center einkaufen oder sich auf den Elbdeich bei Brokdorf stellen, ob auf der Doppelmatratze oder bei der Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen: immer spricht das Kind mit, schielt nach Babysächelchen, will über den Elbstrand krabbeln, wünscht sich beim Eisprung den belebenden Guß und fordert Autotüren mit Kindersicherung. Doch es bleibt beim Alsob und Angenommenwenn, wobei Harms Mutter (als Ersatzkind) mal in die Lehrerwohnung aufgenommen, dann wieder in ein Altersheim abgeschoben wird, bis ein vormittäglicher Schock die eingespurten Wechselreden entgleisen läßt.
Als die Studienrätin Dörte Peters ihrer 10a während der Geografiestunde die Familienplanung von der Verhütungsaufklärung bis zur freiwilligen Sterilisierung als Programm gegen die Überbevölkerung diktiert, springt eine Schülerin (blond wie Dörte Peters) auf und wird schön durch Protest: »Und was ist bei uns? Kein Zuwachs mehr. Immer weniger Deutsche. Warum haben sie eigentlich keine Kinder? Warum nicht! In Indien, Mexiko, China nehmen sie zu wie verrückt. Und wir hier, die Deutschen sterben aus!«
Schlöndorff und ich wissen noch nicht, wie sich die Klasse zu dieser Anklage verhält. Ist dieser Ausbruch auf das Elternhaus der Schülerin zurückzuführen? Sollte nicht besser ein Schüler, mit Seitenhieb auf die Gastarbeiter, wie enthemmt sein: »In Itzehoe werden fast nur noch Türkenbabys abgenabelt!«? Oder sollten Schülerin und Schüler nacheinander ihre Anwürfe steigern?
Jedenfalls verbreitet die Behauptung »Die Deutschen sterben aus!« (nach kurzem, verschreckt abbrechendem Gelächter der Klasse) jene nicht faßbare, sogar die Gymnasiallehrerin Dörte Peters besetzende Angst, die, mit anderen Ängsten gemischt, den Treibsatz abgeben wird für Sätze, die ins kommende, ins Wahljahr hinein Franz Josef Strauß sprechen oder sprechen lassen wird.
»Noch eine Schwierigkeit«, sagte ich zu Schlöndorff. »Wenn wir achtzig drehen wollen, geht das nur im Juli August. Davor und danach ist Wahlkampf. Ich weiß nicht, was du machen wirst. Aber nur zugucken will ich nicht. Es könnte zu viele Leute geben, die sich ihre kleine Lust am Untergang bestätigen lassen wollen.«
In Pekings Universität und im Fremdspracheninstitut Shanghai wurde nicht nach deutschen Wiedervereinigungsplänen gefragt, in denen die Volksrepublik China eine Rolle zu spielen hätte. Ich weiß auch nicht, ob meine These von der zuletzt verbliebenen Möglichkeit zweier deutscher Staaten einer Kulturnation bei den chinesischen Studenten und ihren Lehrern jenes Interesse fand, das bei uns ausbleibt. Ich sagte: »Unsere Nachbarn in Ost und West werden eine Ballung wirtschaftlicher und militärischer Macht in der Mitte Europas nie wieder dulden nach der Erfahrung zweier Weltkriege, die dort gezündet wurden. Doch könnte die Existenz der beiden deutschen Staaten unter dem Dach eines gemeinsamen Kulturbegriffes unseren Nachbarn verständlich und dem Nationalverständnis der Deutschen angemessen sein.«
Eine Illusion mehr? Literatenträume? Ist meine Behauptung, die ich in Peking und Shanghai, danach anderenorts wie ein närrischer Wanderprediger vortrug — es hätten sich die deutschen Schriftsteller, im Gegensatz zu ihren separatistischen Landesherren, als die besseren Patrioten bewiesen — nur eine Trotzgebärde? Mit Beweisen von Logau und Lessing bis zu Biermann und Böll zur Hand, setzte ich einfältig (womöglich rührend in meiner Einfalt) Kenntnis der deutschen Kultur und ihrer Entwicklung voraus. (Selbst meine beiden Lehrer, die nun Harm und Dörte Peters heißen, winken ab und sind überfordert. »Mann«, sagt Harm, »sowas läuft nur im Dritten Programm.«)
Wer heimkehrt, findet sich vor. Als wir aus Asien heimkehrten, standen neben dem chinesischen Staatsbesuch und der Angst vor dem Aussterben der Deutschen, neben Bahros Umzug von Ost nach West und der allabendlichen Fernsehteilnahme am Völkermord in Kambodscha auch die Nachwehen der Frankfurter Buchmesse auf der Tagesordnung. Während dreißig Jahren, solange der eine deutsche Staat neben dem anderen besteht, war es immer wieder zwingend gewesen, die NS-Vergangenheit etwa des Adenauer-Staatssekretärs Globke, des Bundeskanzlers Kiesinger, des Ministerpräsidenten Filbinger, des derzeitigen Bundespräsidenten Carstens aus Akten zu ziehen, die sich (wie selbsttätig) verlegt hatten; nun war in der Wochenzeitung »Die Zeit« unter der Überschrift »Wir werden weiterdichten, wenn alles in Scherben fällt« ein Aufsatz erschienen, der den Beginn der deutschen Nachkriegsliteratur bis in die Nazizeit vordatierte und das Jahr 1945 als Stunde Null bestritt.
Dieser Aufsatz löste Streit aus, der sich hinzieht. Unbestritten soll die Keuschheit der Nachkriegsliteratur, besonders jener Autoren bleiben, die während der Zeit des Dritten Reiches Deutschland nicht verlassen und ihre Werke in jenem Freigehege veröffentlicht haben, das ihnen die Nazis eingeräumt hatten; weil aber die den Streit auslösenden Thesen mit einigen nur halbgenauen, also ungenauen Hinweisen gespickt waren, die die Nähe einiger Autoren zu NS-Institutionen belegen sollten, wird jetzt das eigentliche Thema nebensächlich verhandelt, doch mit Fleiß die Blöße wahrgenommen, die sich der Autor des umstrittenen Aufsatzes gegeben hat.
Denunziant wird er genannt. Wie ein Feind soll er vernichtet werden. Im kalten Schrott hat er ein heißes Eisen gefunden und angefaßt, öffentlich angefaßt. Zum Abschuß freigegeben, schlägt er nun Haken. Wie lange noch? Die Verletzung eines Tabus wird nach entsprechenden Riten geahndet.
Sobald sich die Deutschen — Täter wie Opfer, Ankläger und Beschuldigte, die Schuldigen und die nachgeborenen Unschuldigen — in ihre Vergangenheit verbeißen, nehmen sie eingefleischte Positionen ein, wollen sie recht behalten, recht bekommen. Blindlings — im Irrtum noch — machen sie deutsche Vergangenheit gegenwärtig, ist wieder die Wunde offen und wird die Zeit, die verstrichene, die glättende Zeit aufgehoben.
Ich nehme mich nicht aus. Als hätte ich mein deutsches Bewältigungsgepäck mit nach Asien, bis hin nach Peking verschleppt, fragte ich meine chinesischen Kollegen (bei Tee und Süßigkeiten), wie man denn mit jenen Schriftstellern verfahre, die sich zwölf Jahre lang der Kulturrevolution, der »Viererbande« verschrieben hatten. In landesüblich umschreibender Weise antwortete man mir: Während der schlimmen Jahre sei Literatur verboten gewesen. Eisiger Wind habe nichts blühen lassen, nur einem einzigen Autor sei es, als Günstling der Viererbande, erlaubt gewesen, mit acht Stücken das vorher leergefegte Programm der Peking-Oper zu füllen. Ja, der dürfe sich noch immer Mitglied des Schriftstellerverbandes nennen. Er werde Mitglied bleiben und habe mittlerweile ein neuntes Stück geschrieben. Das sei dramaturgisch wirkungsvoll wie die anderen. Ein großes Talent. Man diskutiere mit ihm.
Wir hätten in beiden deutschen Staaten den Ausschluß aus dem jeweiligen Schriftstellerverband gefordert. (Man wolle nicht, wurde mir in Peking höflich versichert, die Fehler der Viererbande wiederholen.) Welche und wessen Fehler wiederholen wir?
Mein Lehrerehepaar aus Itzehoe an der Stör wurde nach dem Krieg, er fünfundvierzig, sie achtundvierzig geboren. Sein Vater fiel kurz vor Schluß in der Ardennenschlacht. Ihr Vater kam Anfang siebenundvierzig aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück: ein frühgealterter Jungbauer. Da Harm und Dörte den Faschismus nicht kennen, sind beide schneller mit dem Wort zur Hand, als sie sich wechselseitig erlauben wollen. Das Wort ist so griffig. Immer paßt es ein bißchen. Mundgerecht zischt es wie der Name des Kandidaten.
»Nein«, sagt Harm. »Er ist kein Faschist.«
»Unbewußt doch«, sagt Dörte, »sonst würde er nicht so rasch, wenn er auf Widerspruch stößt, mit dem Schlagwort ›Faschisten! Ihr roten Faschisten!‹ zuhauen.« Sie einigen sich auf das Wort »latent«.