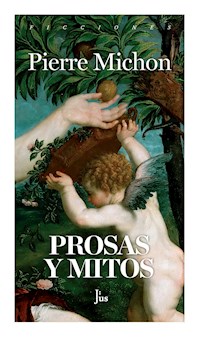16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
September 2001, Pierre Michons Mutter liegt im Sterben, der Sohn „betet“ für sie: ein Villon-Gedicht, die „Ballade der Gehenkten“. Auch nach der Geburt seines Kindes hat er „gebetet“: ein Gedicht von Victor Hugo, „Der Schlaf des Boas“. Solche Verse, resümiert Michon in seinem autobiographisch erklärenden Essay „Der Himmel ist ein sehr großer Mann“, „… beruhigen die Leiche, helfen dem Kind, auf seinen Beinen zu stehen. Wahrscheinlich ist das die Funktion der Poesie.“ Auch in den weiteren Essays des Bandes geht es um nichts anderes als die ebenso erhabene wie lächerliche Berufung der Kunst. Michon schreibt über Samuel Beckett, Gustave Flaubert, Ibn Manglî, William Faulkner und eben über sich selbst – so pathetisch und sarkastisch, resolut und poetisch, wie nur er das kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Als im September 2001 des Autors Mutter im Sterben liegt, »betet« der Sohn für sie ein Gedicht, Villons »Ballade der Gehenkten«. Auch nach der Geburt seines Kindes hat er »gebetet«: ein Gedicht von Victor Hugo, »Der Schlaf des Boas«.
Solche Verse, resümiert Pierre Michon in seinem autobiographisch erklärenden Essay »Der Himmel ist ein sehr großer Mann«, »beruhigen die Leiche, helfen dem Kind, auf seinen Beinen zu stehen. Wahrscheinlich ist das die Funktion der Poesie.«
Auch in den weiteren Essays dieses Bandes geht es um nichts anderes als die ebenso erhabene wie lächerliche Berufung der Kunst. Michon schreibt über Samuel Beckett, Gustave Flaubert, Ibn Manglî, William Faulkner und eben über sich selbst – so pathetisch und sarkastisch, resolut und poetisch, wie nur er das kann.
Pierre Michon, geboren am 28. März 1945 in Les Cards (Massif Central), lebt in Nantes. Er wurde 1984 mit Leben der kleinen Toten bekannt (BS 1475) und gilt heute als einer der wichtigsten französischen Schriftsteller der Gegenwart. Weiterhin erschienen auf deutsch die Erzählungen Rimbaud der Sohn (BS 1437), Die Grande Beune (BS 1463) und Die Elf (BS 1474).
Pierre MichonKörper des Königs
Aus dem Französischenvon Anne Weber
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Corps du roibei Éditions Verdier, Lagrasse.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© Éditions Verdier, 2002
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlag: Konzept von Willy Fleckhaus
Umschlagfoto: Jean-Luc Bertini
Körper des Königs
Für Yaël Pachet
DIE ZWEI KÖRPER DES KÖNIGS
Es ist das Jahr 1961. Herbst oder Winteranfang. Samuel Beckett sitzt. Seit zehn Jahren ist er König – seit ein bißchen weniger oder ein bißchen mehr als zehn Jahren: acht, seit der Uraufführung von Godot, elf, seit Jérôme Lindon begann, geballt seine großen Romane zu veröffentlichen. Es gibt in Frankreich niemanden, der ihm ein Gegenspieler sein oder ihm den Thron streitig machen könnte, auf dem er sitzt. Der König hat, wie man weiß, zwei Körper: einen ewigen, dynastischen, den der Text weiht und inthronisiert und den man nach Belieben Shakespeare, Joyce, Beckett oder Bruno, Dante, Vico, Joyce, Beckett nennt, der aber immer derselbe unsterbliche Körper bleibt, gehüllt in provisorische, abgetragene Kleider; und einen zweiten, sterblichen, funktionalen, relativen Körper, eine hinterlassene Kutte, einen Körper, den man zum Aas wirft, der Dante und nur Dante heißt und über der platten Nase eine Mützchen trägt, nur Joyce und dann ist seine Hand beringt, und er blickt kurzsichtig und verdutzt, nur Shakespeare, und er ist ein guter dicker Privatier mit elisabethanischer Halskrause. Oder er trägt den Kerkernamen Samuel Beckett, und in dem Gefängnis dieses Namens sitzt er im Herbst 1961 vor dem Objektiv von Lütfi Özkök, Türke, Fotograf – ein ästhetisierender Fotograf, der hinter seinem dunkel gekleideten Modell ein dunkles Laken gespannt hat, um dem Porträt, das er machen wird, etwas von einem Tizian oder einem Philippe de Champaigne, etwas Klassisch-Bedeutsames zu verleihen. Die Manie oder der Beruf dieses Türken ist es, Schriftsteller zu fotografieren, also mit großer Kunstfertigkeit, List und Technik das Porträt der zwei Körper des Königs anzufertigen, das gleichzeitige In-Erscheinung-Treten des Autorkörpers und seiner sporadischen Inkarnation, des lebendigen Wortes und des saccus merdae. Auf demselben Bild.
All das weiß Beckett, weil es ein Kinderspiel ist – und weil er König ist. Er weiß auch, daß mit ihm, für ihn dieser Zauberstreich leichter fällt als für Dante oder Joyce, denn im Unterschied zu Dante oder Joyce ist er schön: schön wie ein König, die eisigen Augen, die Illusion des Feuers unter dem Eis, die strengen und vollkommenen Lippen; das ihm angeborene noli me tangere; und, höchster Luxus, seine Schönheit trägt Stigmata: die himmlische Magerkeit, die von Hiobs Scherbe eingegrabenen Falten, die großen Ohren aus Fleisch, der König-Lear-Look. Er weiß, daß es für ihn zu einfach ist – als hätte der dicke elisabethanische Privatier den Kopf des Königs Lear gehabt; und daß man schwerlich jenen saccus merdae mit Namen Samuel Beckett fotografieren kann, ohne daß im gleichen Augenblick das Porträt des Königs erscheint, die Literatur in Person, und zugleich, schön sichtbar neben den eisigen Augen und den großen Ohren, Dantes Kappe, die elisabethanische Halskrause und in einer Ecke, sichtbar oder nicht, Hiobs Scherbe.
Freut sich Samuel Beckett an diesem biologischen Zufall oder dieser immanenten Gerechtigkeit an jenem Herbsttag des Jahres 1961? Verspürt er deswegen Eitelkeit, Abscheu oder eine ungeheure Lachlust? Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, daß er es akzeptiert. Er sagt: Ich bin der Text, warum soll ich nicht die Ikone sein? Ich bin Beckett, warum soll ich nicht dessen Erscheinung haben? Ich habe meine Sprache getötet und meine Mutter, ich bin am Tag der Kreuzigung geboren, ich habe, ineinandergeflossen, die Züge des heiligen Franziskus und Gary Coopers, die Welt ist ein Theater, die Dinge lachen, Gott oder das Nichts frohlockt, spielen wir also das Spiel und beachten wir die Formen. Machen wir weiter. Er streckt die Hand aus, nimmt eine weiße Boyard, Großformat, zündet sie an und hängt sie sich in den Mundwinkel, wie Bogart, wie Guevara, wie ein Metallarbeiter. Sein Eisauge packt den Fotografen, wirft ihn wieder fort. Noli me tangere. Eine Flut von Zeichen. Der Fotograf drückt auf den Auslöser. Die zwei Körper des Königs werden sichtbar.
KÖRPER AUS HOLZ
Freitag, 16. Juli 1852. Der Tag bricht an. Die Nacht geht zu Ende. Es hat geregnet, es regnet nicht mehr. Große schieferfarbene Wolken eilen am Himmel vorüber. Flaubert hat nicht geschlafen. Er geht aus dem Haus in Croisset in den Garten hinaus: die Linden, dann die Pappeln, dann die Seine. Der Pavillon am Ufer. Er hat den ersten Teil von Madame Bovary beendet.
Am Sonntag schreibt er Louise Colet, er habe sich an jenem Freitag im Morgengrauen stark gefühlt, ruhigen Gemüts, es gab einen Sinn, es gab ein Ziel.
Der Morgenwind tut ihm gut. Er hat ein schönes, dickes, müdes Gesicht, ein schönes, dickes, ausgeruhtes Gesicht. Er liebt die Literatur. Er liebt die Welt.
»In Ermangelung von Privatleben, Haus, Vaterland, Partei et cetera machte er aus der Literatur seinen Lebenszweck, und der Ernst, mit dem er die literarische Welt betrachtet, zieht einem das Herz zusammen.« Diese Worte Pasolinis beziehen sich auf Gombrowicz. Aber sie könnten sich ebensogut auf Flaubert beziehen, und das Herz zöge sich einem nicht weniger, vielleicht noch mehr zusammen. Denn Flaubert hatte zwar ein Privatleben (wie übrigens Gombrowicz, aber Pasolini ist immer sehr schnell), gab jedoch vor, keines zu haben, ebenso wie er vorgab, weder Haus noch Vaterland noch Freiheit zu haben, weder eine Mutter namens Caroline noch eine verwaiste Nichte, auch mit Namen Caroline, weder die am Ende ihres Weges angelangte Seine, die vor seinen Augen vorüberrollte, noch Meiereien auf den Hügeln der Normandie, weder Dutzende von Jüngern und Schmeichlern noch Diener, die unentgeltlich in Paris in den Korridoren der Schönen Literatur und der Presse für ihn zugange waren – alles Dinge, die Gombrowicz tatsächlich nicht hatte, Flaubert aber sehr wohl. Flaubert gab vor, nichts von all dem zu haben, was er hatte, und diese Verstellung wurde ihm eine Wirklichkeit; er bastelte sich eine Maske, die mit seiner Haut verwuchs und mit der er seine Bücher schrieb; die Maske klebte so fest, daß er, als er sie abnehmen wollte, unter dem dicken Clowns-Schnurrbart nur eine unsägliche Mischung aus Fleisch und Pappmaché ertastete. Und doch spielte er nicht den Clown – er spielte den Mönch; und das nicht nur für die anderen, sondern für sich selbst, in seinen eigenen Augen: er war ein Barfüßermönch nicht nur auf der Straße und für die guten Seelen, sondern auch wenn er nach Hause ging, mochte er auch Seidenpantoffeln an den Füßen tragen. Die Seine, die vor seinen Augen floß – er nahm sie sich weg; das kleine Mädchen, das ihm tagaus, tagein um die Beine streifte und das er in all seinen Büchern umbringt – er sah es kaum; die schönsten jungen Frauen seiner Zeit, und wahrscheinlich auch die feinsinnigsten, die etwas für ihn übrig hatten und die er bei Gelegenheit auch besaß – er nahm sie sich weg, ob er sie nun besessen hatte oder beschloß, sie nicht mehr zu besitzen, was auf das gleiche herauskam; keine Äpfel auf den Apfelbäumen der Normandie, keine Bäume tief in den Wäldern, keine Louise Colet im aufgeschnürten Mieder, kein Flieder, kein junges Lachen, keine von Louise Colet vor seiner Tür vergossenen Tränen; er pfiff darauf, er lachte darüber und pfiff darauf, er weinte und pfiff darauf, er war nicht da. Er hatte tatsächlich nichts, ihm war alles entzogen, denn es warin seinem Kopf.