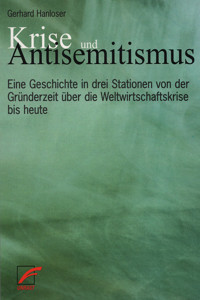
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Zusammenhang von ökonomischen Krisen und dem Auftreten von Antisemitismus wurde in den klassisch marxistischen Positionen zur Genüge beschrieben. Dabei kam es zu einer sträflichen Vernachlässigung politischer, psychologischer und spezifisch historischer Dispositionen und Konstellationen. Auf der anderen Seite entstand eine bürgerliche Antisemitismustheorie, in der der offensichtliche Zusammenhang von gesellschaftlichen Krisen und Erstarken von Antisemitismus unterschätzt wurde, zugunsten einer toleranzverkündenden Ablehnung von ›Vorurteilen‹. Das Buch beschreibt auf dem Hintergrund der Marxschen Krisentheorie die großen Kriseneinbrüche und die in ihnen auftretende Wirkungsmächtigkeit des Antisemitismus. Eine besondere Rolle spielt hier die Behandlung und Wahrnehmung des Geldes in der Krise. Geld wird hier nicht nur als ›ökonomische‹ Größe, sondern als die zentrale Bezugsgröße im Kapitalismus angesehen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse fetischisiert und zu antisemitischen Ideologien einlädt. Anhand von drei Fallstudien wird dieser Zusammenhang aufgezeigt: die Gründerkrise 1873, in deren Verlauf moderne antisemitische Parteien und Agitatoren zum ersten Mal in Deutschland die Börse mit dem Judentum gleichsetzten, die Weltwirtschaftskrise 1929 und die nationalsozialistische Antwort darauf, sowie die heutige Zeit der krisenhaften ›New Economy‹. Gleichzeitig setzt sich der Autor mit der Kritischen Theorie und der zentralen Schrift von Moishe Postone über “Nationalsozialismus und Antisemitismus” auseinander, neben Marx als Krisentheoretiker und Geschichtsphilosoph der Revolution wird Friedrich Nietzsche als dunkler Theoretiker der Krise diskutiert. Darin wie sich in der Gründerzeit, im Nationalsozialismus und heute auf Nietzsche bezogen wird, werden die proteusartigen Diskurselemente Nietzsches deutlich, der aus ideologiekritischer Sicht gleichzeitig als Förderer und Bekämpfer antisemitischer Motive erscheint. Wie die Person Nietzsche selbst ist auch das Verhältnis von Antisemitismus und Krise von Inkohärenz und Unabgeschlossenheit geprägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Zusammenhang von ökonomischen Krisen und dem Auftreten von Antisemitismus wurde in den klassisch marxistischen Positionen zur Genüge beschrieben. Dabei kam es zu einer sträflichen Vernachlässigung politischer, psychologischer und spezifisch historischer Dispositionen und Konstellationen. Auf der anderen Seite entstand eine bürgerliche Antisemitismustheorie, in der der offensichtliche Zusammenhang von gesellschaftlichen Krisen und Erstarken von Antisemitismus unterschätzt wurde, zugunsten einer toleranzverkündenden Ablehnung von »Vorurteilen«.
Das Buch beschreibt auf dem Hintergrund der Marxschen Krisentheorie die großen Kriseneinbrüche und die in ihnen auftretende Wirkungsmächtigkeit des Antisemitismus. Eine besondere Rolle spielt hier die Behandlung und Wahrnehmung des Geldes in der Krise. Geld wird hier nicht nur als »ökonomische« Größe, sondern als die zentrale Bezugsgröße im Kapitalismus angesehen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse fetischisiert und zu antisemitischen Ideologien einlädt. Anhand von drei Fallstudien wird dieser Zusammenhang aufgezeigt: die Gründerkrise 1873, in deren Verlauf moderne antisemitische Parteien und Agitatoren zum ersten Mal in Deutschland die Börse mit dem Judentum gleichsetzten, die Weltwirtschaftskrise 1929 und die nationalsozialistische Antwort darauf, sowie die heutige Zeit der krisenhaften »New Economy«.
Gleichzeitig setzt sich der Autor mit der Kritischen Theorie und der zentralen Schrift von Moishe Postone über »Nationalsozialismus und Antisemitismus« auseinander, neben Marx als Krisentheoretiker und Geschichtsphilosoph der Revolution wird Friedrich Nietzsche als dunkler Theoretiker der Krise diskutiert. Darin wie sich in der Gründerzeit, im Nationalsozialismus und heute auf Nietzsche bezogen wird, werden die proteusartigen Diskurselemente Nietzsches deutlich, der aus ideologiekritischer Sicht gleichzeitig als Förderer und Bekämpfer antisemitischer Motive erscheint. Wie die Person Nietzsche selbst ist auch das Verhältnis von Antisemitismus und Krise von Inkohärenz und Unabgeschlossenheit geprägt.
Der Sozialwissenschaftler Gerhard Hanloser, Jahrgang 1972, lebt in Freiburg i.Br. Seine Schwerpunkte sind marxistische und Kritische Theorie und Theorien des Antagonismus.
Gerhard Hanloser
Krise und Antisemitismus
Eine Geschichte in drei Stationen von der Gründerzeit über die Weltwirtschaftskrise bis heute
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Gerhard Hanloser:
Krise und Antisemitismus
1. Auflage, Oktober 2003
eBook UNRAST Verlag, Juli 2025
ISBN 978-3-95405-218-9
© UNRAST Verlag, Münster 2003
Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Martin Klindtworth, Leipzig
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
I. Vorweg
II. Das Geld und der Antisemitismus
II.1. Zum Geldrätsel
II.2 Marx lüftet das Geldrätsel
II.3 Geld, Kredit, Krise
II.4 Marx’ Vorahnungen – Die Kritik an Proudhon
III. Die Grenzen der marxistischen Krisentheorie
III.1. Weltgeist Abwärts
III.2 Krise und Regulationismus
IV. Die Krise von 1873 und der Antisemitismus
IV.1 Die allgemeine Spekulation
IV.2 Nach dem Krach
IV.3 Antisemitismus als Bestandteil des Bismarckschen »Regulationsmodells«
V. Antisemitische Ordnungsideologie und die große Krise von 1929
V.1 Reaktionäre Geldkritik
Die Krisenzeit vor 1929
Exkurs: Die Linkskommunisten um 1929
V.2 Kritische Theorien des Antisemitismus
V.3 Feder und die Zinsen – Mehr antisemitischer Spruch als Bruch
V.4 Die Widersprüche des NS als ›Regulationsmodell‹
VI. Vom Wuchern der Finanzmärkte zum Ende der gärtnerischen Logik der Moderne?
VI.1 Die Entstehung des »Kasinokapitalismus«
VI.2 Antworten auf den »Kasinokapitalismus«
VI.3 Der Anfang vom Ende der alten Identitäten?
Zum Schluß
Literatur
I. Vorweg
Es gibt unüberschaubare Berge von Büchern und Texten zu marxistischer Geld- und Krisentheorie auf der einen Seite und zur Theorie des Antisemitismus auf der anderen. Eine systematische Verbindung dieser beiden theoretischen Versuche, entscheidende Fragen der kapitalistischen Gesellschaft zu klären, gibt es nicht.
Die marxistischen Krisentheoretiker stellten sich fortschrittsoptimistisch die Frage nach dem Zusammenhang von Krisen und der Möglichkeit des Sozialismus. Den Hintergrund bildete die marxistische Geschichtsphilosophie. Mochten sich die unterschiedlichen Kontrahenten, die sich ihre Interpretationen des Altmeisters Marx um die Ohren hauen, noch so uneins sein, unausgesprochene gemeinsame Annahme war, daß nach dem Kapitalismus das Paradies des Kommunismus anbrechen werde. Die Krise wurde als eine Situation begriffen, die dabei mit Hoffnung auf radikale Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft verbunden war. Die Geschichtsphilosophie, die dieser auch stark wunschgeleiteten Auffassung zu Grunde liegt, scheint nach dem Scheitern der Revolten und Revolutionen im 20.Jahrhundert in sich zusammengebrochen zu sein. So hat sich mehrheitlich eine Krisenangst entwickelt, die die Errungenschaften der Arbeiterbewegung durch die Krise zertrümmert sieht. Diese zweite Vorstellung findet sich nur noch als müder Abklatsch in irgendwelchen linksgewerkschaftlichen Publikationen.
Den Antisemitismus mit ökonomischen Krisen in Verbindung zu bringen, ist nicht neu. Viele Theoretiker des Sozialismus haben diesen Erklärungsansatz vorgelegt. August Bebel hat 1893 in seiner Grundsatzrede »Antisemitismus und Sozialdemokratie« auf dem Kölner Parteitag diesen Zusammenhang benannt. Der Antisemitismus sei eine »natürliche Wirkung und Folge der ökonomischen Zustände, in welche Deutschland durch den Großen Krach von 1873 gelangt war.«[1] Auch der kritische Theoretiker Max Horkheimer erklärte den Antisemitismus in seinem 1939 geschriebenen Essay »Die Juden und Europa« als eine Sündenbockstrategie, die als Instrument des Klassenkampfes eingesetzt werden würde. »Demnach handelt es sich beim Antisemitismus im orthodox-marxistischen Sinn um unaufgeklärtes, falsches Bewußtsein, ein Überbau-Phänomen, das lediglich dazu dient, über Klassenantagonismen hinwegzutäuschen und gleichzeitig antikapitalistische Interessen umzulenken.«[2] Erst in den 1940ger Jahren haben die Kritischen Theoretiker sich von dieser Sündenbock-Theorie verabschiedet und vor allem mittels des Rückgriffs auf die Psychoanalyse den »irrationalen Charakter der neuen gesellschaftlichen Rationalität«[3], die in der Vernichtungspraxis des Nationalsozialismus zum Ausdruck kam, zu analysieren versucht.
Mittlerweile erscheint das Zusammenziehen von Antisemitismus und Krise als ein unzulässiger Ökonomismus, der der Vielschichtigkeit des Antisemitismus nicht gerecht werden könne. So kritisiert beispielsweise Lars Rensmann in einer ansonsten lobenden Buchbesprechung von Verborgener Staat, lebendiges Geld. Zur Dramaturgie des Antisemitismus Gerhard Scheits Ausführungen, daß der antisemitische Volksstaat des NS undenkbar sei ohne die weltweite Krise des Kapitals: »Hier greift Scheit zu kurz. Dieses Krisenaxiom, in dessen Licht nicht nur die staatskapitalistische Umgestaltung der Ökonomie im Faschismus, sondern selbst die Vernichtung der europäischen Juden vornehmlich als immanent-rationale ökonomische Krisenbewältigung erscheint, ist selbstverständlich nichts als schlechte Metaphysik, die traditionslinkes Einverständnis zu erheischen in der Lage ist.«[4] Von der simplen Vorstellung, Antisemitismus bloß als Bestandteil des Klassenkampfes oder als Nebenkriegsschauplatz der politischen Ökonomie abzutun, hatte sich auch Detlev Claussen verabschiedet: »Die antisemitische Gewalttat fällt mit der Grenze der politischen Ökonomie und damit der Grenze der Aufklärung zusammen. Seine Kritik muß sich notwendigerweise nicht nur von der Kritik der politischen Ökonomie ablösen, sondern auch von der traditionellen Logik des Klassenkampfes und Krieges, die sich auf menschliche Gegenüber bezieht.«[5]
In der folgenden Arbeit, die sich unter anderem auch als eine kritische Überprüfung dieser Einsprüche verstehen will, wird jedoch davon ausgegangen, daß der scheinbar objektivistische Begriff der Krise eben nicht auf rationale ökonomische Verhaltensweisen verweist, sondern gerade das Irrationale des scheinbar rationalen Verlaufs der kapitalistischen Ökonomie andeutet und folglich auch irrationale Verhaltensweisen zur Folge hat. Auf diesem Hintergrund wird der Zusammenhang von Krise und Antisemitismus erörtert. Man wird aber nicht absehen können von der Verlaufsform des Klassenkampf selbst, der natürlich seine Bahnen im Wandel der Zeit höchst unterschiedlich nimmt. In dieser Studie kommt die Betrachtung des Klassenkampfes zu kurz, dabei hat gerade er fundamentale Auswirkungen auf die Durchbruchschancen des Antisemitismus. Der Kapitalismus als soziales Verhältnis unterwirft die Gesellschaft einem stetigen Wandel, es gibt nichts Ewiges, auch keinen »ewigen Antisemitismus«.
Doch als Einschränkung gilt es vorauszuschicken, dass in der vorliegenden Arbeit mehr ideologiekritisch als sozialhistorisch argumentiert wird. Ausgegangen wird davon, daß Geld in der kapitalistischen Gesellschaft das verbindende Moment ist – man trägt den gesellschaftlichen Zusammenhang in seiner Westentasche mit sich herum. Eine reaktionäre Geldkritik setzt die Geldwirtschaft mit »dem Juden« gleich. Auf das Geldrätsel wird so antisemitisch geantwortet. (Kapitel II.1). Dem Unverständlichen des Geldes muß also nachgegangen werden. So heißt es am Anfang dieser Arbeit back to the roots, zurück zu Karl Marx’ Ausarbeitungen zum Fetischcharakter des Geldes (Kapitel II.2). Doch bereits hier stehen zu bleiben und aus dem Fetischcharakter des Geldes den Antisemitismus ableiten zu wollen, wäre zu statisch gedacht. Das Geld als sich selbst vermehrendes Geld(G-G'), das scheinbar die Produktion ausspart, bedient die antisemitischen Dichotomien von unproduktiv (›raffend‹) und produktiv (›schaffend‹). Die spezifische Form des Geldes als Kredit ist für ein Auseinanderreißen der kapitalistischen Totalität verantwortlich, denn in dieser Form kann kurzfristig von der Produktion, der konkreten Ebene der Ausbeutung, abgesehen werden, und der Kapitalismus erscheint als Geldmaschine. Gerät diese »Maschine« ins Stocken, drängen sich falsche Vorstellungen der gesellschaftlichen Behebung der Probleme auf. Die von der Kritischen Theorie herausgearbeitete Dichotomie des antisemitischen Denkens muß sich in einer Krise, die als Folge der vermittlungslosen – also ›unproduktiven‹ – Geldvermehrung erscheint, verdichten. Der Kredit als Option auf Akkumulation in der Zukunft (Kapitel II.3) hat mit dem Auftreten der Krise nicht nur versagt, er legt auch den Grundstein für eine falsche Wahrnehmung der Gründe der Krise selbst. Hier wird dann die dieser Arbeit zugrundeliegende These entfaltet, wonach der Kredit als besondere Form des Geldes krisenaufschiebend und krisenverschärfend zugleich wirkt und eine weitere Fetischisierung der kapitalistischen Gesellschaft darstellt. Kommt die Kapitalbewegung (G-G'), in der die Vermittlung, die Arbeit, ausgelöscht zu sein scheint, in eine Krise, lädt dies zu heftigen, das ›Raffende‹ verdammenden und das ›Schaffende‹ verklärenden Reaktionen ein.
Marx stellte dieses falsche Bewußtsein schon bei Pierre Proudhon fest (Kapitel II.4), der nicht die kapitalistische Gesellschaft als Ganzes kritisierte, sondern aufgrund seiner Fixierung aufs Geld zu einer falschen Kapitalismuskritik kommt.
Daß jedoch die kapitalistische Krise von 1929 im Sinne dieses ›falschen Bewußtseins‹ gemeistert wurde, konnte Marx nicht ahnen, dafür stand ihm auch seine Geschichtsphilosophie im Weg (Kapitel III.1). Er konnte nicht voraussehen, daß die antisemitische Meinung, die sich aus verschiedenen Quellen speist, nicht nur in der Krise augenscheinliche Entwicklungen ökonomischer Art erklären konnte, sondern sich nach 1929 auch zu einer sich durchsetzenden Ideologie, die Praxis wurde, verdichten sollte.
Über Notwendigkeit und Kontingenz der Durchsetzung des Antisemitismus entscheidet der real-historische Zustand der Gesellschaft. In der vorliegenden Arbeit sollen die spezifischen gesellschaftliche Konstellationen ausgelotet werden, die Antisemitismus überhaupt als probates Mittel der Regulation von Geldkrisen nahe legen: Welches sind die »geistig-willensmäßigen Reaktion«[6] auf die Krisen und »unter welchen besonderen lebensgeschichtlichen Bedingungen (ließ/läßt sich der Antisemitismus) im Kopf, d.h. im Bewußtsein, der einzelnen Individuen durchsetzt«[7]?
Um diesen Reaktionsebenen nachzugehen, soll der Philosoph des Willens zur Macht Friedrich Nietzsche auftauchen. Als Philosoph des Schöpferischen ist er von besonderem Interesse, wenn auf die Strategien der Krisenlösung ein Augenmerk gerichtet werden soll. Er soll in dieser Arbeit neben – besser: im Kontrast zu, und auf der anderen Seite der Barrikade als – Karl Marx, dem Kritiker der Politischen Ökonomie, seinen Platz finden, war er doch auch als Philosoph der Gründerzeit der »Prophet der Krise«[8]. Ein ›authentischer Nietzsche‹ soll jedoch nicht rekonstruiert werden; wird mit Nietzsche gesprochen, spricht der Zeitgeist.[9]
Nietzsche wird in dem historischen und aktuellen Teilen der Arbeit auftauchen, die Arbeit beschränkt sich in ihrer Analyse auf Deutschland. Im IV. Kapitel wird der Große Gründerkrach von 1873 ausführlich untersucht und die antisemitischen Reaktionsformen dargestellt, die dieser Krise auf den Fuß folgen. Die Gründerkrise beflügelte die Entstehung des modernen Antisemitismus in Deutschland, so daß der Sozialhistoriker Hans Rosenberg für die Zeit nach der Krise einen »radikalen Struktur- und Funktionswandel des Antisemitismus« feststellte.[10] Dennoch konnte sich der Antisemitismus noch nicht vollends als passender Bestandteil des Regulationsmodell nach der Krise herausstellen (Kapitel IV.3.1-IV.3.3.)
Im zweiten großen Kriseneinbruch in Deutschland 1929 sah dies schon anders aus, was selbst die kritischsten marxistischen Köpfe der damaligen Zeit nicht vorhersehen konnten. Die Nationalsozialisten traten mit ihrem durch und durch antisemitischen Programm an, um Deutschland in eine widerspruchslose neue Ordnung zu führen. Hier konnten sie sich auf die Tradition der reaktionären Geldkritik beziehen, die in der Krisenzeit vor der großen Krise eine wichtige Rolle spielte (Kapitel V.1.).
Max Horkheimer und andere aus dem Institut für Sozialforschung haben die Versuche der Nationalsozialisten, eine widerspruchslose Ordnung nach der Krise über die Mobilisierung des Antisemitismus und den autoritären Staat aufzubauen, als eine Ordnung beschrieben, die tatsächlich die Widersprüche des Liberalkapitalismus hinter sich gelassen habe. Ihr pessimistisch gewendeter Marxismus und ihre Beschreibung des NS als »autoritären Staat« (Horkheimer) bzw. als »Staatskapitalismus« (Pollock), der ein neues Vergesellschaftungsmodell nach der Krise darstellen würde, werden einer kritischen Prüfung unterzogen (Kapitel V.2.1.). Auch der viel beachtete Text von Moishe Postone »Logik des Antisemitismus« soll vorgestellt und kritisiert werden (Kapitel V.2.2.). Sowohl Theoretiker der Kritischen Theorie wie Horkheimer oder Pollock, als auch Postone behaupten eine Widerspruchslosigkeit des Nationalsozialismus, die es nicht gab. Damit verkennen sie gerade die Dynamik des NS, die im Scheitern an den Widersprüchen und ihrer brutalen Kanalisation gegen die Juden besteht. Hier soll den Widersprüchen des NS in bezug auf die Geld- und Kreditpolitik nachgegangen werden, die im Zusammenhang mit der kumulativen Steigerung des Antisemitismus zu sehen sind. Der Widerspruch zwischen propagiertem Primat der Politik und realer Vormachtstellung ökonomischer Anforderungen wurde auf der Ebene des Antisemitismus gelöst. Der Antisemitismus war entscheidender ideologischer Bestandteil des Nationalsozialismus, um selbst einen kapitalistischen Krisenlösungsweg einzuschlagen, die ›antikapitalistischen‹ Sehnsüchte jedoch mitsamt ihrer Radikalität auf »den Juden« zu projizieren. Von der »Brechung der Zinsknechtschaft«, wie die Nazis in ihrer Bewegungszeit verkündeten, blieb gerade mal der antisemitische Gehalt übrig (Kapitel V.3.), und der spezifisch deutsche Regulierungsversuch nach der Krise über eine keynesianische Politik führte in immer neue Widersprüchlichkeiten, die einzig vernichtungsantisemitisch gelöst wurden (Kapitel V.4.1-V.4.3).
Das spekulativste Kapitel fällt in die heutige Zeit. Die Finanzmärkte haben eine scheinbare neue Macht entwickelt und die vielbeschworene »New Economy« ist in einer fundamentalen Krise, die unter Umständen bloß Vorspiel für eine der tiefsten Krisen der Weltwirtschaft ist. (Kapitel VI.1.). Antisemitische Antworten, die das Spekulative, das Wuchern der Finanzmärkte, verdammen, sind im politisch konservativen bis rechtsradikalen Spektrum schon wieder zu hören (Kapitel VI.2.2). Die Situation Ende der 90er Jahre ähnelte in vielem der Unbeschwertheit der zwanziger Jahre und der Goldgräberstimmung an der Börse in den Gründerjahren. Sowohl bürgerliche Krisenexperten, als auch marxistische Krisentheoretiker warnen vor einem möglichen Crash aufgrund der finanziellen Blase, die sich von der Realökonomie abgekoppelt habe.
Drohen erneut antisemitische ›Verarbeitungsmechanismen‹ in einer potentiellen Krise? Im großen und ganzen bleiben antisemitische Stereotype im Zusammenhang mit der Selbstvermehrung des Geldes, mit Aktien und »Kasinokapitalismus« bislang aus. Die unterschiedlichen subjektiven Antworten auf den vielzitierten »Kasionkapitalismus« werden in Kapitel VI.2. präsentiert. Es gibt bislang keine vergleichbare Wiederkehr der propagierten Schaffenslust und der aggressiven, personalisierenden Verdammung des ›Raffens‹. Das führt zu der Frage, ob wir am Anfang vom Ende der alten Identitäten stehen. Hierfür sind auch neue theoretische Anstrengungen von Nöten (Kapital VI.3.). Gerade auch dem radikalen Teil der Anti-Globalisierungsbewegung sollen mit dieser Arbeit Argumente geliefert werden. In vielerlei Hinsicht erinnert diese Bewegung an eine vor-materialistische Sozialrevolte: moralisierende Kritik, die Furcht und Ablehnung des Großen und die Affirmation des Kleinen gehen Hand in Hand mit einem unspezifischen Antikapitalismus, der meist auf die Banken und Finanzmärkte zielt.
Gleichsam möchte ich auch nicht in den beliebten Reflex verfallen, der Anti-Globalisierungsbewegung en gros ein fast schon naturnotwendiges »falsches« antisemitisches »Bewusstsein« zu unterstellen, wie es so einigen Autoren des antideutschen Spektrums beliebt[11]. Wo Antisemitismus aber in ihr auftaucht, gehört er bekämpf – radikal.
Anmerkungen
1 Zit. nach: Rosemarie Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich. Die Auseinandersetzungen der Partei mit den konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus 1871-1914, Bonn 1978, S. 75
2 Lars Rensmann, Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur, Erklärungspotential und Aktualität, Berlin/Hamburg 1998, S. 28
3 Rensmann (1998), a.a.O., S. 30
4 Lars Rensmann, Die Totlacher, in: konkret 5/2000, S. 58
5 Detlev Claussen, Grenzen der Aufklärung. Die gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus, Frankfurt am Main 1994, S. 55
6 Hans Rosenberg, Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967, S. 58
7 diese Frage hat bezüglich des Rassismus Peter Schmitt-Egner gestellt, ders., Wertgesetz und Rassismus. Zur begrifflichen Genesis kolonialer und faschistischer Bewußtseinsformen, in: Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 8/9, Frankfurt am Main 1976, S. 398
8 vgl.: Gerhard Scheit, Blonde Bestie umarmt Droschkengaul. Zum 100.Todestag Friedrich Nietzsches. Dossier der Wochenzeitung Jungle World Nr.33, 9.August 2000, S. 15-18
9 Gerade die Kapitel zum Nationalsozialismus und zur aktuellen Situation zeigen, daß Nietzsche sich wie wahrscheinlich kein zweiter Philosoph zur politischen Instrumentalisierung eignete. Daß er sich von den Antisemiten seiner Zeit abgestoßen fühlte, macht ihn in diesem Zusammenhang zu einen interessanten Zeitzeugen und straft auch jene Lügen, die Nietzsche ausschließlich als faschistischen Philosophen sehen wollen. Dass macht Nietzsche nicht unbedingt besser – unter Umständen dient die Unentschiedenheit und Mehrdeutigkeit Nietzscheanischer Gedanken dazu, die passende Begleitmusik zu den flexibleren und sprunghaften Entwicklungen des Kapitalismus abzugeben. Vgl.: Bernhard H.F. Taureck, Nietzsche und der Faschismus. Ein Politikum, Leipzig 2000
10 Rosenberg (1967), a.a.O., S. 67
11 Z.B. Udo Wolter, Bewusst wie! Eine Kritik der Globalisierungsbewegung, in: jungle World 30/2001 Mittlerweile häufen sich Artikel und Texte aus der publizistischen deutschen Linken, in denen mit den Begrifflichkeiten des »strukturellen Antisemitismus« oder des »verkürzten Antikapitalismus« operierend allen möglichen Bewegungen Antisemitismus vorgeworfen wird. Oftmals wird in ihnen nicht mehr argumentiert, untersucht oder die theoretische Anstrengung des Begriffs unternommen, sondern bloß assoziiert und moralisch verdammt.
II. Das Geld und der Antisemitismus
II.1. Zum Geldrätsel
Geld zählt zu den selbstverständlichsten Dingen der Welt. Geld ist praktisch und gilt ganz von selbst als Grundlage jenes abstrakten Systems von Gedanken und Alltagshandlungen, die der heutige ökonomische Rationalismus dem Individuum abverlangt. Dennoch ist Geld eine widersprüchliche Erscheinung, der ganzen souveränen Handhabung zum Trotz. Die optimistisch-pragmatische Beschreibung des Geldes als nützliches, praktisches Ding meint sich über das Rätselhafte, das dem Geld anhaftet, hinwegtäuschen zu können. Das Rätselhafte allerdings ist der Ort, an dem sich Weissager und Verschwörungstheoretiker jeglicher Couleur tummeln.
Das Wesen des Geldes muß folglich dechiffriert, nicht bloß oberflächlich affirmiert – wie es der Bürger tut – oder verdammt werden – wie es dem Romantizist beliebt. Die widersprüchliche Existenzweise des Geldes lädt zu allerhand Meinungen über das Geld ein. Gerade der Antisemitismus hat immer versucht, hinter der Unpersönlichkeit des Geldes etwas anderes, jemanden, zu entdecken. Die antisemitische Erklärung der Welt liefert von vornherein die Antwort mit, was hinter den Tücken des Geldes steckt: eben der Jude.
Die jahrhundertealte Identifikation des Geldes mit der Person beziehungsweise der Tätigkeit der Juden bildet hierfür den Hintergrund. Die Juden wurden seit dem 13. Jahrhundert zu einem Instrument der obrigkeitsstaatlichen Fiskalpolitik. Als Knechte der kaiserlichen Kammer mußten sie für ihren Schutz zahlen und sie erhielten das sogenannte Wucherprivileg, das alleinige Recht, Geld gegen Zinsen zu verleihen, was den Christen auf Grund des Kanonischen Rechts verwehrt war. Hier vollzog sich die »ursprüngliche Akkumulation des Antisemitismus«, in der der Jude mit dem Geld identifiziert wurde: »…das bevorzugte Mittel, den Horror vor dem sich selbst zeugenden Geld zu bannen, war die Identifikation des Geldrätsels mit dem Judentum. Das real Abstrakte, das sich vom menschlichen Tun verselbständigt hatte, konnte in dieser Weise wieder menschliche Konkretheit erhalten: die des Unmenschen.« [1]
Das im Christentum wurzelnde Vorurteil verschwand nicht mit der schrittweisen kapitalistischen Durchdringung der Gesellschaft, vielmehr verlangte die Ausbreitung des unpersönlichen Tauschverhältnisses, als welches der Kapitalismus erscheint, eine handfeste Erklärung für die Tücken und Unwägbarkeiten des Marktes: »der unpersönliche Tauschakt wird in persönliche Beziehungen rückübersetzt; als vermittelnde Instanz fungiert im falschen Bewußtsein nicht das Geld, sondern der Jude. Der marginale vorbürgerliche Judenhaß wird in der bürgerlichen Gesellschaft an den zentralen ökonomischen Mechanismus gekoppelt: Die bürgerliche Gesellschaft wird zur antisemitischen Gesellschaft per excellence.«[2]
Obwohl die Juden keinesfalls die einzigen waren, die mit dem Geldgeschäft zu tun hatten, wurden sie mit dieser Tätigkeit über Jahrzehnte identifiziert: »Die Juden hatten die Zirkulationssphäre nicht allein besetzt. Aber sie waren allzu lange in sie eingesperrt, als daß sie nicht den Haß, den sie seit je ertrugen, durch ihr Wesen zurückspiegelten. Ihnen war im Gegensatz zum arischen Kollegen der Zugang zum Ursprung des Mehrwerts weiterhin verschlossen. Zum Eigentum an Produktionsmitteln hat man sie nur schwer und spät gelangen lassen.«[3]
Im entwickelten Kapitalismus, der sich als überregionales System darstellt, wird die gesellschaftliche Herrschaft als internationale erfahren und mit dem Volk ohne Staat, den Juden, als »internationales Judentum« kurzgeschlossen. Ebenso ist diese Herrschaft keine persönliche mehr, sondern über die Abstraktion Geld vermittelt, für das die Juden stehen sollen. »Die Kritische Theorie hat in der Aufspaltung in ›produktives Kapital‹ und ›spekulatives Kapital‹, die Sphäre der Zirkulation, in die die bürgerliche Gesellschaft die Juden traditionell eingesperrt hatte, einen Kern antisemitischer Ideologie und den spezifisch ökonomischen Grund des Antisemitismus erkannt. Während die Herrschaft in der Industrie den Mehrwert an der Quelle aneignet, aber als Produktion verschleiert und fetischisiert wird, wird den Händlern und Banken, der Zirkulationssphäre, die Verantwortung für die Ausbeutung zugeschrieben, die doch in der Industrie ihre Quelle hat. Zur Zirkulationssphäre, ohne die die ›doppelte Freisetzung‹ von personalen Herrschaftsbeziehungen nicht vollzogen worden wäre, zählt die gesamte Welt des ›Mittlertums‹, die Intellektuellen, Anwälte, und vor allem die Banken, die nur Geld ›verarbeiten‹. Sie erscheint dem Antisemiten als ›unproduktiv‹ und ›parasitär‹, bedient in griffig als ›jüdisch‹ personifizierter Form seinen antikapitalistischen Reflex, ohne den Kapitalismus in seinem sozialen Wesen anzugreifen. Die Juden, die einzig als ›raffend‹ und nutzlos erscheinen, sind dem Antisemiten verhaßt.«[4]
II.2 Marx lüftet d5as Geldrätsel
II.2.1 Von der unbegriffenen Ablehnung…
Zu Beginn soll nun zurückgegangen werden zu dem fundamentalen Analytiker und Kritiker des Geldes, zu Karl Marx. Marx selbst ist von einer oberflächlichen Ablehnung des Geldes in einem theoretischen Lernprozeß zu einer fundamentalen Kritik gelangte. Der junge Marx kommt in seiner Schrift Zur Judenfrage selbst dem Antisemitismus verdächtig nahe, während die späteren Ausführungen zu Geld, Kredit und Krise wichtige Anschlußmomente für eine kritische Theorie des Antisemitismus liefern. In Zur Judenfrage tritt Marx als Moralist auf, der Judentum und Kapitalismus in eins setzt. »Der Jude hat sich auf jüdische Weise emanzipiert, nicht nur, indem er sich die Geldmacht aneignet, sondern indem durch ihn und ohne ihn das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist zum praktischen Geist der christlichen Völker geworden sind.«[5]
Der junge Marx meint, mit der radikalen Kritik der Herrschaft des Geldes schon die bürgerliche Gesellschaft als Ganze zu treffen. Dabei versucht er metaphorisch die Herrschaft des Kapitalismus loszuwerden. Er plädiert für eine »Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum« und benutzt »Judentum« als Synonym für das Geld. Hier schließt Marx die geschichtliche Einsperrung der Juden in die Zirkulationssphäre mit der Zirkulation im allgemeinen kurz.
Marx meint hier das Geld als vermeintliches Wesen des Kapitalismus auszumachen, er bleibt in seiner Beschreibung des Kapitalismus zirkulationsfixiert. Das Judentum erscheint als Geist des Kapitalismus.
»Indem Marx das Geld zum weltlichen Gott des Judentums erklärt, vermag er es eben gerade nicht bei der Wurzel zu packen; nach der gräbt er in mühseliger Arbeit erst ab den Fünfziger Jahren – in den Studien zum Kapital. Der junge Marx hingegen wiederholt im Philosophischen noch einmal die Fetisch-Konstruktion des Christentums: Er vertreibt die Händler aus dem von Feuerbach errichteten Tempel des menschlichen Gattungswesens – er lehnt das Geld ›radikal‹ ab, ohne zu begreifen, was es ist. Und mit nahezu automatischer Konsequenz stellt sich die Metapher des Judentums ein.«[6]
Die Ausführungen von Marx in Zur Judenfrage haben oft dazu gedient auch Marx oder sogar dem Marxismus judenfeindliche und antisemitische Wurzeln zu bescheinigen. Dagegen hat schon Roman Rosdolsky 1948 zurecht eingewandt: »Man exzerpiert eine Anzahl Zitate aus ihren Werken und privaten Korrespondenzen und setzt dann diese Zitate dem Begriff des ›Antisemitismus‹ entgegen, wie ihn der betreffende Autor (oder richtiger: der ›gesunde Menschenverstand‹ seiner Umgebung) auffaßt. Das Ergebnis dieses unkritischen (und durchaus unhistorischen) Verfahrens ist, daß schließlich auch die Begründer des Marxismus als eine Art geistige Waffenbrüder von Julius Streicher erscheinen…«[7]. Die Nonchalance, mit der Marx Geldwirtschaft und Judentum ineins zieht, ist allerdings in der Tat beunruhigend. Da helfen auch die Hinweise nicht weiter, daß der Text in der Arbeiterbewegung wegen seiner Sperrigkeit kaum beachtet wurde.[8]Zur Judenfrage ist eine Herausforderung und ein Lehrstück, der Text zeigt die Fallen an, wenn mit oberflächlicher Radikalität auf die Abschaffung eines unverstandenen und als überhistorisch angenommenen Komplexes gezielt wird. Ein falsch gewählter Universalschlüssel kann auch nur die falschen Türen öffnen. Der junge Marx hat in Zur Judenfrage einen solchen in der Hand: »Im Geld glaubt er den Schlüssel der Gesellschaftserkenntnis gefunden zu haben; das Geld besitzt auf dieser Abstraktionsstufe nur die Wirkung eines Schlüssellochs, das einen verzerrten Blick auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erlaubt. ›Mensch‹ und ›Jude‹ bleiben geschichtslose Metaphern für gesellschaftliche Verhältnisse.«[9]
II.2.2 …zur umfassenden Kritik
Marx’ Analysen des Geldes in den Grundrissen und im Kapital wirken wie eine Selbstkritik seiner Schrift Zur Judenfrage. Gerade die Abschnitte, die die fetischhaften Beziehungen der kapitalistischen Gesellschaft beschreiben, zeigen, daß der späte Marx sich von seiner unverstandenen vermeintlich radikalen Ablehnung des Geldes verabschiedet hat. Marx verzichtet auf »geschichtslose Metaphern für gesellschaftliche Verhältnisse«[10] wie ›Mensch‹ oder ›Jude‹. Idealistische Behauptungen eines »wahren Gattungswesens«, die diesen Metaphern entgegengehalten werden, finden sich nun nicht mehr. In den Grundrissen beschreibt Marx das Geld als etwas, das »unmittelbar zugleich das reale Gemeinwesen, insofern es die allgemeine Substanz des Bestehens für alle ist und zugleich das gemeinschaftliche Produkt aller« ist.[11] Dieses wird mit keinem utopisch-idealistischen Gegenentwurf konfrontiert, und schon fallen die Ressentiment die in Zur Judenfrage enthalten waren, weg. Als Analytiker und Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft beginnt Marx mit den einfachsten Bestimmungen dieser Gesellschaft – Ware, Geld – um zu den Besonderheiten und Konkretionen hinabzusteigen.
Die Analyse schreitet vom Geld als Austauschmittel über Geld als Kapital bis zu der scheinbar unvermittelten Bewegung des zinstragenden Geldes als »äußerlichste und fetischartigste Form« voran.[12]





























