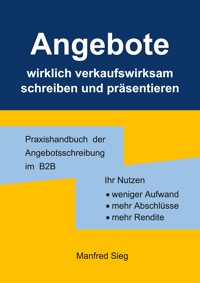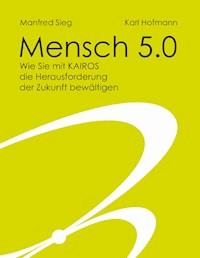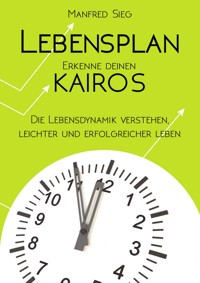Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alle bisherigen Krisen bestätigen, dass auf Dauer nur Unternehmen überleben, die einen gesunden Markt bedienen, leistungsfähig sind und echten Mehrwert bieten. Kundennutzen zu liefern ist zwar die einzige Existenzberechtigung für Unternehmen, reicht aber allein für den nachhaltigen Erfolg nicht aus. Und in dem Moment, in dem das Angebot und die Kapazitäten erheblich größer als die Nachfrage sind, beginnt nicht nur Preisdruck, sondern das Drumherum um das Produkt und die Einzigartigkeit, die Unique Selling Proposition (USP), werden entscheidend. Es geht um die Antwort auf die Frage, warum der Kunde gerade bei uns kaufen soll. Und hierfür maßgeblich sind die Führung des Unternehmens und des Personals sowie die Mitarbeitenden selbst. Das Buch ist vom Praktiker für Praktiker als Leitfaden geschrieben, mit zahlreichen Beispielen und kurzen Geschichten. Es enthält nur so viel Theorie wie unbedingt nötig. Der lockere Schreibstil hat eine hohe Informationsdichte und wird mit vielen Tabellen und Abbildungen ergänzt. Sie können sofort mit der Umsetzung beginnen und Ihren Erfolg steigern. Die Einzigartigkeit dieses Buches besteht in der einmaligen Kombination der Themen Kundennutzen - Führung - USP und den häufigsten Suchanfragen hierzu in Google. Schauen Sie sich bitte das Inhalts- und Abbildungsverzeichnis an. Es lohnt sich das Buch zu lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warum Sie dieses Buch lesen sollten
Als ich mit diesem Buchprojekt begann, hatte ich noch nichts von Covid-19 und einer bevorstehenden Pandemie gehört. Mit Beginn der Corona-Krise wurde mir bewusst, dass ich an einer Themenkombination mit höchster Relevanz arbeitete. Und laut meinen Recherchen gab es diese Kombination von Kundennutzen - Führung - USP bisher in keinem Buch.
Der abrupte Stillstand der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens, das Reißen von Lieferketten und der Zusammenbruch ganzer Branchen wegen fehlender Nachfrage veränderten die Welt.
So manche marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Der signifikante Preisanstieg bei den Masken war die logische Folge des großen Nachfrageüberhangs. Und viele Freiberufler und Unternehmen verloren wegen totalem Nachfragerückgang ihre Existenzgrundlage. Viele Unternehmen konnten nur mit staatlicher Hilfe gerettet werden. Wie erfolgreich das Unterstützungsprogramm war oder ist, wird sich jedoch erst später zeigen.
Kein Mensch kann vorhersehen, inwieweit sich die Nachfrage erholt, welche veränderten Ansprüche und Einstellungen es geben wird und wann eine Balance von Nachfrage und Kapazitäten wieder einigermaßen hergestellt sein wird.
Eine Schlussfolgerung kann man aber schon jetzt ziehen: auf Dauer werden nur die Unternehmen überleben,
die in einem gesunden Markt mit Nachfrage tätig sind,
die etwas anbieten, was anderen Menschen/Organisationen nützt und
deren Ansprüche erfüllt,
die auf hohem Niveau leistungsfähig sind und
profitabel arbeiten.
Kein Punkt darf fehlen. Jede Krise erhöht den Druck.
Mit diesem Buch bearbeite ich das Thema Kundennutzen umfassend aus der Sicht der Unternehmensführung. Denn er ist die einzige Existenzberechtigung eines Unternehmens.
Fast alle Produkte und Dienstleistungen sind sowieso hochgradig austauschbar. Und Kunden sind nur dann bereit höhere Preise zu bezahlen oder überhaupt zu investieren oder Geld auszugeben, wenn sie einen adäquaten Nutzen davon haben.
In dem Moment, in dem das Angebot und die Kapazitäten erheblich größer als die Nachfrage sind, beginnt nicht nur Preisdruck, sondern das Drumherum um das Produkt und die Einzigartigkeit, der USP, werden entscheidend.
Das dritte Thema dieses Buches ist die Führung. Denn in ungezählten Vorträgen, Seminaren und Kundenbefragungen kam immer wieder das gleiche Ergebnis heraus: den entscheidenden Unterschied zur Konkurrenz machen Führungskräfte und deren Mitarbeitende.
Ziel und Nutzen dieses Buches
Ich habe bereits drei Bücher zum Thema Kundennutzen im Zusammenhang mit dem Verkaufen bei SpringerGabler veröffentlicht:
Kundennutzen: die Basis für den Verkauf - so verwandeln Sie Leistungen in messbaren Mehrwert
Kundennutzen: die Anwendung im Verkaufsgespräch – so verhandeln Sie wert- und nutzenorientiert
Kundennutzen – Schlüssel zum Verkaufserfolg - wie Sie Mehrwert bieten, Preise leichter durchsetzen und Profitabilität sichern
Mit diesem vierten Buch erhalten Sie eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihren Verkauf und das gesamte Unternehmen zu einer kundennutzen-zentrierten Organisation transformieren können.
Die Folge werden mehr Geschäft und Erfolg sowie gesteigerte Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sein.
Der USP dieses Buches besteht in der einmaligen Kombination von Kundennutzen, Führung sowie USP und den häufigsten Suchanfragen zu diesen Themen in Google.
Mehrere 1.000 Keywords habe ich analysiert und stufenweise die Suchbegriffe mit der höchsten Zahl monatlicher Suchanfragen und der größten Relevanz für Unternehmens- und Verkaufserfolg herausgefiltert.
Dieses Buch gibt Antworten zu über 20 Keywords, für die es Stand April 2020 monatlich jeweils mehr als 1.000 Suchanfragen gibt. Das zeigt nicht nur die Relevanz der Themen. Sie deuten auch auf einen zu erwartenden qualitativ schärferen Wettbewerb hin.
Ich schaue auf die Bedeutung des Kundennutzens und andere Schlüsselfaktoren für den Unternehmenserfolg. Denn Kundennutzen allein reicht für den nachhaltigen Unternehmenserfolg nicht aus. Es geht um die Antwort auf die Frage, warum der Kunde bei uns kaufen soll. Und hierfür maßgeblich sind die Führung des Unternehmens und des Personals sowie die Mitarbeitenden selbst.
Sie lernen das mehrdimensionale Kundennutzenmodell kennen. Und Sie verstehen, weshalb der Kundennutzen eine Sache aller Menschen im Unternehmen sein sollte.
Außerdem erfahren Sie, wie Sie den Kundennutzen auf allen Ebenen und in allen Bereichen Ihres Unternehmens systematisch entwickeln, den geldwerten Nutzen kalkulieren und verkaufen können. Darauf kommt es schließlich an.
Es ging mir nicht darum, einen seitenstarken Schmöker zu schreiben und ihm einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Mein Ziel ist es, nach der 80/20 Regel, die 20 % an Aspekten, Erkenntnissen und Maßnahmen in den Blick zu nehmen, die am Ende 80 % des Erfolgs ausmachen.
Das Buch ist vom Praktiker für Praktiker als Leitfaden geschrieben, mit zahlreichen Beispielen und kurzen Geschichten. Es enthält nur so viel Theorie wie unbedingt nötig.
Der lockere Schreibstil hat eine hohe Informationsdichte und wird mit 41 Tabellen und 41 farbigen Abbildungen ergänzt. Sie können sofort mit der Anwendung/Umsetzung beginnen.
Wie Sie mit dem Buch am besten arbeiten
Es enthält ohne Übertreibung Hunderte von Denkanstößen, Impulsen und Anregungen, die Sie sich gar nicht alle merken können. Machen Sie sich daher beim Lesen Notizen zu Ihren Gedanken, Überlegungen, Ideen und geplanten Maßnahmen.
Sie werden damit effizient einen hohen Lesegewinn haben und schneller ins Handeln kommen.
Wer nichts tut, macht zwar keine neuen Fehler, aber auch nichts besser.
Danke!
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Kunden, Kolleginnen und Kollegen, die mir ihre Zeit für ausführliche Interviews und Gespräche schenkten oder Feedback zum Manuskript gegeben haben.
Danke für die wertvollen Hinweise. Sie haben mir geholfen, die Themenauswahl nahe an den Interessen der Leser-Zielgruppe zu orientieren.
Los geht‘s
Steigen wir ein. Die Reihenfolge der Kapitel folgt zwar einer gewissen Logik. Sie können jedoch sofort zu den Themen springen, die Sie am meisten interessieren. Denn jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen.
Trotzdem empfehle ich, das gesamte Buch zu lesen. Bildlich gesprochen wäre es sonst ein Haus ohne Fenster, Stromanschluss und Garage.
Wahrscheinlich werden Sie einige Themen sogar mehrfach lesen, wenn Sie an die Umsetzung gehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Der Markt
1.0.1 Das Kraftfeld
1.1 Die Kundenwelt
1.2 Die Anbieterwelt
1.3 Die Bedeutung des Preises
2. Ausgangssituation und Ziel des Unternehmens
.
2.1 Die Phase des Unternehmens
2.2 Unternehmensentwicklung: In welcher Liga spielen Sie?
2.3 Weg von Engpässen, Schwierigkeiten, Problemen
2.4 Hin zu Herausforderungen, Zielen, Wünschen
2.5 Qualitatives und quantitatives Wachstum
3. Wettbewerbsstrategien
3.1 Wie Unternehmenserfolg entsteht
3.2 Diverse Strategien kommentiert
3.2.1 Mewes-Strategie - die Erfolgsstrategie der Kundennutzenmaximierung
3.2.2 Kairos-Strategie
3.2.3 Neue Märkte mit der Blauer-Ozean-Strategie
3.2.4 Leistungswettbewerb statt Preiswettbewerb
3.2.5 Gewinnbringende Wettbewerbsstrategien
3.3 Strategische Leitsätze
3.3.1 Die Grundkonzepte der Exzellenz
3.3.2 Der doppelte Dreiklang
3.3.3 Unternehmenskultur
4. Das Spitzentrio für den Unternehmenserfolg: Kundennutzen - Führung - USP
4.1 Was können Sie besser als Ihre Mitbewerber?
4.2 Ihr Leistungsversprechen (Value Proposition)
4.3 Kundennutzen
4.4 Kundenzufriedenheit
4.5 Austauschbarkeit und USP (Unique Selling Proposition)
4.5.1 Der USP ist ein einzigartiges Nutzenversprechen
4.5.2 USP / Alleinstellungsmerkmale entwickeln
4.6 Führung und Mitarbeiterzufriedenheit
4.6.1 In Beziehung sein
4.6.2 Gelingende Führung
4.6.3 Ohne Kommunikation keine Motivation
5. Das Kundennutzenmodell
5.1 Die Nutzenkategorien
5.2 Der Mehrwert
5.3 Definitionen
6. Kundennutzen kalkulieren
6.1 Das Nutzenkalkulationsmodell
6.2 Umwandlung weicher Erfolgsfaktoren in finanziellen Nutzen
6.3 Wertvergleichsmethode
6.4 Die Nutzwert-Analyse
7. Kundennutzen systematisch entwickeln
7.1 Empfohlenes Vorgehen
7.1.1 Methoden nutzen
7.2 Produkte, Dienstleistungen
7.3 Geschäftsabwicklung
7.3.1 Die Customer Journey
7.3.2 Das Prozesse-Netzwerk
7.4 Kundendienst, Service
7.5 Geschäftsbeziehung
7.6 Mehrwert des Unternehmens
8. Kundennutzen und Mehrwert verkaufen
8.0.1 Verkaufen macht Spaß
8.0.2 Fünf wichtige Tipps
8.1 Die Wertaussage bzw. das Mehrwertversprechen
8.1.1 Verkaufswirksam Texten
8.1.2 Formulieren der Wertaussage
8.2 Wirtschaftlichkeit des Vertriebs
8.2.1 Wirtschaftlichkeit
8.2.2 Wirkung
8.3 Der von Einwänden befreite Kaufprozess
8.3.1 Die Verkaufswelt
8.3.2 Kaufauslöser und Schlüsselfaktoren
8.3.3 Das Beziehungs-Dreieck
8.3.4 Die Kaufentscheidung
8.3.5 Einwand-Kategorien
8.4 Das verkäuferische Vorgehen
8.5 Der neue Verkäufer
8.6 Nutzenorientierte Gesprächsführung
8.6.1 Die Ebenen im „Auftrags“ – Gespräch
8.6.2 Die Phasen im Verkaufsgespräch
8.6.3 Das Erstgespräch
8.6.4 Das betriebswirtschaftliche Problem des Kunden erkennen
8.6.5 Weitere Tipps
8.6.6 Beispiele effektiver Gesprächsführung
9. Kundennutzenzentrierte Transformation des Unternehmens
9.1 Kundenorientierung und Kundennutzen-Zentrierung
9.1.1 Nutzen einer kundennutzenzentrierten Transformation
9.2 Kunden-Wert-Management (Customer Value Management)
9.3 Die geistige Ebene
9.3.1 Die Vision
9.4 Die emotionale Ebene
9.4.1 Das 7-Mit-Prinzip guter Führung
9.4.2 Das Projekt initiieren
9.4.3 Wie wird der Transformationsprozess gestartet?
9.4.4 Radikaler denken
9.4.5 Mit der Hälfte an Aufwand das Doppelte erreichen
9.5 Die Prozessebene
9.5.1 Was ist ein Prozess?
9.5.2 Das Reifegradmodell
9.5.3 Vernetzung der Erfolgsfaktoren
9.5.4 Geschäftsprozess-Analyse
9.5.5 Geschäftsprozess-Management
9.5.6 Projektmanagement
10. Empfehlungen
10.1 Unternehmenserfolg verursachen
10.1.1 Die kritischen Erfolgsfaktoren
10.1.2 Die Austauschbarkeit
10.1.3 Vier Voraussetzungen für erfolgreiche Projekte
10.2 Handlungsprinzipien
10.2.1 Das Pareto-Prinzip bei der Maßnahmenauswahl
10.2.2 Nutzenmaximierung führt zu Gewinnmaximierung
10.2.3 Zehn wirksame „Gebote“
10.2.4 Effektiv und effizient arbeiten
10.2.5 Wirkungsvoll und wirtschaftlich verkaufen
10.3 Change und Projekt-Management
10.3.1 Change-Management
10.3.2 Projekt-Management
Meine bisherigen Veröffentlichungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abb. 1.1
Der Markt als Kraftfeld
Tab. 1.2
Marktbeeinflussende Kräfte
Tab. 1.3
Spannungsfeld Kunde - Handel – Hersteller
.
Abb. 1.4
Preisnachlässe vernichten Vermögen
.
Abb. 1.5
Preisverfall bedeutet Gewinnrückgang und Vermögensverlust
.
Abb. 2.1
In welcher Phase befinden Sie sich?
Abb. 2.2
Ihre Wettbewerbsposition?
Abb. 2.3
Qualität des Umsatzes
Abb. 2.4
Der externe Zielkonflikt
Tab. 2.5
Leistungsportfolio verbessern
Abb. 3.1
Wie Unternehmenserfolg entsteht
.
Abb. 3.2
Kunden-Investitionsbereitschaft und marktorientierte Unternehmensentwicklung
Abb. 3.3
Erneuerungsstrategien
Abb. 3.4
Welche Strategien sind sinnvoll?
Tab. 3.5
Vergleich Mewes-Strategie und Kairos-Strategie
Abb. 3.6
Energetische Hierarchie
Tab. 3.7
Kairologische Aspekte im Verkaufsprozess
Abb. 3.8
Strategievergleich Roter und Blauer Ozean
Abb. 3.9
Neue Märkte schaffen
Tab. 3.10
Parallele Faktoren von Menschen und Unternehmen
Abb. 3.11
Der doppelte Dreiklang
Tab. 4.1
Nutzenversprechen (Value Proposition
)
Abb. 4.2
Das magische Dreieck
Abb. 4.3
Führen und managen
Tab. 5.1
Nutzen-Ebenen und -Aspekte
.
Tab. 5.2
Tabelle zur Einordnung der Nutzenaspekte
Tab. 5.3
Merkmale – Eigenschaften, Vorteile, Bewertung
Tab. 5.4
Merkmale – Eigenschaften
Tab. 5.5
Merkmal Material: Beispiel
Tab. 5.6
Mehrwert-Faktoren
Tab. 5.7
Definitionen
Tab. 6.1
Kaufzyklus und Kundennutzen
Tab. 6.2
Preisbildungsszenarien
Tab. 6.3
Tabelle zur Einordnung der Nutzenaspekte
Tab. 6.4
Arbeitsblatt Nutzenkalkulation
Tab. 6.5
Beispiel Nutzenkalkulation Mitarbeiterzufriedenheit
Tab. 6.6
Beispielkalkulation für qualitativen Nutzen
Tab. 6.7
Nutzwert-Analyse Beispiel
Abb. 7.1
Wachstum sichert die Unternehmenszukunft
Tab. 7.2
Prinzip des Kano-Modells
Tab. 7.3
Morphologischer Kasten – Beispiel
Tab. 7.4
Käufer-Nutzen-Matrix
Tab. 7.5
Nutzen-Hebel in Erfahrungsphasen – Beispiele
Tab. 7.6
Customer Journey - Sicht Anbieter
Tab. 7.7
Customer Journey - handeln, denken, fühlen
Tab. 7.8
Aktivitäten und Prozesse
Tab. 8.1
Die Wertaussage in den Kaufphasen
Tab. 8.2
Differenzierung von Anspruch und Angebot
Tab. 8.3
Brückenschlag Kundenanforderungen und Lösungsangebot
Abb. 8.4
Produkt- versus Lösungs-Marketing
Abb. 8.5
Wert und Anspruch bezogener Leistungsansatz
Abb. 8.6
Effektiv und effizient verkaufen
Abb. 8.7
Das ganze Potenzial ausschöpfen
Tab. 8.8
Vertriebswege und Kommunikationsinstrumente online / offline
Abb. 8.9
Das Beziehungs-Dreieck
Abb. 8.10
Zuerst Nutzen und Wert diskutieren
Abb. 8.11
Wert vor Preis, statt Preis vor Wert
Abb. 8.12
Vom Preisverhandler zum Mehrwertberater
Abb. 8.13
Drei Ebenen im „Auftrags“- Gespräch
Tab. 8.14
Die Phasen im Verkaufsgespräch
Abb. 8.15
Welche Anforderungen stellen die Kunden Ihrer Kunden?
Tab. 8.16
Umgang mit den an der Kaufentscheidung beteiligten Personen
Tab. 9.1
Wert des und für den Kunden
Abb. 9.2
Die Unternehmens-Vitalität
Abb. 9.3
Ein Marktführer braucht
Abb. 9.4
Das 7-Mit-Prinzip guter Führung
Abb. 9.5
Nutzenkalkulation (Beispiel
)
Abb. 9.6.A
Umsatz . Kosten . Gewinn
Abb. 9.6.B
Hebelwirkung von Menge und Preis
Abb. 9.7
Unternehmensprozesse
Tab. 9.8
Reifegradmodell Ablauforganisation
Tab. 9.9
Einfluss-/Wechselwirkungs-Analyse
Tab. 9.10
Vernetzungs-Matrix
Tab. 9.11
Geschäftsprozess-Analyse
Tab. 9.12
Kritische Erfolgs- und Kauffaktoren
Tab. 9.13
17 Denkanstöße zur Erfolgssteigerung
Abb. 9.14
Projektmanagement
Abb. 10.1
Die zentralen Erfolgsfaktoren
Abb. 10.2
Austauschbarkeit
Abb. 10.3
Wenn eine der Boxen fehlt
Abb. 10.4
Bewertung der Maßnahmen-Wirkung
Abb. 10.5
Maßnahmen richtig priorisieren
Die Bilder auf den Seiten →, →, → stammen von shutterstock.com/de/.
1. Der Markt
Der Markt ist Teil der Volkswirtschaft und lässt sich selbst in Teilmärkte gliedern. Grob gesagt sind das der Beschaffungs- und Absatzmarkt sowie der Personal- und Kapitalmarkt. Jeder dieser Teilmärkte hat seine eigenen Gesetze und Regeln. Und die Marktteilnehmer verfolgen ihre eigenen Interessen.
Jeder Marktteilnehmer ist in mindestens zwei Rollen unterwegs: als Kunde und als Lieferant. Und alle sind in diesen Rollen mit anderen vernetzt und entfalten ihre Kräfte.
1.0.1 Das Kraftfeld
Sie stellen ihre Fähigkeiten in Form von Leistungen und Produkten zur Verfügung. Wer die Angebote nutzen will, muss etwas dafür bezahlen. Dieses Geben und Nehmen finden auf unterschiedlichen Ebenen und Szenarien statt.
Abb. 1.1 Der Markt als Kraftfeld
„Der Markt ist die treibende Kraft.“ Das stimmt aus meiner Sicht. Wenn ein Unternehmen sich gegen die Marktkräfte stemmt, dann verhält es sich wie ein Schwimmer, der versucht gegen den Strom zu schwimmen, um das Ufer auf der gegenüberliegenden Seite zu erreichen. Ihm erlahmen früher oder später die Kräfte und er wird von der Strömung mitgerissen.
Klüger verhält sich der Schwimmer, wenn er ein Stück weiter stromaufwärts einsteigt und mit der Strömung, kraftsparend und zügig, zum anderen Ufer schwimmt.
Je nachdem in welchem Geschäftsfeld ein Unternehmen tätig ist, ist es von der Lieferfähigkeit des Beschaffungs-, Personal- und Kapitalmarktes und der Aufnahmebereitschaft des Absatzmarktes abhängig.
Zudem verändern sich Märkte aufgrund von äußeren und inneren Einflüssen. Äußere Einflüsse sind Katastrophen, Kriege, Krisen und Politik. Innere Einflüsse entstehen beispielsweise durch Forschung und Entwicklung, Innovation, Globalisierung, Digitalisierung und Wettbewerb (siehe Tabelle 1.2).
Impulsgebende (Schlüssel-)
•
Technologie
Trends:
•
gesetzliche
•
gesellschaftliche und kulturelle
•
sozioökonomische
Makroökonomische Kräfte:
•
Globale Marktbedingungen
•
Kapitalmärkte
•
wirtschaftliche Infrastruktur
•
Wirtschaftsgüter und andere Ressourcen
Marktkräfte:
•
Marktsegmente
•
Wünsche und Anforderungen
•
Marktaspekte
•
Wechselkosten
•
Umsatzattraktivität
Branchenkräfte:
•
Lieferanten und andere Teilnehmer der Wertschöpfungskette
•
Stakeholder
•
Wettbewerber (etablierte)
•
Neueinsteiger (Rebellen)
•
Ersatzprodukte und -dienstleistungen
Tab. 1.2 Marktbeeinflussende Kräfte
Die Marktveränderungen bedeuten für die einen Unternehmen Wachstum, für andere Stagnation oder Rückgang. Und sie können rasend schnell eintreten und die Existenz bedrohen. In diesem Jahrhundert reihte sich bereits eine Naturkatastrophe an die andere, zeigt der Klimawandel sein hässliches Gesicht. Es platzte die New-Economy- und die Immobilienblase in den USA. Anschließend kamen die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise. Der Dieselskandal wurde aufgedeckt und der Brexit ausgelöst. Die Liste ließe sich seitenlang fortsetzen.
Die Corona-Krise schließlich betraf die ganze Welt und führte teilweise zu einem mehrere Monate dauernden Stillstand der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Ganze Branchen brachen in sich zusammen. Lieferketten sind gerissen. Millionen Menschen verloren über Nacht ihren Job und ihre Existenzgrundlage. Es wird lange dauern, bis der Normalzustand wieder erreicht sein wird. Aber dieser wird sicher anders als vorher sein.
Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe sind. Wie hilfreich schnelle Information, Kommunikation und umsichtiges Handeln sind. Aber auch, welche Nachteile mit hoher Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, mangelnder Digitalisierung, Infrastruktur und Vorsorge verbunden sind.
Wir können davon ausgehen, dass sich die Lage in irgendeiner Form beruhigen wird und dann die vor der Corona-Krise bekannten Veränderungen und Herausforderungen den Unternehmensalltag wieder bestimmen werden. Hier ein paar Beispiele:
Veränderungen
sinkende
Lieferzeiten
Produktzyklen
Marktpreise
steigende/r
De-/Regulierung
Wettbewerb
Vertriebsaufwand
Herausforderungen
globalisierte Märkte
Kundenerwartungen
Produktvergleichbarkeit
Innovation
Digitalisierung
Rationalisierung
Optimierung
Demographie
Der Wunsch der Menschen nach Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität, das Gewinnstreben sowie die Informationstechnologie und der Wettbewerb werden maßgebliche Treiber bleiben.
1.1 Die Kundenwelt
Natürlich gibt es Unterschiede im Geschäft mit Unternehmen (B2B) und Endverbrauchern (B2C). Für die meisten hat der Gesetzgeber gesorgt.
Zwei Fragen sind in beiden Geschäftsarten gleich. Die erste Frage lautet: „Unter welchen Umständen ist ein Interessent oder Kunde bereit, mehr zu bezahlen oder überhaupt Geld auszugeben?“
Die Antwort ist wohl einfach: „Wenn der Kunde für sein Geld einen von ihm gewünschten Nutzen, mit entsprechendem Gegenwert, erhält.“
Und die zweite Frage lautet: „Wie schaffen wir es, dass sich Kunden für uns interessieren und bei uns kaufen?“
Meine Antwort: „Wir müssen die sogenannte Customer Journey so gestalten, dass der Kunde an allen Kontaktpunkten spürt, dass wir ihn verstehen, seine Bedürfnisse kennen, ihm ehrlich und fair helfen und ihm nicht unnötig Geld aus der Tasche ziehen.“
Da fast alle Produkte und Dienstleistungen hochgradig austauschbar sind, kommt es immer mehr auf das Gesamtpaket bzw. Drumherum an. Lange Lieferzeiten und schlechte Erreichbarkeit bzw. minutenlange Wartezeiten am Telefon sind beispielsweise eindeutige Verkaufsverhinderer. Angenehmes Ambiente, Freundlichkeit, Kompetenz und Engagement des Personals wirken dagegen verkaufsfördernd.
1.2 Die Anbieterwelt
Vermutlich wird es weiterhin so sein, dass die Kundenansprüche genauso steigen wie der Wettbewerb der Anbieter.
Es werden weiterhin schneller neue Produkte und Lösungen auf den Markt kommen als alteingesessene Unternehmen sich anpassen/ändern können.
Jedes Unternehmen ist daher gut beraten, sich mit dem Trend der aktuellen Geschäftssituation und der wahrscheinlichen Marktentwicklung regelmäßig und systematisch auseinanderzusetzen. Denkanstöße könnten folgende marktorientierte Fragen sein:
1.3 Die Bedeutung des Preises
Die Ziele und Interessen der Kunden, Händler und Hersteller bilden ein Spannungsfeld auf drei Ebenen.
Ziele
Kunde
Handel
Hersteller
Energie-/Beziehungs- Ebene
Freundlichkeit Entscheidungshilfe Fairness
Nachfrage Kundennähe Kundennutzen Kundenloyalität Beziehungsqualität
Image Innovationskraft Loyale Beziehungen
Leistungs-/Steuerungs- Ebene
niedriger Preis
prima Beratung einfache, schnelle Beschaffung super Service
hohe Marge
innovative, kreative Produkte + Service Herstellermarketing Rausverkauf
ordentl. Gewinn
Niedrige Vertriebskosten Händlermarketing Reinverkauf
Vermögens-/Substanz- Ebene
Leistung/Nutzen für sein Geld
Sortiment
Produkte Marktanteil
Tab. 1.3 Spannungsfeld Kunde - Handel - Hersteller
Auf der Energie- und Beziehungsebene geht es um die emotionalen Bedürfnisse. In wettbewerbsintensiven Käufermärkten ist das auch die für eine Kaufentscheidung wichtigste Ebene.
Vor dem Hintergrund der jeweiligen Erwartungen und Ziele finden auf der Leistungs- und Steuerungsebene die Prozesse statt. Und auf der Vermögens- und Substanzebene sehen wir die materiellen Ergebnisse.
Der Preis ist das sensibelste Thema in der Verkaufskommunikation, denn er beeinflusst unmittelbar und in hohem Maße die Marge und den Gewinn.
Ständig wird irgendwo eine Rabattschlacht eröffnet oder ein Preiskrieg geführt. Wir denken fast nur noch in Preisknüller oder niedrigsten Preisen. Wir unterscheiden nicht zwischen Kosten und Investitionen. Und wenn doch, werden bei Investitionen häufig die Betriebskosten unzureichend berücksichtigt. Es zeigt sich immer wieder:
Wer sonst nichts weiß, redet als Käufer oder Verkäufer nur über den Preis.
Preisnachlässe sind Abzüge für mangelnden Wert.
Wo bleibt da der Anspruch, für eine gute (bessere) Leistung auch einen angemessenen Preis durchzusetzen?
Ich bin davon überzeugt, es ist leichter eine gute Sache teuer zu verkaufen als eine schlechte billig.
Und es ist erfahrungsgemäß leichter, Kunden zu halten als neue zu gewinnen. Entsprechend gibt es häufig Bereitschaft, mit dem Preis etwas entgegenzukommen.
Trotzdem empfehle ich mit Preissenkungen immer sehr überlegt umzugehen. Wenn Preissenkungen nicht zu signifikanten Mehrverkäufen führen, bedeutet dies eine direkte Gewinnreduzierung und damit auch Vermögensverlust durch eine geringere Ertragskraft des Unternehmens. Dieser Punkt ist wichtig, wenn beispielsweise im Zuge einer Nachfolgeregelung Überlegungen bestehen, das Unternehmen zu verkaufen.
Viel zu schnell und meist unnötig werden Nachlässe eingeräumt, ohne die Konsequenz auf den Gewinn bedacht zu haben.
Die Frage, die sich die wenigsten Unternehmen stellen, lautet: "Unter welchen Umständen wären Kunden bereit, für eine Sache mehr zu bezahlen oder überhaupt Geld auszugeben?"
Denn eins steht fest, die Rendite aller austauschbaren Produkte und Dienstleistungen tendiert aufgrund des Preisverfalls gegen null.
Schauen Sie sich bitte die Abbildung 1.4 an: Angenommen ein Unternehmen erzielt beim Verkauf von 1.000 Produkten nach Abzug der Kosten einen Gewinn in Höhe von 5 %. Bei einem Rabatt von "nur" 2% ergäbe sich jedoch eine extreme Gewinnschmälerung um 40 %!
Abb. 1.4 Preisnachlässe vernichten Vermögen
Noch gravierender ist neben dem Gewinnverlust der gleichzeitige Vermögensverlust.
Nehmen wir an, das Unternehmen kann den Preisverfall für seine Produkte weder durch mehr Verkäufe noch durch Produktivitätssteigerung ausgleichen.
lm Beispiel der folgenden Tabelle 1.5 rechnen wir mal über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einem angenommenen Gewinnrückgang von nur 5% und nicht 40 %, wie im vorherigen Beispiel.
Dann würde sich der Unternehmenswert im Falle einer Multiplikatoren-Bewertung mit dem Durchschnittsfaktor fünf im gleichen Zeitraum um satte 22,6% reduzieren. In Summe hat das Unternehmen in fünf Jahren 183.295 € bzw. 36,6% verloren. Das ist eine Riesennummer.
Abb. 1.5 Preisverfall bedeutet Gewinnrückgang und Vermögensverlust
Und wenn wir bedenken, wie viele Unternehmer mehr oder weniger ihr gesamtes Vermögen im Unternehmen stecken haben, ist diese Angelegenheit dringend zu bearbeiten.
Nicht zuletzt bin ich deswegen ein Verfechter der Strategie „besser vor billiger“. „besser“ kann auch mehr Leistung/Menge bedeuten.
Zusammenfassung:
Der Markt ist ein äußerst dynamisches Kraftfeld. Es erfordert von den Akteuren spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, überlegtes und planvolles Vorgehen.Empfehlung:
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsposition mit Bezug zur Marktentwicklung.2. Ausgangssituation und Ziel des Unternehmens
2.1 Die Phase des Unternehmens
Wie wir Menschen verschiedene Lebensphasen durchlaufen, so entwickeln sich auch Unternehmen in mehreren Phasen. Von der Gründungs- und Startphase über die Wachstums- und Reifephase zur Konsolidierung und Erneuerung oder in die Sterbe-/Insolvenzphase.
In der folgenden Grafik ist der „klassische“ Verlauf vieler Produkte und Organisationen dargestellt.
Abb. 2.1 In welcher Phase befinden Sie sich?
Wenn es nach stürmischem Wachstum ruhiger wird, die Ergebnisse nicht mehr erreicht werden, die man gewohnt ist oder sich wünscht, beginnt meist operative Hektik und Erhöhung des Drucks. Es werden andere Gänge eingeschaltet, der Ton wird rauer, die Frequenz erhöht, um – ähnlich dem Mountainbike-Fahren – trotzdem nur langsam voranzukommen.
Sofern nicht gegengesteuert und das Unternehmen nicht kontinuierlich entsprechend der Umfeldveränderungen angepasst wird, folgen früher oder später die Insolvenz oder Liquidation. Die sechste Phase kann aber auch ein erneuter Aufschwung sein, wenn die richtigen Maßnahmen umgesetzt werden.
Doch hier heißt es genau hinzuschauen. Äußeres Wachstum kann über inneren Niedergang hinwegtäuschen. Bei langanhaltender Stagnation oder schleichenden Rückgang verliert in Wirklichkeit das Unternehmen energetisch und es kommt zur Insolvenz.
Ein neuer, nachhaltiger Aufschwung scheint am ehesten möglich, wenn mit bahnbrechendem Denken und Handeln neue Produkte/Dienstleistungen und ein zeitgemäßes Geschäftsmodell angeboten werden. Stichworte sind unter anderem Disruption und Digitalisierung.
Alle Phasen können unterschiedlich lang sein. Es hängt von der Dynamik innerhalb einer Branche, der Unternehmensfitness und letztlich von der Geschäftsführung und den Mitarbeitern ab.
Natürlich ist es schwierig, frühzeitig und objektiv die Phase, in er man sich befindet, zu bestimmen. Noch herausfordernder ist es, mit dieser Erkenntnis auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und adäquate Maßnahmen umzusetzen. Trotzdem lassen Sie uns den Versuch unternehmen.
Alle großen Probleme haben wir, weil wir früher die Konsequenzen unseres Handelns nicht zu Ende gedacht haben, zu wenig zukunftsorientiert handeln. Ein „weiter so wie bisher“ erscheint nicht sinnvoll. Änderungen stoßen auf massive Widerstände.
Und wir sehen bereits Symptome, deren Folgen für die Gesellschaft sowie Wirtschaft immer unkalkulierbarer werden; hier nur drei Stichworte:
Klimawandel – durch Waldvernichtung und Umweltvergiftung;
Flüchtlingsströme – wegen Krieg, Perspektivlosigkeit und zunehmende Unbewohnbarkeit von Landstrichen;
Pandemien – Corona-Krise.
Aufgrund der Ungewissheit in Märkten und Branchen sowie den technologischen und allgemeinen Umfeldern sollten wir nicht mehr versuchen, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern stattdessen mehrere, vorstellbare Zukunftsbilder entwickeln und betreiben.
Und von Zeit zu Zeit sollte das gesamte Geschäft durchdacht werden – so als ob Sie es neu gründen würden – und ein qualitativer Sprung für neues Wachstum initiiert werden.
Spätestens 20-25 Jahre nach der Gründung ist auf jeden Fall eine grundlegende Runderneuerung des Unternehmens fällig.
Unternehmen lassen sich bezüglich ihrer Lebenskraft und Unternehmens-Entwicklung in vier Kategorien einteilen:
Die Verteilung in die Kategorien ist erfahrungsgemäß etwa wie folgt:
7 % sind konsequent zielorientiert, innovativ, vertriebsstark, attraktiv.
60 % kennen zwar Verbesserungsmöglichkeiten, aber "es tut noch nicht weh genug", um konsequent zu handeln.
Bei 25 % der Unternehmen sinkt definitiv die Wettbewerbsfähigkeit und steigt die Insolvenzgefahr, wenn Probleme oder Engpässe nicht beseitigt werden.
Und 8 % gehen in die Insolvenz, wenn sie nicht saniert werden.
Immer kürzere Konjunktur- und Innovationszyklen, Überkapazitäten, Globalisierung und Verdrängungswettbewerb zwingen jedes Unternehmen, seine Leistungsfähigkeit und Unternehmensentwicklung ständig zu hinterfragen und zu verbessern.
Die traditionellen Kostensenkungspotenziale sind in den meisten Fällen ziemlich ausgeschöpft. Daher liegt die größte Hebelwirkung hinsichtlich des Unternehmenserfolgs und der Unternehmensentwicklung auf der Absatz- und Vertriebsseite.
Dabei muss es nicht in erster Linie um quantitatives Wachstum gehen. Qualitatives Wachstum führt automatisch zu quantitativem Wachstum. Das strategische Motto lautet: „Besser vor billiger, Zeit vor Ort“.
Die Schlüsselerfolgsfaktoren sind dabei die Führung, der gelieferte Kundennutzen und die Mitarbeiter als Erfolgsteam Ihres Unternehmens.
2.3 Weg von Engpässen, Schwierigkeiten, Problemen
In Bezug auf die Dynamik gibt es nach meiner Erfahrung vier Unternehmenstypen:
A) Unternehmen, die sich in einem ständigen kontinuierlichen Verbesserungs-und Erneuerungsprozess befinden und starke Lebenskraft besitzen.
B) Unternehmen, die als Startup oder Technologieschmiede früher oder später verkauft und in eine größere Organisation integriert werden.
C) Unternehmen, die im Zuge des Nachfolgeprozesses verschiedene Betriebsteile „auf Vordermann bringen“.
D) Unternehmen, die mehr oder weniger dümpeln, labil oder sanierungsbedürftig sind und nur dann Verbesserungsmaßnahmen einleiten, wenn der Handlungsdruck hoch genug ist oder „das Wasser bis zum Hals steht“.
Den Großteil meiner Berufslaufbahn habe ich in einem Unternehmen der Kategorie A verbracht und dabei sehr viel Methodenwissen erworben sowie Verkaufs- und Führungserfahrung gesammelt.
Dieses Know-how konnte ich als selbstständiger Unternehmensberater bisher überwiegend mit Unternehmen der Kategorie C) und D) teilen.
Ich starte Projekte grundsätzlich mit einer Analyse der Ausgangssituation, um sicherzustellen, dass wir zur Erreichung der Projektziele auch die richtigen Aufgaben bearbeiten. Denn regelmäßig stellt sich heraus, dass die Ursachen von Problemen und Schwierigkeiten meist ganz woanders liegen, als der Auftraggeber annimmt.
Wie bei einem Eisberg, ist bei Problemen und Schwierigkeiten auch nur der kleinere Teil sichtbar und zeigt sich in den Zahlen, Daten und Fakten, beispielsweise beim Produkt, dem Preis, den Prozessen, Terminen und Kundenstimmen.
Der größere Teil ist unsichtbar und liegt in den Gefühlen der Menschen, der Werte und Kultur des Unternehmens. Dieser manifestiert sich in der Motivation und dem Verhalten der Mitarbeitenden.
Um dies zu unterstreichen, habe ich in dieses Buch aus verschiedenen Projekten einige Zitate übernommen:
„Unsere Handlungsunfähigkeit macht uns kaputt.“
„Von Insellösungen zu Gesamtlösungen kommen.“
„Der große Wurf fehlt.“ „ Welche Strategie haben wir eigentlich?“
„Angstkultur: 100% Fehlerfreiheit gibt es nicht für alles und ist nicht bezahlbar.“
„Jeder gibt sein Bestes … in der Abteilung.“
„Wir arbeiten nicht prozessorientiert, sondern denken in Abteilungen … abgeteilt vom Ganzen.“
„Die Anforderungen der Interessenten werden anspruchsvoller und komplexer. Wir werden dadurch immer mehr ins Projektgeschäft gezwungen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir es klar aussprechen. Welche Strategie verfolgen wir?“
„Als Vertriebler wie ein „dummer Bittsteller“ behandelt zu werden, macht keinen Spaß. Wir brauchen technische Unterstützung.“
Als Unternehmer und Führungskraft das Ohr stets unvoreingenommen am Kunden, den Geschäftspartnern und vor allem den Mitarbeitenden zu haben, ist gut investierte Zeit. Sie erkennen so schneller Veränderungen, erhalten Ideen und werden inspiriert, Stärken besser zu nutzen und auszubauen.
Wer die Veränderungen nicht adaptiert, nicht mitgestaltet und die neuen technischen Möglichkeiten nicht nutzt, wird früher oder später Opfer der Entwicklungen. Wer nicht handelt, wird vom Markt behandelt.
Machen Sie es daher wie mit Ihrem Auto und dem TÜV. Stellen Sie mindestens alle 2-3 Jahre Ihr Unternehmen aus der Kundenperspektive auf den Prüfstand.
Laden Sie dazu beispielsweise zu einem eintägigen Bestandsaufnahme-Workshop ein. Teilnehmen sollten die Geschäftsleitung und die Verantwortlichen der Bereiche Marketing, Verkauf, Produkt-Management und -Entwicklung sowie der IT.
Betrachten Sie alle Unternehmensbereiche, Geschäftsfelder, Ihre Produkte, Prozesse, Ihr Personal und Ihre Ergebnisse. Welche Schwierigkeiten und Engpässe hat das Unternehmen? Welche Produkte und Dienstleistungen geben Anlass zur Beschwerde? Welche Anforderungen stellen die Kunden und Vertriebspartner? Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden? Worauf müssen Sie sich einstellen?
Für einen Tag ist das viel Stoff. Aber mit einer strukturierten, formatierten Vorgehensweise ist es effektiv und mit fundierten Ergebnissen zu machen. Bewährt hat sich der Einsatz eines qualifizierten und neutralen (externen) Moderators.
Der Nutzen eines solchen Workshops ist hoch:
Der zeitliche und finanzielle Aufwand ist hierfür vergleichsweise sehr gering. Also legen Sie am besten gleich los. Laden Sie zu einem entsprechenden Workshop ein. Sie wissen ja, was der Mensch nicht innerhalb von 72 Stunden beginnt in die Tat umzusetzen, löst sich ‚in Luft‘ auf.
2.4 Hin zu Herausforderungen, Zielen, Wünschen
Wer seinen eigenen Standpunkt und das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht wissen. Ihre Ausgangssituation haben Sie gemäß dem vorherigen Kapitel geklärt. Jetzt geht es darum, welche Ergebnisse und Marktposition Sie bis wann erreichen möchten.
Ich vermute mal, Sie wollen mit weniger Aufwand profitabel und nachhaltig mehr Gewinn machen.
Eine interessante Frage ist in diesem Zusammenhang: Wer sind Ihre drei wichtigsten Mitbewerber und aus welchen drei Gründen verlieren Sie gegen die Aufträge? Schreiben Sie Ihre Antwort jetzt bitte kurz auf.
Wenn Sie sich nun auf den Weg machen, Ihre Position zu verbessern, geht es stets um Handlungen in zwei Richtungen: Umsatzsteigerung und Effizienzsteigerung. Das folgende Schaubild 2.5 Ihre Wettbewerbsposition? zeigt den Zusammenhang.
Umsatzsteigerung ist nicht gleichbedeutend mit Mengensteigerung (Absatz). Es darf auch eine Preissteigerung sein. Natürlich müssen das Ihre Leistungen hergeben.
Bei der Effizienzsteigerung geht es darum, alle Prozesse und Tätigkeiten zu betrachten. Sind sie notwendig und wertschöpfend? Wenn ja, wie können Sie diese schneller, fehlerfreier, kostengünstiger, hochwertiger erledigen und die Kapazitäten besser nutzen?
In Märkten mit einem Überangebot, sowie hochgradig austauschbaren Produkten und Dienstleistungen, ist die