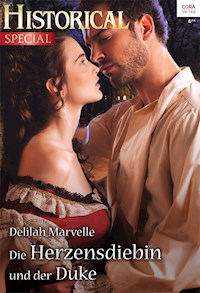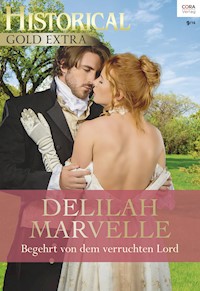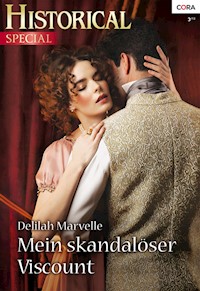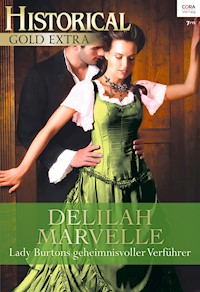
6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Gold Extra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Ich will keinen Ehemann!" Lady Bernadette Burton hat der Liebe abgeschworen, wird sie doch als reichste Frau Englands ständig von Männern bedrängt, die es nur auf ihr Vermögen abgesehen haben. Doch dem geheimnisvollen Unbekannten, der sie aus der Gewalt eines besonders skrupellosen Mitgiftjägers rettet, kann sie trotz allem einfach nicht widerstehen. Matthew ist so verwegen und verführerisch, dass ihr der Atem stockt. Und was spricht schon gegen ein einmaliges Rendezvous um Mitternacht? Aber kaum liegt sie in Matthews Armen, spürt Bernadette, dass sie noch keinen so begehrt hat wie ihn - und eine einzige Nacht niemals genug sein kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
IMPRESSUM
HISTORICAL GOLD EXTRA erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2012 by Delilah Marvelle Originaltitel: „Forever A Lady“ erschienen bei: HQN Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL GOLD EXTRABand 82 - 2015 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg Übersetzung: Gisela Grätz
Abbildungen: Harlequin Books S.A., alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 12/2015 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733765736
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
PROLOG
Überleben, meine Herren. Das ganze Leben dreht sich nur ums Überleben.
– Der Truth Teller, eine New Yorker Wochenzeitung für Herren
Orange Street, New York City, Juni 1822
Als nicht mehr zu leugnen war, dass sie ihr Buchhalter und langjähriger Freund Richard Rawson über Jahre betrogen hatte, schalteten Matthew und sein Vater die Polizeibehörde ein und verlangten Richards unverzügliche Verhaftung. Richard musste geahnt haben, dass ihm der Galgen drohte, denn er war den Ermittlern zuvorgekommen und rechtzeitig abgehauen. Er hinterließ einen Haufen Gerümpel und seine geckenhafte Garderobe, die nicht einmal das Schwarze unter einem Fingernagel wert war. Der Rest der zweitausend Dollar, die er bei der Zeitung unterschlagen hatte, war längst verprasst: beim Glücksspiel, in Freudenhäusern und für die zahllosen Kinkerlitzchen, die die Huren meinten haben zu müssen.
Als bewaffnete Marshalls den Schurken endlich unter den Augen zahlreicher Schaulustiger im Bowling Green Park, gleich neben dem Broadway, stellten, kam ihm sein Pferd zu Hilfe. Es bäumte sich verschreckt auf und warf den Betrüger ab. Beim Sturz brach sich Richard Rawson das Genick. Er wurde für tot erklärt, während die einst florierende Zeitung der Miltons, der Truth Teller, Bankrott anmelden musste.
Warum war dieser Verbrecher Richard Rawson nur so glimpflich davongekommen? Hätte er gelähmt überlebt, wäre es Matthew Joseph Milton leichter gefallen, die Demütigung zu akzeptieren, dass er und sein Vater, ehedem wohlhabende Besitzer des Truth Teller mit einem Jahreseinkommen von mehr als dreihundert Dollar, heute gerade einmal acht Dollar und zweiundvierzig Cents besaßen.
Matthew ging neben seinem Vater her und schloss die Finger fester um die zusammengebundenen Enden der beiden groben Leinensäcke, die er über den Schultern trug. Das hier war also ihr neues Wohnviertel. Er legte den Kopf in den Nacken und blickte an der unverputzten Fassade eines düsteren Gebäudes hoch. Stechender Uringeruch lag in der Luft. Es war brütend heiß.
Konnte der liebe Gott wirklich so grausam sein?
Ja, er konnte es nicht nur, er war es auch.
Die glühende Nachmittagssonne brannte auf Matthews Stirn. Schweiß lief seine Schläfen hinab. In den offenen Fenstern lehnten Männer mit nackten Oberkörpern und gafften auf die Straße herunter. Andere saßen mit dreckigen Füßen auf den Fensterbänken und tranken irischen Whiskey oder rauchten halbe Zigarren. Es waren allesamt Tagediebe, die zu glauben schienen, sie lägen auf einer Decke am grasbewachsenen Ufer irgendeines Sees. Matthew bemerkte den bohrenden Blick eines vierschrötigen Kerls direkt über ihm. Er lehnte sich aus dem Fenster und spie geräuschvoll aus. Die zähe braune Spucke landete eine Handbreit neben Matthew auf dem Pflaster.
Der Mann hatte absichtlich auf ihn gezielt.
Matthew sah seinen Vater an. Raymond Charles Milton hielt eine Kiste druckfrischer Zeitungen unter den Arm. „Konnte dein Partner wirklich nicht mehr für uns tun? Ich finde, ein höherer Rabatt wäre durchaus in Ordnung gewesen.“
Sein Vater musterte die Fassade abschätzig und schüttelte langsam den Kopf. Es war nicht zu übersehen, dass ihm ebenso wenig daran lag, dieses Gebäude zu betreten, wie Matthew.
Einer von ihnen beiden musste optimistisch bleiben. Matthew stupste seinen Vater an. „Es könnte schlimmer sein. Immerhin könnten wir auch im Schuldgefängnis sitzen“, sagte er so zuversichtlich, wie er nur konnte.
Sein Vater warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
Matthew schwieg. Ein Junge im Alter von sechs oder sieben Jahren kam in viel zu großen Kleidern und Stiefeln auf sie zugeschlurft. Das schlurfende Geräusch seiner Schritte verriet, wie viel Anstrengung es ihn kosten musste, die Stiefel an seinen kleinen Füßen zu behalten.
Als sein Blick auf Matthew fiel, blieb der Knabe wie angewurzelt stehen. Das unförmige Leinenhemd reichte ihm bis zu den von schlabberigen Hosen halb verdeckten Knien. Mit kundigem Blick musterte er Matthews Krawattentuch und seine bestickte Weste. Es schien, als taxiere er ihren Wert.
Eines Tages würde er einen ganzen Stall voll Kinder haben, dessen war sich Matthew sicher. Eines Tages. Und er hoffte, dass er sich dann bessere Kleidung für seinen Nachwuchs leisten konnte als die, die dieser kleine Bursche hier trug. Er lächelte. „Guten Tag, junger Mann. Wie geht es dir?“
Der Knabe riss seine großen braunen Augen verblüfft auf. Er tat einen Schritt zurück, dann noch einen, dann drehte er sich um, rannte los und überquerte stolpernd die Straße.
Sein Vater versetzte Matthew einen Stoß mit der Zeitungskiste. „Was machst du da, Matthew?“
„Nichts. Ich habe ihn nur gefragt, wie es ihm geht. Anscheinend ist er es nicht gewohnt, dass man freundlich zu ihm ist.“
Sie schwiegen.
Das Rumpeln vorbeifahrender Karren und die Rufe und Flüche von Männern, die gelegentlich von einem entfernteren Teil der Straße an ihr Ohr drangen, erinnerten sie daran, dass sie nicht mehr in der Barclay Street waren. Hier gab es keinen weitläufigen baumbestandenen Platz, keine tadellos lackierten Kutschen und keine elegant gekleideten Fußgänger, denen man ansah, dass sie dem geachteten Kaufmannsstand angehörten.
Stattdessen waren sie hier.
„Ich hätte Richard Rawson niemals Prokura erteilen dürfen.“ Sein Vater schüttelte resigniert den Kopf. „Nun bist du durch meine Schuld mittellos und ohne Aussicht auf eine Ehe. Hätte ich anders entschieden, wärst du jetzt mit Miss Drake verheiratet.“
Als sein Vater den Namen erwähnte, schleuderte Matthew die Säcke aufs Pflaster. „Ich kann damit leben, dass wir arm sind, Dad. Ich komme auch mit dem Gestank hier und allem anderen zurecht, was ich aber nicht ertrage, sind deine Selbstvorwürfe. Soll diese vermaledeite Miss Drake zur Hölle fahren. Wenn sie mich so geliebt hätte, wie ich Dummkopf sie liebte, dann wäre sie mit mir gegangen. Ich habe sie darum gebeten.“
Sein Vater musterte ihn. „Wärst du an ihrer Stelle freiwillig hierher mitgegangen?“
Matthew atmete geräuschvoll aus. Er versuchte den Schmerz darüber, dass er Miss Drake so wenig bedeutet hatte, nicht an sich heranzulassen. „Ich bin erst zwanzig, Dad. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Eines Tages finde ich eine Frau, die mich liebt. Unabhängig von meinem Bankkonto.“
Sein Vater stemmte sich die Kiste auf die Hüfte und kramte in seiner Westentasche. „Es ist ein Segen, Matthew, dass du selbst noch dem schlimmsten Moment etwas Gutes abzugewinnen verstehst.“ Er warf ihm einen Vierteldollar zu. „Besorg uns etwas zu essen. Und teile das Geld gut ein. Wir haben noch keine Arbeit. Ich bringe derweil unsere Sachen ins Haus. Reich mir nur eben die Säcke an, ja?“
Matthew schnappte die Säcke und hob sie auf die Kiste. Sein Vater klemmte sich den obersten Sack unters Kinn, verschwand im Hauseingang und schlängelte sich die schmale Stiege hinauf.
Matthew atmete laut aus und machte sich auf den Weg. Er folgte der unbefestigten Straße und ließ den Blick suchend über die verwitterten Holzschilder an den Fassaden der heruntergekommenen Gebäude rechts und links von ihm schweifen. Schief aufeinandergestapelte Kisten mit fauligen Früchten und welkem Gemüse standen unbeaufsichtigt neben offenen Türen. Von einer der Kisten flog ein Schwarm Fliegen auf, nur um sich gleich darauf auf einer anderen niederzulassen. Es schien beinah so, als ob selbst die Insekten der Qualität dieser Waren misstrauten.
Matthew vermisste ihren Koch schon jetzt.
Ein ersticktes Schluchzen weckte seine Aufmerksamkeit. Matthew entdeckte auf der anderen Straßenseite einen rothaarigen Kerl in einem ausgefransten Hemd und mit geflickten Hosen, der einen kleinen Jungen bei den Haaren packte und ihn kräftig schüttelte.
Es war der Junge mit den viel zu großen Stiefeln.
Ein Kohlenkarren rumpelte vorbei, während der unrasierte Hüne sich über den Knaben beugte, ihn abermals schüttelte und etwas zu ihm sagte. Der Junge schluchzte verzweifelt und versuchte sich mühselig auf den Füßen zu halten.
Unwillkürlich schloss Matthew die Finger um die Münze, die ihm sein Vater gegeben hatte. Er war kein Boxer, aber einem so ungleichen Kampf würde er ganz sicher nicht tatenlos zusehen. Er steckte den Vierteldollar in die innere Westentasche, wich ein paar Frauen aus, die ausladende Weidenkörbe trugen, und schoss über die Straße auf die Streithähne zu.
„Und sag deiner Mutter, dieser elenden Hure, dass ich mein Geld will“, schäumte der Rotschopf. „Sie schuldet mir fünfzehn Cents. Fünfzehn Cents!“
„Sie hat das Geld nicht.“ Der Junge schrie gellend auf und griff sich an den Schädel.
Matthew stoppte direkt vor den beiden. Sein Herz raste. Er versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, damit der Zwist nicht in etwas ausartete, das ein Junge in diesem Alter nicht erleben sollte. „Lass ihn los. Ich zahle, was seine Mutter dir schuldet.“
Der rothaarige Hüne wandte ihm ruckartig sein schweißglänzendes, sonnenverbranntes Gesicht zu. Er stieß den Jungen fort, drehte sich um und türmte sich vor Matthew auf. Er überragte Matthew um gut einen Kopf. „Zwanzig Cents habe ich von ihr zu kriegen.“
Matthew atmete tief durch. Der säuerliche Geruch von vergammeltem Kohl hing in der Luft. Dieser Bastard! „Ich habe gehört, wie du fünfzehn gesagt hast.“ Er griff in seine Westentasche. „Aber ich mache dir ein Angebot.“ Er hielt den Vierteldollar hoch. „Du bekommst zehn Cents zusätzlich, wenn du den Jungen in Zukunft in Ruhe lässt. Versprich es, und der Vierteldollar gehört dir.“
Der Hüne zögerte, dann grabschte er mit seiner schwieligen Hand nach der Münze und ließ sie in seiner Tasche verschwinden. „Von mir aus. Ich habe nichts gegen ihn. Seine Mutter, die alte Hexe, ist das Problem.“
„Dann regele die Sache mit ihr, nicht mit dem Kleinen.“ Matthew drehte sich zu dem Jungen um. Er beugte sich zu ihm und hob sein mageres Kinn mit zwei Fingern an. „Alles in Ordnung mit dir?“
Der Knabe wich zurück. Seine hochroten Wangen waren tränennass, doch er nickte und strich sich mit seinen kleinen Händen über den Kopf.
Plötzlich packte der Hüne Matthews Arm und riss ihn zu sich herum. Feixend zupfte er an Matthews weißem Krawattentuch. „Hat richtig Geld gekostet, das Ding, hab ich recht? Ehrlich gesagt wollte ich schon immer so eines haben.“
Matthew riss sich los und sprang zurück. Er kniff die Augen zusammen und zischte den Rotschopf böse an. „Verschwinde.“
Der Hüne senkte sein unrasiertes Kinn und blickte Matthew durchdringend an. Er runzelte seine buschigen rotbraunen Augenbrauen. Als er seine Faust hob, blitzte darin ein Messer auf. Er beugte sich vor und tippte mit der Spitze gegen Matthews Wange. „Ziehst du es aus, oder soll ich es dir abschneiden?“
Matthew war fassungslos. Er war kaum zwanzig Minuten in der Gegend und wurde schon ausgeraubt, nur weil er einem Kind helfen wollte.
Er ballte die Hände zu Fäusten und sagte leise und ruhig: „Steck das Messer weg, dann können wir reden.“
Doch statt einer Antwort traf ihn ein brutaler Fausthieb an der Schläfe. Ungläubig keuchte Matthew auf. Beinahe wäre er zu Boden gegangen.
Der Rothaarige warf das Messer von einer Hand in die andere. „Hier bestimme ich, wo’s langgeht, verstanden? Nimm den Binder ab, sonst sieht der Kleine Sachen, die er besser nicht sehen sollte.“
Es hatte keinen Sinn, ein Risiko einzugehen. Zähneknirschend zog Matthew das Krawattentuch vom Hals und hielt es dem Hünen hin.
Der Mann schnappte es sich und band es sich grinsend um seinen speckigen Hals. Dann erst steckte er das Messer weg. „Das nächste Mal machst du gleich, was ich sage.“
Als ob er so lange warten würde! Kaum war das Messer weg, machte Matthew einen plötzlichen Ausfallschritt und setzte zu einem geraden linken Haken auf den Kopf seines Widersachers an.
Der Hüne wehrte den Schlag mühelos mit seiner riesigen Pranke ab. Matthews Faust prallte wirkungslos dagegen.
Etwas Mörderisches flackerte im Blick des Rothaarigen auf, ehe er seine Fäuste auf Schädel, Kinn, Nase und Augen seines Gegners niederprasseln ließ.
Mit jedem barbarischen Schlag stolperte Matthew einen weiteren Schritt zurück, dann sprang er wieder vor und versuchte einen rechten Haken, ohne indes mehr zu treffen als die Luft, da ihm sein Widersacher geschickt auswich.
Der Junge hopste aufgeregt neben ihnen her, schwang seine kleinen Fäuste und feuerte Matthew an: „Los, gib’s ihm! Mach ihn fertig!“
Ein unerwartet harter Schlag traf Matthew am linken Auge und ließ ihn armerudernd zurücktaumeln. Mit einem Mal sah er alles verschwommen. Gütiger Himmel. Er fing sich an einem Laternenpfahl ab und hielt sich daran fest.
„Das reicht!“, polterte eine tiefe Stimme. Der Junge verstummte.
Die Schläge hörten auf.
Matthew hörte seine eigenen zittrigen Atemzüge. Er versuchte trotz seines rasch zu schwellenden Auges zu erkennen, wer gesprochen hatte. Sein ganzer Schädel schmerzte pochend.
Ein Schrank von einem Mann mit schwarzem, zu einem Zopf gebundenem Haar und in einem geflickten Gehrock hielt seinem Widersacher eine Pistole an die Schläfe. „Gib dem Gentleman sein Krawattentuch zurück, James“, befahl der Unbekannte lässig. Er klang wie ein gebildeter New Yorker europäischer Abstammung. „Und wenn du schon dabei bist, gib ihm auch gleich dein Messer.“
Der Rothaarige erstarrte. Mit seiner dreckigen Hand fischte er das Messer aus der Hosentasche und hielt es Matthew samt dem Krawattentuch hin.
Matthew stieß sich von dem Laternenpfahl ab, zog seinen Cutaway zurecht und versuchte den Blick scharfzustellen. Trotzdem verschwamm sein Arm vor seinen Augen, als er die Hand ausstreckte und das weiße Krawattentuch entgegennahm.
„Das Messer auch“, befahl der Unbekannte.
Matthew legte keinen Wert darauf, doch er wollte keinen weiteren Streit anfangen. Seiner Meinung nach waren hier alle verrückt. Er blinzelte wieder. Er konnte die beiden Männer vor sich zwar erkennen, doch um sie herum lag alles in einem geisterhaften Nebel. Er nahm das Messer.
Der Mann drückte den Lauf der Pistole fester gegen die Schläfe des Rotschopfs. „Wenn du dich je wieder einem der beiden nähern solltest, wirst du dein blaues Wunder erleben, James. Dann fordere ich dich drüben an den Docks. Wir werden mit bloßen Fäusten gegeneinander kämpfen, bis einer von uns tot umfällt. Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst.“
Mit einer erstaunlichen Behändigkeit flitzte der Hüne davon.
Der Fremde wandte sich zu dem Jungen. „Ab nach Hause mit dir, Ronan. Und halt dich um Himmels willen aus Streitigkeiten heraus.“
Der Knabe zögerte, dann sah er Matthew mit glänzenden Augen an. „Ich schulde Ihnen einen Vierteldollar.“ Er grinste schief, drehte sich um und schlurfte in seinen viel zu großen Stiefeln die Straße hinunter.
Matthew atmete zischend aus. Sein Geld würde er wohl nie wiedersehen, aber wenigstens hatte er den Jungen zum Lächeln gebracht.
Der Mann vor ihm senkte die Pistole und nahm den Finger vom Abzugshahn. Er zog seinen Gehrock zurecht und musterte Matthew mit durchdringenden eisblauen Augen. „Wo um alles in der Welt hast du gelernt, dich zu prügeln? In einem Mädchenpensionat?“
Matthew stopfte das Krawattentuch verlegen in die Tasche seines Cutaways. Seine Hand zitterte, als er begriff, dass der dunkle Schatten auf der linken Seite seines Gesichtsfelds nicht weichen wollte. „Da, wo ich herkomme, prügelt man sich nicht.“ Er fühlte den Holzgriff des Messers in seiner Hand. „Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß sie zu schätzen.“
„Darauf würde ich wetten.“ Der Fremde wedelte mit seiner Pistole vor Matthews bestickter Weste herum. „Hübsches Teil. Verkauf’s. Dieser modischer Plunder nützt dir nichts, wenn du ins Gras beißt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann jemand versuchen wird, dir das Ding abzunehmen. Und nun verschwinde.“
Matthew zögerte. Dieser Mann war nicht wie der Rest des versoffenen Gesindels in diesem Viertel. Er streckte die Hand aus. „Ich heiße Matthew Joseph Milton.“
Der Mann schob die Pistole in sein Halfter zurück, das er an einem ledernen Hüftgürtel trug. „Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt.“
Matthew ließ die Hand ausgestreckt. „Ich wollte nur höflich sein.“
„Mit Höflichkeit habe ich nichts am Hut, und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, auch sonst niemand hier.“
Matthew ließ die Hand sinken. „Kann ich mich sonst irgendwie revanchieren?
Der Fremde sah Matthew überrascht an. „Nun, ich könnte was zu essen und einen Whiskey vertragen, bevor ich zum nächsten Kampf antrete.“
„Einverstanden.“ Matthew runzelte die Stirn. „Kampf? Sind Sie Boxer?“
Der Mann zuckte mit den Schultern. „Preiskämpfe mit der bloßen Faust.“ Er klopfte auf das Pistolenhalfter. „Die habe ich nur bei mir, damit ich mich während des Trainings nicht verletze. Verletzt kann ich nicht boxen. Und wenn ich nicht boxe, habe ich nichts zu essen.“
„Aber sind Preiskämpfe mit der bloßen Faust nicht verboten?“
Der Fremde starrte auf ihn nieder. „Lass dir eins gesagt sein, die Mistkerle, die behaupten, meine Kämpfe seien illegal, setzen gewöhnlich das meiste Geld darauf. Ich kenne allein drei Politiker und zwei Marshalls, die mich kaufen wollten. Solange das so ist, können meine Kämpfe nicht gesetzeswidrig sein.“
Einen Berufsboxer zu kennen war sicher nützlich in diesem Teil der Stadt. Überaus nützlich sogar. „Und wie heißen Sie, Sir?“
Der Mann strich sich über sein stoppeliges Kinn. „Ich habe mehrere Namen. Welchen willst du wissen?“
Na prima. Sein neuer Bekannter war anscheinend in alle möglichen illegalen Geschäfte verwickelt. „Am besten einen, der mich nicht gleich ins Gefängnis bringt.“
„Coleman. Edward Coleman. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Edward Coleman, der hier herumläuft und nur darauf zu warten scheint, ein Messer in den Bauch gerammt zu kriegen. Von dem hältst du dich besser fern.“
„Das“, Matthew räusperte sich, „mache ich, Sir. Danke.“
„Du kannst mich duzen.“ Edward Coleman tippte ihm mit dem Finger auf die Brust. „Ansonsten rate ich dir, unsere Regeln hier zu beachten. Das gilt für dich als Gutmensch umso mehr. Trag keine auffällige Kleidung und geh nie ohne eine Waffe aus dem Haus.“
„Ich werde es beherzigen.“ Matthew hielt Coleman das Messer hin. „Außer den Teil mit der Waffe. Ich will nicht“, weiter kam er nicht.
Schneller, als er den Satz beenden konnte, hatte Coleman Matthews Handgelenk gepackt und es so ruckartig hochgerissen, dass die scharfe Klingenspitze Matthews Kinn berührte.
Matthew erstarrte. Er blickte in Colemans eisblaue Augen. Der Geruch von Leder stieg ihm in die Nase.
Coleman feixte und kratzte mit der Klingenspitze spielerisch über Edwards Haut. „Behalt es besser. Könnte sein, dass du es mal brauchst, um Gemüse zu schneiden.“ Er ließ Matthews Handgelenk los. „Ich zeige dir, wie du das Messer benutzt, und ich bringe dir das Boxen und noch ein paar andere Dinge bei, die du hier gut gebrauchen kannst. Und im Gegenzug zahlst du mein Essen.“
Unsicher griff Matthew um das Messer. „Ich weiß, wie man mit einem Messer umgeht. Man zielt einfach und …“, er stockte.
Coleman sprang auf ihn zu. Er verpasste ihm einen harten Schlag gegen das Handgelenk, packte es mit einem Griff wie ein Schraubstock und verdrehte Matthew den Arm. Das Messer fiel klirrend zu Boden. Coleman trat es außer Reichweite und sah ihn an. „Unterricht gegen Essen.“
Essen würde ihm wenig nützen, wenn er tot war. „Einverstanden.“
Matthew saß mit Coleman und seinem Vater am Tisch und löffelte schweigend seinen lauwarmen, talgig schmeckenden Eintopf, als sich die linke Hälfte seines Blickfelds verdunkelte.
Der Löffel glitt aus seinen Fingern und fiel klappernd auf den welligen Fußbodens. Um Himmels willen, was war mit ihm los? Seine Kehle schnürte sich zu. Matthews Herz klopfte vor Angst, er zwinkerte rasch und blickte sich ungläubig um. Sein Augenlicht! Er war blind auf dem linken Auge!
Sein Vater ließ seinen Löffel sinken. „Was ist los?“
Auch Coleman hörte auf zu kauen.
„Ich kann nichts mehr sehen.“ Matthew sprang von seinem Stuhl auf und stolperte rückwärts. Mit einem dumpfen Knall sackte er gegen ein offenes Tellerregal. „Mein linkes Auge. Ich sehe nichts mehr!“ Prüfend blickte er durch die karge kleine Gaststube. Alles, was er sah, war die ungleichmäßig verputzte Wand zu seiner Rechten.
Sein Vater stand auf und trat neben ihn. „Matthew, sieh mich an.“ Er umfasste seine Schultern und zog ihn zu sich herum. „Bist du sicher? Das Auge ist noch sehr geschwollen.“
Matthew berührte vorsichtig das Lid. Seine Hand bebte. Er konnte fühlen, wie seine Finger zitternd an den Wimpern entlang über das offene Auge tasteten, aber er konnte sie, um Gottes willen, nicht sehen! „Links ist alles schwarz. Wieso? Weshalb kann ich nicht …“, er war außerstande weiterzusprechen. Zitternd japste er nach Luft.
Coleman stand langsam auf. „Verdammt. Das kommt von den Schlägen.“
Matthew wandte den Kopf, um Coleman sehen zu können. „Was meinst du damit, es kommt von den Schlägen? Das macht keinen Sinn.“
„Ich kenne Boxer, denen genau dasselbe passiert ist. Einer von ihnen bekam bei einem Kampf so viele Schläge ab, dass er eine Woche später erblindete.“
Matthew keuchte. Sein Kampf lag genau eine Woche zurück.
Coleman griff nach seinem Gehrock. „Ich knöpfe mir den Mistkerl vor.“
„Das ändert nichts!“, stieß Matthew hervor.
„Darum geht es mir nicht.“ Coleman trat vor. „Mir geht es darum, diesem Bastard eine Lektion zu erteilen.“
Raymond Milton führte seinen Sohn halb zur Tür, halb schob er ihn. „Wenn es stimmt, was Sie sagen, brauchen wir einen Arzt, und zwar sofort.“
„Drüben in der Hudson Street ist einer.“ Coleman zwängte sich an ihnen vorbei und riss die Tür zum Gang auf. „Obwohl ich nicht weiß, ob er Ihnen in diesem Fall helfen kann.“
Ihr letztes Geld war aufgebraucht. Und Matthews Sehkraft auf dem linken Auge erloschen. Matthew befühlte die Lederklappe, die ihm der Wundarzt für das blinde Auge verordnet hatte. Genau wie Coleman war der Arzt der Meinung, dass die Schläge die Ursache für die Erblindung waren und dass diese unwiederbringlich sei. Matthew Joseph Milton würde den Rest seiner Tage als bettelarmer Krüppel verbringen.
Zähneknirschend sprang Matthew von der Kiste mit den Zeitungen auf, holte aus und drosch mit der bloßen Faust auf die Wand ein. Er drosch und drosch und drosch, bis der Putz unter den Schlägen bröckelte und den Blick auf die darunterliegenden Holzbalken freigab. Seine Fingerknöchel bluteten.
„Matthew!“ Sein Vater stürzte sich entsetzt auf ihn, riss seinen Arm zurück und zog ihn von der Wand fort.
Matthew bekam kaum Luft, als er seinem Vater in die Augen sah.
Raymond Milton hielt ihm die blutverschmierte Hand mit den Striemen und Hautabschürfungen vor das Gesicht. „Lass niemals zu, dass der Zorn Macht über dein Herz gewinnt, hörst du? Niemals!“
Matthew entriss ihm die schmerzhaft pochende Hand. Er schluckte schwer und versuchte sich zu beruhigen. Dann blickte er Coleman an, der seit der niederschmetternden Diagnose des Arztes noch kein Wort geäußert hatte.
„Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das alles tut“, sagte Coleman schließlich und stieß sich von der Wand ab. „Aber Körperverletzung, Mord, Vergewaltigung und alle anderen scheußlichen Verbrechen gehören in diesem Viertel zur Tagesordnung. Die Gesetzeshüter kommen da nicht hinterher. Deshalb habe ich, obwohl ich Boxer bin, immer eine Pistole dabei. Die Mistkerle hier verstehen keine andere Sprache.“
Matthew schüttelte ungläubig den Kopf. „Wenn die Marshalls nicht damit fertig werden, haben sie einfach nicht genügend Einfluss. Wir müssten mit Männern aus dem Viertel eine Art Schutztruppe zusammenstellen.“
Coleman atmete hörbar aus. „Die meisten Leute hier können ja nicht einmal lesen, ganz zu schweigen von einem Gefühl für Recht und Unrecht. Mit deiner Idee versuchst du den Bock zum Gärtner zu machen. Glaub mir, ich habe bereits versucht, einen Trupp Männer zusammenzukriegen. Aber hier kämpft jeder für sich allein.“
„Dann müssen wir eben bessere Männer finden.“ Matthew drückte seine Finger durch und versuchte seine Angst und den pochenden Schmerz zu verdrängen. „Aber als Erstes sollte ich mir wohl eine Pistole zulegen. Was kostet so ein Ding überhaupt?“
„Matthew.“ Sein Vater legte ihm eine Hand auf den Arm. „Du kannst das Gesetz nicht einfach so in die eigene Hand nehmen. Sonst findest du dich schneller in einer Gefängniszelle wieder, als du denkst, oder schlimmer noch, du wirst umgebracht.“
Matthew drehte sich zu seinem Vater um. „Ich fühle mich bereits gefangen, wenn du mich fragst. Und wenn ich ins Gras beißen soll, dann zu meinen eigenen Bedingungen, Dad, nicht zu den ihren. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier passieren muss, aber ich werde nicht bis ans Ende meiner Tage auf diesen verdammten Zeitungen sitzen und nichts tun.“
Raymond Charles Milton ließ entmutigt die Hand sinken. Mit einem kurzen Nicken ging er um Matthew herum und verließ das Zimmer.
Erst jetzt fiel Matthew auf, wie grob er seinen Vater behandelt hatte. „Es tut mir leid, Dad. Ich meine es nicht so!“
„Es ist schon gut“, rief sein Vater zurück. „Du hast ja recht.“
„Nein, du“, Matthew wischte sich über die Stirn und verstummte, als seine Finger die Augenklappe berührten. Gütiger Himmel. Sein Leben war ein einziges Chaos.
„Eine gute Pistole kostet zehn bis fünfzehn Dollar.“
Matthew zuckte zusammen. „Das kann ich mir nicht leisten.“
„Ich habe meine nicht gekauft.“
Matthew drehte den Kopf, damit er Coleman ansehen konnte. „Wo hattest du sie dann her?“
Coleman hob eine seiner dunklen Brauen. „Bist du wirklich so naiv?“
Matthew starrte ihn an. „Du meinst, du hast sie gestohlen?“
Coleman trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Stehlen ist es nur dann, wenn man nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Weißt du, wie viele Leben ich mit dieser Pistole schon gerettet habe? So viele, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Und ich glaube nicht, dass Gott vorhat, mich in nächster Zeit dafür zu bestrafen. Wenn du also eine Pistole willst, besorge ich dir eine. Eine gute.“
Matthew sah Coleman nachdenklich an. So verrückt es auch klang, aber Matthew hatte das Gefühl, dass sich durch Colemans Angebot alles ändern würde, und das nicht nur in seinem, sondern auch im Leben vieler anderer Menschen.
1. KAPITEL
Die Stadtverordnetenversammlung meldet 118 Todesfälle in der zu Ende gehenden Woche, davon 31 Männer, 24 Frauen und 63 Kinder.
– Der Truth Teller, eine New Yorker Wochenzeitung für Herren
New York City, Squeeze Gut Alley, eines Abends, acht Jahre später
Von dem unbefestigten Weg, der in die spärlich von Gaslaternen erhellte Straße einmündete, war das Klappern von Pferdehufen zu hören. Matthew hob die Hand und gab seinen Männern das verabredete Zeichen. Die fünf, die er aus seiner vierzig Mann zählenden Bande ausgewählt hatte, hielten sich in den schmalen dunklen Hauseingängen auf der gegenüberliegenden Seite versteckt.
Die Straße im Blick, zog Matthew seine beiden Pistolen aus den Halftern. Entschlossen trat an Colemans Seite. „Wo zum Teufel bleibt Royce?“, flüsterte er ärgerlich.
„Du weißt doch, dass der Mistkerl kommt und geht, wann er will.“
„Ja, und wir führen diesem Schwachkopf von einem Marshall wieder einmal vor, wie er seinen Job zu machen hat.“
„Langsam, Matthew. Bis jetzt haben wir nichts in der Hand. Wir stehen vor einem Freudenhaus, das nicht mehr in Betrieb zu sein scheint. Du weißt, wie unzuverlässig die meisten unserer Informanten sind.“
„Danke, dass du mich wieder daran erinnerst.“
Sie schwiegen.
Ein Fuhrwerk näherte sich. Matthew konnte die Umrisse deutlich sehen. Es war ein schäbiger, mit zwei Fässern beladener Holzkarren, der von einem mageren Klepper gezogen wurde. Am Randstein kam er zum Stehen. Der derbknochige Kerl, der ihn kutschierte, sprang vom Bock und rückte den Leinensack mit den grob ausgeschnittenen Augenlöchern zurecht, den er sich über den Kopf gestülpt hatte. Vorsichtig um sich blickend zog er ein Fleischermesser aus seinem Gürtel und eilte zum Heck des Karrens.
Es war an der Zeit, für Gerechtigkeit in Five Points zu sorgen. Denn wenn das, was er hier gerade beobachtete, nicht schändlich war, wusste Matthew nicht, was noch verachtenswert sein sollte. Beide Pistolen auf den Kopf des Mannes gerichtet, trat er in den Lichtkegel der nächsten Gaslaterne. „Du da. Lass das Messer fallen. Wird’s bald.“
Der Maskierte erstarrte, als er sah, wie sieben bewaffnete Männer aus der Dunkelheit heraus auf die Straße traten und ihn mit gezückten Pistolen umringten.
Er warf das Messer aufs Pflaster und hob die Hände. „Ich liefere nur Hafer aus. Willst du mich etwa dafür erschießen?“ Seine abgehackte, schroffe Stimme klang verdächtig nach einem Briten.
Cassidy ging um den Karren herum. Seine riesige Gestalt verschwand kurz in der Dunkelheit, bevor sie wieder im Lichtkegel der Laterne auftauchte. „Von wegen Hafer. Ihr britischen Drecksäcke meint wohl, ihr stündet über dem Gesetz. So wie der Bastard, der mir das Gesicht aufgeschlitzt hat.“ Er zerrte dem Mann die Maske vom Kopf und feuerte sie zu Boden. Der Brite trug eine Halbglatze und sah Matthew und seine Männer wachsam an. Cassidy spannte den Abzugshahn. „Wenn’s nach mir geht, legen wir den Kerl gleich um.“
Matthew bemühte sich, seinen Zorn zu bezwingen. Das kam dabei heraus, wenn der Gerechtigkeitssinn mit einem Iren durchging. Cassidy kämpfte gegen alle und jeden, vor allem, wenn ein Brite darunter war. Doch weil er sich ihrer Sache mit Leib und Seele verschrieben hatte und bis aufs Messer dafür zu kämpfen bereit war, sah Matthew bisher davon ab, ihm einen Tritt zu verpassen.
Er trat neben den Iren. „Bleib ruhig. Das hier hat nichts mit England und deinem Gesicht zu tun“, sagte er warnend. „Wir können Leichen genauso wenig gebrauchen wie Gesetzeshüter, die hinter uns her sind.“
Cassidy atmete zischend aus, sagte jedoch nichts.
„Sieh nach, was in den Fässern ist“, rief Matthew Coleman zu.
Coleman steckte seine Pistolen in die Holster, ging eilig zum Karren und sprang mit einem schwungvollen Satz auf die Ladefläche. Er schraubte die Deckel der Fässer auf und sah hinein. Als er wieder aufblickte, wirkte sein Gesicht versteinert. „Sie sind drin. Alle beide.“
Matthew atmete auf.
Coleman griff mit beiden Händen erst in das eine, dann in das andere Fass und hob aus jedem je ein Mädchen von bestenfalls acht Jahren heraus. Die Kinder waren gefesselt, geknebelt und barfuß. Er durchschnitt die dicken Stricke um ihre Hände und Füße.
Die Mädchen schluchzen ängstlich und klammerten sich aneinander. Sie trugen sackartige, grob zusammengenähte Wollkleider, die sie höchstwahrscheinlich erst nach ihrer Entführung aus dem Waisenhaus bekommen hatten.
Matthews Kehle schnürte sich zusammen. Hätten er und seine Männer nicht eingegriffen, wären die beiden Mädchen, die vor nicht einmal einer Woche aus einem Waisenhaus verschwunden waren, an ein Bordell verkauft worden. Er stieß seine Pistolen in die Halfter und deutete mit dem Kinn auf den Briten. „Fesselt ihn, bevor ich es tue.“
In diesem Moment stieß der Kerl Plunkett und Kerner zur Seite und rannte die spärlich beleuchtete Straße hinunter.
Verdammt! Matthews Muskeln reagierten prompt, als er die Verfolgung aufnahm und sein verbliebenes Augenlicht auf die eingeschränkten Sichtverhältnisse einzustellen versuchte.
„Ich hab’s ja gesagt, wir hätten ihn umlegen sollen!“, brüllte Cassidy hinter ihm. „Wozu sollen die Knarren gut sein, wenn wir sie nicht benutzen?“
„Bewegt euch! Los!“, schrie Matthew über die Schulter. „Schwärmt aus! Coleman, bleib bei den Kindern!“ Er konzentrierte sich auf die dunkle Gestalt, die mit wehendem Mantel vor ihm durch die Pfützen lief, dass das Wasser nur so aufspritzte. Matthew beschleunigte sein Tempo. Im fahlen Licht bemerkte er, dass der Brite zunehmend häufig über die Schulter blickte und dass er langsamer wurde. Matthew hörte, wie schnaufte.
Der Kerl war das Laufen offenbar nicht gewohnt.
Er pflegte zu fahren.
Matthew hingegen verdiente sich sein Geld mit Laufen. Und weil er darin geübt war, würde er die Flucht dieses Bastards vereiteln. Er wurde noch ein bisschen schneller und verringerte so den Abstand zwischen ihnen, bis er den Kerl in einem engen Durchlass zwischen zwei Häusern beim Mantelkragen zu fassen bekam. Er riss ihn herum.
Sein klobiger Gegner verlor das Gleichgewicht und stürzte in den Matsch. Matthew warf sich auf ihn. Er musste seine ganze Kraft einsetzen, um sich rittlings auf dem Verbrecher halten zu können und dessen Schläge abzuwehren.
Schließlich hielt er den Mädchenhändler mit einem ausgestreckten Arm am Kragen gepackt und ließ die Faust so brutal gegen dessen kahl werdenden Schädel niedersausen, dass der Kerl mit dem Hinterkopf auf den matschigen Boden sackte. „Gib auf, du Hurensohn, sonst …“, Bryson überschrie Matthews Worte.
„Wir haben ihn!“ Bryson kniete sich nieder und drückte dem Briten das Knie auf die Kehle.
Keuchend rappelte sich Matthew auf. Matsch klebte an seinen Ärmeln und Hosenbeinen.
Wie aus dem Nichts kam Cassidy plötzlich schlitternd und Schlamm aufspritzend vor ihnen zum Stehen. Er stieß Bryson aus dem Weg. „Ich zeig dem Halunken, was wir mit so einem drüben in Irland machen.“
Mühelos zerrte er den Briten auf die Füße, schlang ihm seinen massigen Arm um den Hals und drückte so fest zu, dass der Mann röchelte und seine Beine unter ihm nachgaben. Bryson kam mit einem Strick zu ihnen.
Kaum dass der Mann gefesselt war, stürzte sich Kerner knurrend auf ihn und versetzte ihm einen Fausthieb in die Magengrube. „Der ist für jedes Mädchen, das du je angerührt hast, du Bastard!“ Er holte aus und schlug abermals zu, dass der Brite ins Straucheln geriet. „Wenn du denkst, du …“, Kerner landete einen krachenden Haken mitten im Gesicht des Halunken.
„Kerner!“, brüllte Matthew warnend.
Stolpernd tat Kerner ein paar Schritte rückwärts und drehte sich fort. Er keuchte vor Erregung.
Auch Matthew hatte alle Mühe, seinen rasenden Herzschlag zu beruhigen. Dafür, dass Kerner vor sechs Jahren in genau dieser Straße seine damals zwölfjährige Tochter brutal vergewaltigt und ermordet aufgefunden hatte, reagierte er erstaunlich beherrscht.
Genau dieses tief verwurzelte Bedürfnis, erlittenes Unrecht wiedergutzumachen, hatte Matthew und seine Männer zusammengebracht. Ihr Kummer war auch seiner, und sie alle kämpften mit ihrem Zorn. „Ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist, Kerner. Atme besser tief durch.“
„Tut mir leid.“ Kerner wischte sich mit zitternder Hand über das bärtige Gesicht. „Es ist wirklich nicht einfach.“ Als erwache er aus einer Trance, fuhr er fort: „Kümmere dich besser um die Mädchen. Coleman erschrickt sie wahrscheinlich zu Tode.“
„Lass gut sein. Er ist lange nicht so grob, wie er vorgibt.“ Matthew schüttelte den Dreck von seinen Händen und machte sich auf den Rückweg. „Wir haben ihn“, rief er Coleman zu, als er den Karren erreichte.
Coleman seufzte erleichtert. „Gut.“
Matthew stützte sich mit den Händen auf die Ladefläche. Die Mädchen weinten nicht mehr, doch sie saßen noch immer eng umschlungen an eines der Fässer gelehnt.
Coleman deutete mit dem Kinn auf die beiden. „Übernimm du. Mich scheinen sie nicht zu mögen. Und meine Geschichten auch nicht.“
Hoffentlich hatte Coleman ihnen keine Geschichten erzählt, die Kinder in diesem Alter nicht hören sollten. Matthew wischte sich seine dreckigen Hände an seinem Leinenhemd ab und streckte sie dann den Kindern entgegen. „Wir wollen euch helfen. Ich heiße Matthew, und der Gentleman dort drüben ist Edward. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein und den Dreck und die schreckliche Augenklappe hier nicht beachten. Schafft ihr das? Vertraut ihr mir? Nur dieses eine Mal?“
Die Mädchen rückten noch enger zusammen und sahen ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
Matthew ließ die Hände sinken und lächelte, wie er hoffte, gewinnend. „Sagt mir, was ich tun soll, und ich tue es. Soll ich einen Affen nachmachen? Einäugige Affen sind meine Spezialität, müsst ihr wissen. Da könnt ihr fragen, wen ihr wollt.“ Er begann sich mit allen fünf Fingern den Kopf zu kratzen und dabei leise „Uuh-uuh, iih-iih, aah-aah“ zu machen.
Coleman beugte sich zu den Mädchen. „Ich bin besser als er, passt auf.“ Er wirbelte mit seinen langen kräftigen Armen in der Luft und machte Anstalten, sich auf die Ladefläche zu schwingen.
Die Mädchen zuckten erschrocken vor ihm zurück und rutschten näher zu Matthew, so als hätten sie stillschweigend beschlossen, ihm eher zu trauen.
Matthew verbiss sich ein Lächeln. Der gute alte Coleman. Man konnte sich darauf verlassen, dass seine ungehobelte Art selbst unerschrockene Naturen so weit einzuschüchtern vermochte, dass sie zu allem Ja und Amen sagten. Matthew streckte beide Hände aus. „Habt keine Angst. Er macht nur Spaß. Und nun kommt, gebt mir eine Hand.“
Zögernd ergriffen die Mädchen Matthews Hände, ohne einander loszulassen. Matthew versuchte, den Kindern ein Gefühl von Wärme und Sicherheit zu geben, und drückte die kleinen kalten Finger sacht. Dann beugte er sich vor und sah die Mädchen ernst an. „Danke, dass ihr so mutig wart. Ich weiß, es war nicht einfach für euch. Aber was meint ihr, wollt ihr zurück zu Schwester Catherine? Sie macht sich große Sorgen um euch.“
Zu seinem großen Erstaunen warfen ihm die Mädchen die Arme um den Hals. Sie legten ihre Köpfe an seine Schultern und begannen zu weinen.
Matthew drückte die Kinder an sich. Er war ein wenig überrascht, wie mager sie waren. Er schob seinen Pistolengurt ein Stück tiefer, dann hob er sich beide Kinder auf die Hüften.
Auf einmal war in der Ferne Hufgetrappel zu hören. Die Mädchen klammerten sich erschrocken an ihn, als er sich in die Richtung drehte.
Der stetige Rhythmus der Hufe brachte den Boden unter seinen Füßen zum Vibrieren, dann kam die Silhouette eines Reiters in Sicht. Der Mann war uniformiert, mit einem Säbel bewaffnet und lenkte sein Pferd genau auf sie zu.
Es war Marshall Royce. Dieser Faulpelz tauchte immer erst auf, wenn alles vorbei war.
Matthew sah die Kinder an. „Der Mann, der da kommt, hätte uns eigentlich bei eurer Befreiung helfen sollen. Nur leider erlaubte ihm wohl die Frau Bürgermeisterin, die zufällig seine Mama ist, nicht, das Haus zu verlassen. Weder sie, noch ihr Mann, noch ihr Sohn tun etwas für die Stadt. Seht zu, dass ihr das nicht vergesst, wenn die Frauen eines Tages das Wahlrecht haben.“
Das Pferd wieherte, als es neben ihnen zum Stehen kam. „Ich habe alles gehört“, rief Marshall Royce aufgebracht zu Matthew herunter. „Dann erzählen Sie den Kindern aber auch, wie oft ich wegsehe, wenn Sie mal wieder etwas Ungesetzliches anstellen!“
Matthew sah zu ihm hoch. Royce’ markantes Gesicht lag im Schatten. „Warum bieten Sie mir nicht Ihr Pferd an, damit ich die beiden zurückbringen kann?“
Der Marshall wedelte mit seiner behandschuhten Hand. „Ich habe nicht nur eine lange Nacht hinter mir, sondern beinahe auch die Kehle aufgeschlitzt bekommen. Warum, zum Teufel, glauben Sie, habe ich mich verspätet? Reichen Sie mir die Kinder herauf, ich bringe sie selbst zurück.“
Die Arme der Mädchen schlossen sich fester um seinen Nacken. Sie schluchzten erstickt.
Er trat zurück und rückte die Kinder zurecht. „Ich weiß nicht, ob es Ihnen überhaupt bewusst ist, aber bei dem, was die beiden hier durchgemacht haben, sollten sie besser nichts von Ihren Abenteuern hören. Sprechen Sie leiser und steigen Sie ab. Ich bringe sie zurück, ist das klar?“
Royce zögerte, dann schwang er sich vom Pferd. Er griff in seine Rocktasche und fischte eine Fünfdollarnote heraus. „Hier. Für Ihre Auslagen“, sagte er schroff. „Ich weiß, dass Sie wieder eine Ladung Pistolen gestohlen haben. Wenn Sie das noch einmal während meiner Dienstzeit machen, sorge ich dafür, dass Sie und Ihre vierzig Räuber in Sing Sing landen. Und eins können Sie mir glauben, mit singen hat man in dieser Strafanstalt wenig am Hut.“
Der Kerl konnte froh sein, dass Matthew die beiden Mädchen festhalten musste. „Ich brauche Ihr Geld nicht. Spenden Sie es dem Waisenhaus. Dort werden dringend Schlösser für die Türen gebraucht.“
„Sie wollen kein Geld von mir nehmen, obwohl Sie keinerlei Skrupel haben, zu stehlen.“ Royce schüttelte den Kopf und steckte den Geldschein ein. „Ihr Stolz wird Sie eines Tages noch an den Galgen bringen.“
„Ganz sicher. Aber noch ist es nicht so weit.“
2. KAPITEL
Glauben Sie nicht alles, was Sie hören.
– Der Truth Teller, eine New Yorker Wochenzeitung für Herren
Manhattan Square, 22. Juli 1830, spätabends
Holen Sie sie her!“
Die Stimme eines verärgerten Mannes drang durch den Holzfußboden ihres Musiksalons an ihre Ohren. „Holen Sie sie, bevor ich es tue!“
Bernadette Marie seufzte entnervt und schlug mit flachen Händen auf die Elfenbeintasten ihres Klaviers. Für diese ungehobelten amerikanischen Kerle würde sie noch einige neue Regeln aufstellen müssen. Was fiel ihnen ein, sie mitten in der Nacht zu stören!
Sie erhob sich von dem Schemel vor ihrem Clementi-Piano, raffte die weiten Röcke und verließ das von Kerzen hell erleuchtete Musikzimmer. Sie bog um eine Ecke des Korridors, ging an den goldgerahmten Gemälden sowie zahlreichen Marmorskulpturen vorbei und eilte die Stufen der zweiflügeligen Treppe hinunter ins Foyer.
Auf halbem Wege blieb sie stehen.
Aus der spärlich erleuchteten Eingangshalle sah der alte Mr Astor mit wachem Blick zu ihr hinauf. „Ah!“ Er zog seinen Abendfrack zurecht und schob den lebhaft protestierenden Butler beiseite. „Da ist sie ja.“
Mr Astor war der Letzte, mit dem Bernadette zu dieser späten Stunde gerechnet hätte, doch der liebenswerte, schrullige alte Gentleman besaß seit langem ihr Vertrauen. Als einer der wenigen hatte er sie in den oberen New Yorker Kreisen, in denen man Engländerinnen wie ihr nur sehr reserviert begegnete, willkommen geheißen. In gewisser Weise war Mr Astor ein väterlicher Freund, den sie so nie gehabt hatte.
„Mr Astor.“ Rasch eilte sie die restlichen Stufen hinunter. Am Fuße der Treppe blieb sie lächelnd stehen. „Was für eine angenehme Überraschung. Sie können gehen, Emerson.“
Ihr Butler, den sie sehr zu seinem eigenen Verdruss aus London mit hierher gebracht hatte, zögerte, als wolle er darauf hinweisen, dass es sich nicht gehörte, eine Dame zu so später Stunde aufzusuchen.
Mr Astor drückte ihm seinen Hut in die Hand. „Nun gehen Sie schon. Ich werde ihr schon nicht unter die Röcke greifen.“
Bernadette zuckte zusammen. Sie konnte sich einfach nicht an die rohe Art selbst der vermögenden New Yorker gewöhnen. Erst vor zwei Wochen hatte sie bei einem Dinner gesehen, wie ein Mann seine fettigen Hände am Abendkleid seiner Tischdame abwischte. Er fand sein Verhalten offenbar witzig, was es auf gewisse Weise ja auch war. Leider war die betroffene Dame anderer Meinung, und selbst sein Angebot, ihr vier neue Kleider zur Wiedergutmachung zu schenken, beruhigte sie nicht.
Bernadette wollte sich beileibe nicht über ihre New Yorker Bekannten beschwerte. Sie waren so erfrischend atemberaubend und herrlich unberechenbar, so wie die ganze Stadt, und das genaue Gegenteil von ihrem früheren langweiligen, bis in die Einzelheiten durchorchestrierten Leben. Sie wandte sich an den Butler. „Gehen Sie ruhig, Emerson. Sie wissen doch, dass mich Mr Astor jederzeit aufsuchen darf.“
Mit erhabener Hochnäsigkeit trug Emerson den Hut aus der Halle.
Bernadette seufzte unhörbar.
Mr Astor drehte sich zu ihr um und strich sein widerspenstiges weißes Haar mit der behandschuhten Hand glatt. Seine Augen funkelten durchtrieben, als er sie ansah. „Ich bin gekommen, um eine Schuld einzutreiben, Lady Burton.“
Bernadette erstarrte, als sie den Namen hörte. Er war nur wenigen New Yorker Freunden bekannt, allgemeinhin nannte man sie hier nur Mrs Shelton. Wollte sie der alte Mann verstören? „Gibt es einen besonderen Grund, mich mit diesem Namen anzureden?“
Mr Astor faltete die Hände vor seiner bestickten silbergrauen Seidenweste. „Wie Sie wissen, bin ich in erster Linie ein Geschäftsmann, meine Liebe. Nur so gelang es mir als Sohn eines deutschen Fleischers, in den Pelzhandel einzusteigen, jedes Fell zwischen Kanada und New Orleans aufzukaufen und zu einem der reichsten Männer der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Wenn sich also eine lohnende Gelegenheit bietet, vergesse ich meine guten Manieren und stürze mich ins Abenteuer. Anders gesagt, ich schlage vor, Sie tun mir den Gefallen, um den ich Sie bitte, Hoheit.“
Bernadette verdrehte die Augen. Mr Astor musste wissen, dass sie nicht einwilligen würde. Ihre Standpunkte waren seit jeher konträr, trotz der Freundschaft, die sie verband. „Ich bin kein Mitglied der königlichen Familie. Tun Sie also nicht so, als ob ich eines wäre.“
„Aber Sie sind mit der Königin verwandt.“
„Mein Mann war es, ich nicht.“
„Wollen Sie mir etwa sagen, ich kann Ihnen nicht trauen? Was für eine Freundin sind Sie? Ist das so Usus bei euch Europäern?“
Verflixt. Sie hatte es kommen sehen. Wäre sie doch bloß, wie ursprünglich geplant, in New Orleans geblieben, wo sie die Geschichte der Piraterie und der Piraten erforschen wollte. Doch dann war sie so dumm gewesen, den berühmten Straßenkarneval hautnah mit den Einheimischen zu feiern. Als Dank raubte man sie bis auf die Unterröcke aus.
Und wären Mr Astor und sein Enkel nicht gewesen, die ihr, obwohl vollkommen unbekannt, zu Hilfe geeilt waren, hätte sie womöglich weit mehr verloren als nur ihr Retikül und ihr Kleid. Nach diesem Vorfall waren die Männer ihre Freunde geworden und der ältere Mr Astor überredete Bernadette, New Orleans zu verlassen und ihn und seinen Enkel nach New York zu begleiten. Sie nahm einen anderen Namen an, auch um die Zeitungsreporter abzulenken, die ihr seit dem als „Unterrock-Affäre“ bekannt gewordenen Überfall an den Fersen klebten.
Es tat gut, als einfache Mrs Shelton in New York City zu leben. Hier konnte sie attraktive Gentlemen empfangen, wann immer es ihr passte, und niemand sah sie aufgrund des Zwischenfalls schief an. Der peinliche Überfall hatte sämtliche Zeitungen zwischen New Orleans und Nantucket beschäftigt und war gewiss inzwischen selbst in London bekannt. Also wusste inzwischen auch ihr Vater davon. Oh Gott.
Sie atmete tief ein. „Ich bin Ihnen und Ihrem Enkel ewig zu Dank verpflichtet, Mr Astor. Das wissen Sie.“
„Dann tun Sie mir einen Gefallen. Mein Enkel wird am Ende der Nutznießer sein, wenn wir erst Teil der britischen Aristokratie sind und diesen zimperlichen, Tee schlürfenden Bastarden klargemacht haben, dass allein Geld Macht hat, und nicht irgendein alter, blutbeschmierter Name.“
Bernadette lupfte eine Braue. „Sie wollen Teil der britischen Adelskreise werden? Wie kann ich Ihnen da weiterhelfen?“
Mr Astor beugte sich ein Stück vor. In seinem Gesicht spiegelte sich der aufgesetzte Ernst wider, mit dem er sonst nur Geschäftspartner bedachte. „Uns ein paar Türen öffnen, indem Sie die erste Ehe zwischen einem amerikanischen Gossenmädchen und einem britischen Aristokraten einzufädeln helfen. Das ist Ihre Gelegenheit, meine Liebe. Ich will, dass Sie das Mädchen unterweisen. Sie heißt Georgia Emily Milton, aber wir werden den Namen ändern müssen, weil er zu schlicht und ein bisschen zu irisch klingt. Er verträgt ein bisschen mehr Glamour. Es gibt da nämlich diesen feinen Pinkel, müssen Sie wissen, der das Mädchen heiraten will, ein gewisser Lord Yardley, der nächste Duke of Wentworth. Er wartet bereits sehnsüchtig auf sie. Sie werden die Kleine auf die britische Gesellschaft vorbereiten. Sie werden ihr alles beibringen, was sie über den ton wissen und wie sie sich in ihm verhalten muss, und sie im kommenden Jahr zur Saison nach London begleiten. Der Duke und ich stellen sicher, dass Sie rund um die Uhr bewacht werden. Solange Sie sich in der Stadt aufhalten, werden Sie von niemandem belästigt, kein Mann wird auch nur in Ihre Nähe kommen, es sei denn, Sie wünschen es.“
Bernadette konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Wenn das keine Ironie des Schicksals war! „Obwohl ich die Angelegenheit höchst amüsant finde und ich auch keinerlei Einwände habe, das Mädchen zu unterweisen, wenn Sie das wirklich wünschen, so werde ich die junge Dame doch ganz bestimmt nicht nach London begleiten. Meine Anwesenheit dort würde einen noch größeren Aufruhr verursachen als damals bei meiner Flucht. Ich muss gestehen, dass ich mein ruhiges New Yorker Leben über alle Maßen schätze. Keiner der Gentlemen hier weiß, wer ich wirklich bin, und ich kann mich benehmen, wie ich will, ohne übles Gerede zu provozieren. In London hingegen begannen die Damen bereits zu tuscheln, sobald ich nur zu atmen wagte.“
Mr Astor sah sie schweigend an. „Sie schulden es mir“, sagte er schließlich.
„Ich schulde Ihnen keinen gesellschaftlichen Selbstmord. Und darauf liefe es hinaus, wenn ich den Ozean überquere.“