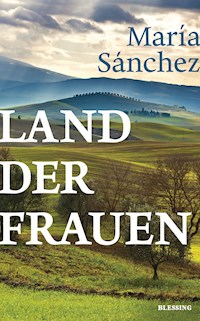
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
María Sánchez ist Landtierärztin - ein körperlich sehr herausfordernder Beruf, der in ihrer Familie bisher nur von Männern ausgeübt worden ist. Als ihre Großmutter an Demenz erkrankt, stellt die junge Frau fest, dass sie von deren Leben und Alltag nichts weiß, anders als von dem ihrer Großväter, die für sie immer Vorbilder gewesen waren. Sánchez beginnt, ausgehend von ihrer eigenen Familie, die Geschichte der Frauen auf dem Land zu erforschen und zu erzählen - und so denen eine Stimme zu geben, die bisher keine hatten.
Poetisch und liebevoll beschreibt María Sánchez die bäuerliche Welt aus Sicht der Frauen, entdeckt, dass sich weibliche Lebenskonzepte und Interessen auf dem Land sich anders definieren als in der Stadt und schlägt eine Brücke zwischen diesen beiden Welten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch:
»Denn das ist die Geschichte unseres Landes und die von so vielen: Frauen, die im Schatten blieben. Treue, geduldige, gute Mütter. Hexen, Lehrmeiste-rinnen, Schwestern, die uns ernährten und schützten. Aber wer erzählt ihre Geschichten? Warum ist es normal geworden, sie aus unseren Erzählungen zu verdrängen? Wer hat sich ihrer Räume, ihrer Stimme bemächtigt?«
María Sánchez ist Landtierärztin, ein körperlich herausfordernder Beruf, der in ihrer Familie bisher nur von Männern ausgeübt wurde. Als ihre Großmutter an Demenz erkrankt, stellt die junge Frau fest, dass sie von deren Leben nichts weiß – anders als vom Leben ihrer Großväter, die für sie immer Vorbilder gewesen waren. Ausgehend von ihrer Familie beginnt sie, die Geschichte der Frauen auf dem Land zu erzählen und damit jenen eine Stimme zu geben, die bisher keine hatten.
Mit so poetischem wie liebevollem Blick beschreibt María Sánchez die ländliche Welt aus der Perspektive der Frauen und zeigt, wie sehr eine Gemeinschaft von der Natur geprägt ist, in der sie lebt. In ihrem meisterhaften Essay verbindet Sánchez die wichtigsten Themen unserer Zeit: Feminismus, Ökologie und die Entwicklung des ländlichen Raums in einer globalisierten Welt.
Die Autorin:
María Sánchez, 1989 in Córdoba geboren, ist Landtierärztin und Schriftstellerin. Sie hat eine eigene Radiosendung und schreibt regelmäßig für spanische Onlinemedien Texte zu Feminismus, Literatur und dem Leben auf dem Land. Ihr Buch Land der Frauen stand in Spanien monatelang auf den Bestsellerlisten und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. María Sánchez lebt in Madrid und Galizien.
Das Buch erscheint unter dem Titel TIERRADEMUJERES
Una mirada íntima y familiar al mundo rural bei Seix Barral, Editorial Planeta, Barcelona
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Abbildungen auf S. [>>], [>>], [>>], [>>]: Fernando Vílchez
Copyright © der Abbildungen [>>], [>>], [>>], [>>], [>>], [>>], [>>], [>>]: Archiv María Sánchez
Copyright © der Abbildung auf S. 183: Joaquim Gomis, Odette Gomis a Megève, França, 1939, dispositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya © Hereus de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró, Barcelona 2021.
Copyright © 2019 by María Sánchez
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,
unter Verwendung eines Motivs von Jaroslaw Pawlak / Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
Herstellung: Ursula Maenner
ISBN 978-3-641-26041-5V001
www.blessing-verlag.de
Für meine Familie
und all jene,
die den Boden bestellen und bewahren
und dafür nie eine Anerkennung erfahren haben.
Für sie schreibe ich.
EINE UNSICHTBARE GESCHICHTE
Könnte es nicht sein, dass geerbte Gegenstände
die Umrisse unvollständiger Vertraulichkeiten sind?
Maria Gabriela Llansol
In den Häusern unserer Großeltern hängen überall Porträtaufnahmen. Sie beobachten uns auf Schritt und Tritt, und man hat den Eindruck, sie würden jeden Moment anfangen zu sprechen. Manchmal denke ich, sie sind viel zu schweigsam. Dann wieder lese ich einen leichten Vorwurf aus ihrem Blick. Ich bleibe gerne davor stehen und stelle mir vor, wie und warum diese Aufnahmen entstanden sind, wer die Kulisse, den Rahmen und den passenden Ort ausgewählt hat, sodass sie für immer wie eingefroren von ihrem Platz an der Wand auf uns herabblicken. Ein geradezu zeremonieller Akt, den wir nachfolgenden Generationen nicht mehr kennen. Heutzutage können wir jederzeit und überall Fotos von uns machen, doch haben sie nicht mehr den gleichen Wert und dieselbe rituelle Aura wie für unsere Ahnen. Sorgfältig arrangierte, mit Bedacht und Hingabe aufgenommene Porträts gibt es heute nicht mehr. Genauso wenig wie die berühmten Widmungen auf der Rückseite; da ist kein Platz mehr für die Vergänglichkeit, für den Gelbstich an den Händen, in den Gesichtern, den Ecken, der Landschaft. Wir, die Kinder des Fortschritts, bewahren unsere Fotos nicht länger in Alben oder alten Keksdosen auf, die einmal als Nähkästchen gedient haben und ihre Tage als Sammellager für Gesichter und Erinnerungen beschließen. Ein altes, gerahmtes Foto war früher wie ein Bruder, der am Leben der anderen teilhatte, der Blick blieb im Vorübergehen unwillkürlich daran haften, und manchmal verspürte man den Wunsch, es zurechtzurücken, es abzustauben, es zu berühren oder anzusprechen.
Unser Blick und alles, was damit zusammenhängt, hat sich ebenfalls von Grund auf gewandelt. Es genügt nicht mehr, auf die Wand zu schauen, um sich zu erinnern, denn ein neues Element hat sich zwischen das Papier und unseren Körper geschoben: die modernde Technik. Wir durchstöbern Apps, Medien, Tools, Computersysteme, um uns zu erinnern, wir brauchen dieses neue Medium, um unseren Vorfahren, die das alles nicht kannten, näherzukommen. Denkt man darüber nach, wird einem plötzlich die schmerzhafte Wahrheit bewusst. Von den Porträtierten auf den Fotos in den Häusern unserer Großeltern lebt niemand mehr. Geblieben sind nichts als leere Bilderrahmen.
Erst beim Tod von José Antonio, meinem Großvater väterlicherseits, dem Tierarzt, habe ich angefangen, vor den Fotos innezuhalten, die die Häuser der beiden Familien beherbergten. Da begannen die Fragen, die Angst, das Unbehagen. Wie konnte ich Tag für Tag einfach weitermachen, ohne das Leben meiner Vorfahren zu kennen? Das ist seltsam, denn es war nicht der erste Großvater, der starb. José, mein Großvater mütterlicherseits, war bereits gestorben, als ich sieben Jahre alt war. Nachdem er ein Leben lang geschuftet hatte, nahm ihm der Krebs plötzlich den Atem, wie bei einem frisch geborenen Welpen, der noch nicht schwimmen kann und in der Zisterne ertrinkt, klaglos, ohne aufzubegehren, ohne es zu begreifen. Ich war noch zu klein und habe es auch nicht begriffen. Die einzige Erinnerung, die ich an ihn habe, sind seine blutverschmierten Hände, wenn er im Patio seines Hauses die Hasen abhäutete. Das offene Hemd, das den Blick auf das weiße Unterhemd freigab, die mit einer Kordel zusammengehaltene Hose, die kräftigen, runzligen braunen Hände, überzogen von den roten Innereien des Tieres. Ich erinnere mich daran, wie die Hitze auf der Haut klebte und die Fliegen uns umschwirrten, aber vor allem an diesen süßlichen Geruch nach dem Übergang vom Leben zum Tod, der über allem schwebte, über dem Trockenplatz, den Blumenkästen und der Stufe, und sich dort ebenso festsetzte wie in meiner Erinnerung.
Damals war sein Tod für mich lediglich eine Formalität. Vielleicht weil ich nicht viel Zeit mit ihm verbracht hatte. Er war immer irgendwie im Hintergrund geblieben. Jetzt frage ich mich, was geschehen wäre, wenn der Tod sie beide in umgekehrter Reihenfolge geholt, wenn er wie ein einsamer Spieler die Ereignisse vertauscht und andere Lebenswege für die Zurückgebliebenen vorgegeben hätte. Heute empfinde ich eine Mischung aus Wut und Reue, nicht mehr Zeit mit ihm verbracht zu haben. Es ist wie ein unbewusster Impuls. Manchmal kommt es mir vor wie eine Fiktion.
Viele Jahre später schreckte ich schweißgebadet aus dem Schlaf hoch, das Herz schlug mir bis zum Hals. Es war brütend heiß. Ich erinnerte mich erst Stunden später wieder an den Traum. Auf der Heimfahrt von der Arbeit, während ich auf das endlose Band der Fahrbahn vor mir starrte und an nichts dachte, tauchten schlagartig die Bilder auf. Es war das erste Mal, dass ich von meinem Großvater José träumte. Wir beide inmitten seiner Olivenbäume. In seiner Hand ein kleines Bäumchen in einer schmutzigen, verrosteten Blechbüchse voller Erde. Im Boden lauter frisch ausgehobene Löcher, markiert mit Steinen, bereit, die Wurzeln der Pflanze aufzunehmen und zu ernähren. Zwischen uns liefen die Hasen herum, ohne uns zu beachten. Wir waren ein weiteres Element der Landschaft, etwas, das den dem Land eigenen Rhythmus nicht weiter tangiert. Im Traum redete mein Großvater, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass es nicht seine Stimme war. Ich hatte mich im Traum einfach von ihr davontragen lassen, ich hatte nur beobachtet, meine Hände mit Erde gefüllt und die ganze Zeit über die Büchse mit dem Olivenbäumchen gehalten. Auf der Fahrt befiel mich eine Mischung aus Kummer und unbändiger Wut.
Ich hatte vergessen, wie seine Stimme klang.
Oft frage ich mich, ob die Kindheit nur eine Illusion ist. Ich beschäftige mich so viel mit ihr, dass ich befürchte, sie zu entstellen oder zu idealisieren. Seit ich über ein Ich-Bewusstsein verfüge, ist mir klar, dass ich im Alter genauso leben will, wie ich als Kind gelebt habe. Ich möchte erwachsen werden, indem ich den umgekehrten Weg gehe, indem ich mich auf das zurückbesinne, was mich als Kind umgeben und meine Liebe zum Land geweckt hat. Ich bin, was ich bin, dank meiner Kindheit. Von klein auf wusste ich, dass ich Landtierärztin werden wollte, genau wie der Großvater. Die Jahre meiner Kindheit habe ich mit ihm zugebracht, inmitten eines Gartens voller Tiere. Das Land war das Substrat, in dem meine Familie mütterlicher- wie väterlicherseits über die Generationen hinweg Wurzeln geschlagen hatte: Da waren der Garten, die Vorratskammer, die Familie aus Kork- und Steineichen und Olivenbäumen, die Tiere, unsere Verbündeten bei Ernte und Arbeit.
Wir Schriftsteller werden oft gefragt, warum wir schreiben. Wie das erste Wort entsteht, das erste Gedicht, die erste Geschichte. Und wir versuchen vergeblich, etwas zu erklären, das schwer zu fassen ist, den Sinn dahinter zu ergründen, die Wurzel oder den Ursprung dieser Obsession, mithilfe von Worten alles umpflügen zu wollen. Ich weiß nicht mehr, wann oder warum ich anfing zu schreiben. Ich stelle mir vor, es ist wie ein Reflex, eine Gewohnheit, so wie man beim Aufwachen nach der Brille auf dem Nachttisch tastet. Etwas, das schon immer da war. Natürlich, ich könnte darüber schreiben, warum ich schreibe. Über die Dinge, die sich in den Vordergrund schieben, ins Licht treten und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sodass alles andere verschwindet. Manchmal tauchen sie auf und begleiten einen über Stunden, Tage oder sogar Wochen, bevor sie sich in Worte verwandeln. Ich stelle sie mir gern als Funken vor. Als etwas, das aus dem Nichts aufleuchtet und den Lauf der Dinge verändert.
Meine Kindheit ist eine Reihe solcher Funken: die Hände meiner Großväter, die Lumpen und Rasierklingen für die Veredelung der Pflanzen, die mutterlosen Lämmer, die Ziegen, die dem Ruf des Hirten folgen, die Olivenbäume und die Korkeichen, die Kuhglocken, die Wollpullover, die veterinärmedizinischen Fach- und Handbücher meines Großvaters … Auch das, was meinen Alltag als Landtierärztin ausmacht: der Wildwechsel, die Viehzüchter und -züchterinnen, mit denen ich arbeite, ihre Art zu reden, ihre Hände, die Körbe voller Gemüse und Eier, warme Ziegenmilch, der Steckling, der aus dem einen Blumentopf herausgerissen wurde, damit er in dem anderen heranwachsen kann, Volkslieder, Geschichten, Wiegenlieder, bestimmte Wörter, die man in der Stadt nicht hört, gedeihen hier prächtig und werden von denen gehegt und gepflegt, die das Land bestellen und dort leben.
Für die portugiesische Schriftstellerin María Gabriela Llansol war der Garten ihres Wohnhauses in Herbais – wo sie im Exil lebte und viele Stunden mit der Pflege ihrer Pflanzen zubrachte, las oder einfach nur dasaß und die Gedanken schweifen ließ – ihre noch unsichtbare Geschichte, der Initialfunke, bis viel später das erste Wort auftauchte und sie zu schreiben begann, als fiele dieses Licht, das die Dinge, die uns faszinieren und bewegen, gewissermaßen auf ihre Hand und entlockte ihr das erste Wort.
Mich treibt die Frage um, was wäre, wenn diese unsichtbare Geschichte, die Teil meines Lebens ist, nicht existierte. Würde ich dann auch schreiben? Hätte ich dann einfach eine andere? Dieses Buch ist sozusagen meine unsichtbare Geschichte, meine Zuflucht, der zaghafte Versuch, ein Haus zu bauen, konkret und schimärenhaft zugleich, wo Äste, Tiere und Saatgut Platz finden und das pulsierende Wort das Land und seine Bewohner ein wenig von ihrem Schattendasein und ihrer Staubschicht befreit.
Ein weiterer Funke, einer, der immer wieder aufleuchtet, betrifft die Strecke, die wir auf der Heimfahrt in unser Dorf mit dem Auto zurücklegen. Ich, als kleines Mädchen, die Wange an die Scheibe gedrückt, sommers wie winters, mit geschärftem Blick und gespitzten Ohren hinausstierend, als wollte ich diesen Bildschirm durchbrechen, darauf konzentriert, die Stieleichen zwischen all den Steineichen, Sträuchern und Korkeichen zu zählen und die Tiere zu entdecken, die jenseits der ausgestreckten Finger und aufmerksamen Stimmen meiner Eltern vorbeiliefen, die vereinzelten Hirsche neben der Fahrbahn, die unsicher waren, ob sie sie queren sollten, oder die wild wuchernden Zistrosen am Straßenrand, die am Wagen kratzten, als wollten sie zu uns hereindringen. Das Zählen war eine Methode, um das Verstreichen der Zeit zu beschleunigen, war der Wille zum Wissen, der Wille, den Tieren, die vor uns auftauchten, einen Namen zu geben und sie durch die Minuten zu ersetzen, sie zu dem Minutenzeiger zu machen, der nie stillsteht, das seltsam Absolute, das in unsere Kindheit einbrach. Vielleicht rührt daher die Gemütsruhe, die fast ein wenig entrückte Gelassenheit, die winzige Stimme, die sagt, alles okay, alles wird gut, wenn ich den Namen von etwas lerne, das mir fremd ist. Ich glaube, es war George Steiner, der schrieb, »was man nicht benennt, gibt es nicht«. Doch wer wird weiterhin benennen, was aufgehört hat zu existieren? Bleibt weiter da, was nicht mehr existiert und nicht mehr benannt wird? Und wer wird zum ersten Mal benennen, was noch keinen Namen hat? Was löst die erste Stimme, der erste Name aus?
Als Teresa, meine Großmutter väterlicherseits, an Demenz erkrankte, stellte ich fest, dass ich nichts über sie wusste. Rein gar nichts. Ich versuchte nachzuforschen, Fragen zu stellen, etwas über sie herauszufinden. Doch auch hier kam ich zu spät. Der Körper meiner Großmutter war der einer über achtzig Jahre alten Frau, in ihrem wirren Kopf war sie wieder zwanzig. Für sie war ich nicht ihre Enkelin, sondern eine ihrer Freundinnen aus dem Dorf. Die Gefährtin, der sie ihre Geheimnisse anvertraute und mit der sie Spaß hatte. Meine Großmutter hatte sich in ein verwegenes junges Mädchen verwandelt, das mir kichernd erzählte, wo sie die Briefchen ihrer Verehrer vor ihrer Mutter versteckte. Im Flüsterton heckte sie Streiche aus, verriet mir, wo ihre Mutter ihren Geldbeutel versteckt hatte, damit wir nachmittags auf der Plaza ein Eis essen gehen konnten. Sie redete vom Strand und einem Haus mit einem riesigen Flügel. Mein Großvater, mein Vater, meine Onkel existierten nicht, für sie war kein Platz auf dem Foto. Noch ein leerer Rahmen.
Als sie starb, entwickelte ich eine weitere Obsession. Ich begann die Kommoden in den Häusern meiner Großeltern nach Fotos zu durchstöbern. Mir ging es nicht länger um die, die an den Wänden hingen, die kannte ich ja schon. Ich war besessen von denen, die in den Keksdosen lagen, einzeln oder in Stapeln, fernab von ausbleichenden Lichtstrahlen und den Stimmen derer, die sie betrachten und ihnen Gesellschaft leisten würden, fernab von Kommoden oder Schreibtischen, auf denen sie eine Ruhestätte hätten finden können. Fortan waren sie es, an die sich meine Fragen richteten. Auf ihnen suchte ich all das, was ich versäumt hatte, ohne dass es mir bewusst war, wie jemand, der auf halbem Weg einen Wagen startet und nicht merkt, dass es in Wahrheit die Bäume sind, die sich bewegen, nicht wir. Sie gehen, ohne etwas zu sagen, ohne sich auch nur einmal umzublicken, ohne ein im Wind tanzendes Wort auf dem Weg zurückzulassen. Sie gehen, sie verlassen uns und warten nicht, bis wir begreifen, dass die Zeit verfliegt, dass der Minutenzeiger weiterläuft, trotz der Tiere am Straßenrand, der vorbeifliegenden Vögel, trotz all derer, die darauf warten, dass wir auf sie deuten, Fragen stellen und sie beim Namen nennen.
Nach dem Tod meiner Großeltern blieben die drei Zimmer leer. Die Stühle wirkten auf einmal grotesk, die Speisekammern nutzlos, die Blumenkästen stumm und farblos, die Flure verschlossen ohne jeden Sinn. Wieder leere Rahmen. Wie in so vielen anderen Häusern, die verschlossen werden, nachdem die letzten Bewohner sie verlassen mussten und die Möbel mit Laken zugedeckt wurden, so wie man einem Verstorbenen die Augen schließt, in dem Wissen, dass sie für immer geschlossen bleiben. Eine Geste, die in einem einzigen Augenblick entsteht und vergeht, so wie eine Wunde entsteht oder eine Erkenntnis aufkeimt.
Das ist meine unsichtbare Geschichte. Mein Haus, das bereits in Flammen steht, bevor es bezogen werden kann, bevor der letzte Stein gesetzt ist, das letzte Wort. Ist das so mit dem Schreiben? Ist das Schreiben etwas, das nicht warten kann? Das aus heiterem Himmel auftaucht und sich aufdrängt?
Man kann durchaus die Parallelen und den unterschiedlichen Rhythmus zwischen dem Schreiben, dem Leben auf dem Land und dem uns aufgezwungenen modernen Leben erkennen. Es sind andere Töne, andere Lieder, andere Rhythmen. In der Literatur wie auf dem Land sollte man, glaube ich, nichts überstürzen. Zwei Welten, die einander auf den ersten Blick so fern zu sein scheinen und doch so vieles gemeinsam haben. Die Funken, die Samen, die Sorgfalt, die Stille, die Geduld, während man sieht, wie alles heranwächst, und dafür sorgt, dass die Vielfalt trotz allem sprießt, gedeiht und fortbesteht. Ob schön oder hässlich, alle Wesen entstammen der Pflege einer Hand, und alle haben nur das eine Ziel: überleben.
Sie mussten erst aus meinem Leben verschwinden, damit ich es begriff. Etwas spät, denn wir Kinder und Enkel kommen immer spät an, bei den Dingen wie im eigentlichen Leben. Da mögen unsere Väter und unsere Mütter uns noch so viel erzählen, uns den Weg bereiten, uns auf die Spuren hinweisen, um den Vogel auszumachen, den man auf dem Ast vermutet. Wir sehen ihn nicht, weil es lange dauert, bis wir gelernt haben hinzuschauen, mit dem Blick, dem Tasten an den Rändern innezuhalten, zu begreifen, dass sich hinter den Bilderrahmen, die in den Häusern unserer Mütter und Großmütter hängen, eine verstörende Schönheit verbirgt, ein Schmerz, eine Geschichte, eine verborgene Genealogie, die darauf wartet, von uns vor dem Vergessen gerettet und angenommen zu werden. Eine Genealogie, an die wir anknüpfen und in der wir uns wiederfinden können.
Dieser Essay, der hier seinen Anfang nimmt, wie die eingerollten Hülsen des Schneckenklees sich an das Fell der Wanderschafe heften, um Tausende von Kilometern von ihrem Ursprungsort entfernt zu keimen, ist nichts weiter als eine – und ich hoffe nicht zu späte – Ankunft bei dem, was meine unsichtbare Geschichte ausmacht, bei denen, die existiert haben und nicht benannt wurden, die noch da sind, im Schatten, ungehört, weil es noch keinen Raum und kein geeignetes Sprachrohr für sie gibt. Dieser Essay ist wie eine Hand, die das Saatgut ausstreut, umpflanzt und hegt, bevor die Bilderrahmen in unseren Häusern verwaisen, verstummen, verlöschen, und sie niemand mehr eines Blickes würdigt.
ERSTER TEIL
EINE GENEALOGIE DER LÄNDLICHEN REGION
Ich bin die Schwester eines einzigen Sohnes
Agustina Bessa-Luis
I





























