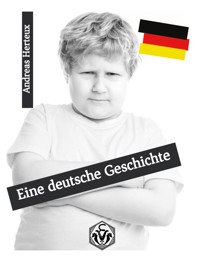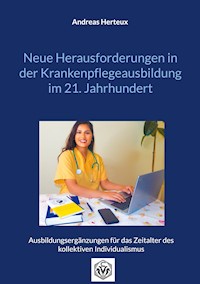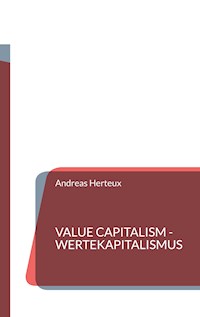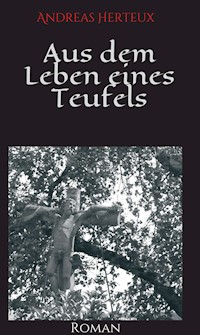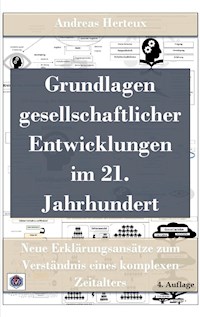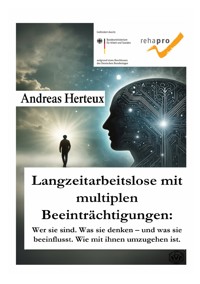
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Erich von Werner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der drängendsten sozialen Themen unserer Zeit. Kaum ein Bereich steht so sehr im Fokus politischer Debatten, in kaum ein anderes Feld fließen vergleichbar viele Mittel, doch nachhaltiger Erfolg bleibt seit Jahrzehnten aus. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass wir diese Menschen zu kennen glauben - in Wahrheit aber nur ihr Umfeld betrachten: Lebenslagen, Bildungsdaten, Gesundheitszustände. Wir analysieren das Können, aber nicht das Wollen. Doch wer sind sie wirklich? Was bewegt sie? Was beeinflusst ihr Denken und Verhalten? Spielt Arbeit in ihrem Leben noch eine Rolle? Und was ist für sie eigentlich normal? Ein ganzheitlicher Blick. Dieses Buch wagt erstmals eine Perspektive, die auch die innere Welt der Betroffenen und ihre tiefgreifende Prägung durch digitale Einflüsse mitdenkt. Auf Basis eines der umfassendsten empirischen Zugänge der letzten Jahre entwickelt Andreas Herteux neue Kategorisierungen - und gelangt zu einem überraschenden Befund: Die vermeintlich homogene Gruppe ist in Wirklichkeit ein Mosaik unterschiedlicher Milieus - mit eigenen Denkmustern, eigenen Wegen, eigenen Ressourcen. Herteux entwirft nicht nur eine neue wissenschaftliche Klassifikation, sondern schlägt einen Paradigmenwechsel vor: Weg von der Maßnahme - hin zu einem umfassenden Verständnis. Ein Verständnis, das anerkennt, dass heute viele Normalitätskonzepte gleichberechtigt nebeneinander existieren - und dass ein veraltetes Denken in korrigierbaren Normabweichungen an der Realität scheitern muss: bei der Langzeitarbeitslosigkeit ebenso wie im gesellschaftlichen Denken insgesamt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort des Autors
Vorwort Jobcenterverbund
Danksagung und Disclaimer
Einleitung
Kapitel 01. Der Mensch am gesellschaftlichen Rande?
1.1 Jahrhundertaufgabe Langzeitarbeitslosigkeit
1.1.1 Langzeitarbeitslosigkeit und ihre Folgen
1.1.1.1 Wirtschaftliche Dimension
1.1.1.2 Gesellschaftliche Dimension
1.1.1.3 Politische Dimension und zunehmende Polarisierung
1.1.1.4 Fazit: Risikofaktor Langzeitarbeitslosigkeit
1.1.2 Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit
1.1.2.1 Dimensionen effektiver Maßnahmen
1.1.2.3 Kurzfristige, themenspezifische und individualisierte Maßnahmen
1.1.2.4 Langfristige, themenspezifische und standardisierte Maßnahmen
1.1.2.5 Langfristige, themenspezifische und individualisierte Maßnahmen
1.1.2.6 Langfristige, ganzheitliche und standardisierte Maßnahmen
1.1.2.7 Kurzfristige, ganzheitliche und standardisierte Maßnahmen
1.1.2.8 Kurzfristige, ganzheitliche und individualisierte Maßnahmen
1.1.2.9 Langfristige, ganzheitliche und individualisierte Maßnahmen
1.1.2.10 Schlüsselfaktor Mensch
1.2. Das Modellprojekt LEILArehaktiv
1.2.1 Projektziele und Grundsätze
1.2.2 Zielgruppe
1.2.3 Projektstruktur und -laufzeit
1.2.4 Innovative Ansätze und Maßnahmen
1.2.5 Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation
1.2.6 Finanzierung
1.2.7 Standorte und Kapazitäten
1.2.8 Zusammenfassung
1.3. Wissenschaftliche Evaluation
1.3.1 Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs
1.3.2 Grundlagen der Evaluation
1.3.2.1 Limitationen der internen Evaluation
1.3.2.2 Limitationen der Evaluationsmethodik
1.3.2.3 Zusammenfassung
1.4. Übertragbarkeit der Ergebnisse
Kapitel 02. Grundlegende demographische Informationen
2.1 Methodik und Grundgesamtheit
2.2 Migrationshintergrund
2.3 Biologisches Geschlecht
2.4 Migrationshintergrund und biologisches Geschlecht:
2.5 Alter
2.6 Schulbildung
2.7 Schulbildung und Alter
2.8 Schulbildung und biologisches Geschlecht
2.9 Berufsausbildung
2.10 Berufsausbildung und Schulbildung
2.11 Berufsausbildung und Alter
2.12 Berufsausbildung und biologisches Geschlecht
2.13 Berufserfahrung
2.14 Berufserfahrung und Geschlecht
2.15 Letzte Beschäftigung
2.16 Wohnumfeld
2.17 Haushaltstyp
2.18 Zusammenfassung und wissenschaftliche Diskussion
2.18.1 Zentrale Erkenntnisse
2.18.1.1 Migrationshintergrund
2.18.1.2 Geschlechterverteilung .
2.18.1.3 Altersstruktur
2.18.1.4 Schulbildung und Berufsausbildung
2.18.1.5 Berufserfahrung und Abstand zur letzten Beschäftigung
2.18.1.6 Wohnumfeld und Haushaltstyp
2.18.2 Wissenschaftliche Diskussion
2.18.2.1 Bildungsbenachteiligung und Arbeitsmarktintegration
2.18.2.2 Altersstruktur und Langzeitperspektiven
2.18.2.3 Migrationshintergrund und soziale Integration
2.18.2.4 Einfluss des Wohnumfeldes auf Beschäftigungschancen
2.18.2.5 Bedeutung sozialer Netzwerke
2.18.3 Übertragbarkeit und Zusammenfassung
Kapitel 03. Krankheitsbilder und Belastungen der Teilnehmer
3.1 Psychische Beeinträchtigungen
3.1.1 Methodik
3.1.2 Verteilung der psychischen Erkrankungen
3.1.2.1 Diagnostizierte psychische Beeinträchtigungen
3.1.2.2 Vermutete psychische Beeinträchtigungen
3.1.2.3 Keine psychische Beeinträchtigung
3.1.3 Gesamtdarstellung und Fazit
3.2 Physische Erkrankungen
3.2.1 Methodik
3.2.2 Verteilung der physischen Beeinträchtigungen
3.2.2.1 Keine relevante körperliche Beeinträchtigung
3.2.2.2 Diagnostizierte körperliche Beeinträchtigungen
3.2.2.3 Vermutete körperliche Beeinträchtigungen
3.2.3 Gesamtdarstellung und Fazit
3.3 Psychische und physische Beeinträchtigungen
3.3.1 Verteilungsüberblick psychische und physische Beeinträchtigungen
3.3.2 Vergleich und Bewertung
3.3.2.1 Diagnostizierte versus vermutete Beeinträchtigungen
3.3.2.2 Schweregrad der Beeinträchtigungen
3.3.3 Quantifizierungsversuch und Ermittlung eines Belastungsgrades
3.3.3.1 Methodik
3.3.3.2 Quantifizierungsergebnisse
3.3.3.3 Kritische Diskussion des Quantifizierungsansatzes
3.3.3.4 Bewertung Quantifizierungsansatz
3.3.4 Fazit und Implikationen
3.4 Suchterkrankungen und Abhängigkeiten
3.4.1. Methodik ..
3.4.2. Verteilung der Suchterkrankungen
3.4.2.1 Diagnostizierte Süchte
3.4.2.2 Vermutete Süchte
3.4.3 Zusammenfassung
3.5 Soziale und persönliche Belastungen
3.5.1 Methodik
3.5.2 Verteilung der weiteren Problematiken
3.5.2.1 Soziale Isolation
3.5.2.2 Familiäre Probleme
3.5.2.3 Scham über die eigene Lage
3.5.2.4 Überschuldung
3.5.2.5 Regelmäßige Geldknappheit/schlechtes Haushalten
3.5.2.6 Weitere Verhaltensauffälligkeiten
3.5.2.7 Gewalterfahrungen als Opfer
3.5.2.8 Sorgen um Dritte (z. B. Familie)
3.5.2.9 Immobilität
3.5.2.10 Umfeldfaktoren/Negative Beeinflussung aus dem Umfeld (zusammengefasst)
3.5.2.11 Aggressionsprobleme
3.5.2.12 Probleme mit dem Strafgesetzbuch
3.5.2.13 Verschmutzter Wohnraum
3.5.2.14 Drohender Wohnraumverlust
3.5.2.15 Kinder wurden staatlich entzogen
3.5.2.16 Kein Wohnraum
3.5.2.17 Aktuelle Zivilverfahren
3.5.3 Zusammenfassung
3.6 Grad der Behinderung (GdB)
3.6.1 Methodik
3.6.2 Verteilung nach dem Grad der Behinderung ..
3.6.2.1 Kein GdB (Grad der Behinderung)
3.6.2.2 GdB 50 bis 69 Grad
3.6.2.3 GdB 30 bis 49 Grad
3.6.2.4 GdB 70 bis 100 Grad
3.6.2.5 GdB bis 30 Grad
3.6.2.6 GdB noch nicht feststellbar
3.6.3 Diskussion und Schlussfolgerung
3.7 Gesetzliche Betreuung
3.7.1 Methodik
3.7.2 Verteilung der gesetzlich angeordneten Betreuung
3.7.2.1 Keine gesetzliche Betreuung
3.7.2.2 Gesetzliche Betreuung
3.7.3 Diskussion
3.7.4 Zusammenfassung
3.8 Korrelationen der demographischen, gesundheitlichen und Umfeldbelastungen
3.8.1 Altersstruktur und Krankheitsbilder: Fortschreitende Chronifizierung und gesundheitliche Folgen
3.8.2 Berufserfahrung, Arbeitslosigkeitsdauer und gesundheitliche Beeinträchtigungen: Der langfristige Ausschluss
3.8.3 Wohnumfeld und gesundheitliche Belastungen: Regionale Benachteiligung als Risikofaktor
3.8.4 Haushaltstyp und soziale Isolation: Die Rolle von Alleinlebenden und Alleinerziehenden
3.8.5 Suchterkrankungen als Verstärkungsfaktor gesundheitlicher und sozialer Problemlagen
3.8.6 Schlussfolgerungen und strategische Implikationen
3.9 Zusammenfassung
3.9.1 Psychische Beeinträchtigungen: Dominanz und Komplexität
3.9.2 Physische Beeinträchtigungen: Ein weiterer Belastungsfaktor
3.9.3 Wechselwirkungen zwischen physischen und psychischen Beeinträchtigungen
3.9.4 Suchterkrankungen: Eine häufige Begleiterscheinung
3.9.5 Demographische und soziale Faktoren: Verstärkende Einflüsse
3.9.6 Haushaltstyp und soziale Isolation: Das Bild der Vereinsamung
3.9.7. Belastendes Umfeld
3.9.8 Zusammenfassung und strategische Implikationen ..
3.9.8.1 Notwendigkeit bedarfsgerechte Ansätze
3.9.8.2 Unvollständige Betrachtungen?
Kapitel 04. Einstellungen, Milieuzugehörigkeit und Verhaltensmuster der Teilnehmer
4.1 Soziale Milieus
4.1.1 Methodik
4.1.2 Auswertung der Milieuverteilung
4.1.3 Interpretation und Analyse
4.1.4 Zusammenfassung
4.2 Die Einstellung der Teilnehmer zu bürgerlichen Normen
4.2.1 Methodik
4.2.2 Auswertung der Einstellungen zu bürgerlichen Normen
4.2.3 Interpretation und Analyse
4.2.4 Abgleich mit den sozialen Milieus
4.2.5 Zusammenfassung
4.3 Arbeitswille
4.3.1 Methodik
4.3.2 Auswertung des Arbeitswillens
4.3.3 Interpretation und Analyse
4.3.4 Abgleich mit den sozialen Milieus
4.3.5 Diskussion und Zusammenfassung
4.4 Therapiebereitschaft der Teilnehmer
4.4.1 Methodik
4.4.2 Auswertung der Therapiebereitschaft
4.4.3 Interpretation und Analyse
4.4.4 Diskussion
4.4.5 Zusammenfassung
4.5 Motivation der Teilnehmer
4.5.1 Methodik
4.5.2 Auswertung der Motivation
4.5.3 Interpretation und Analyse
4.5.4 Kritische Diskussion und Zusammenfassung
4.6 Zuverlässigkeit der Teilnehmer
4.6.1 Methodik
4.6.2 Auswertung der Zuverlässigkeit
4.6.3 Interpretation und Analyse
4.6.4 Kritische Diskussion und Zusammenfassung
4.7 Eigeninitiative der Teilnehmer
4.7.1 Methodik
4.7.2 Auswertung der Eigeninitiative
4.7.3 Interpretation und Analyse
4.7.4 Kritische Diskussion und Zusammenfassung
4.8 Mitarbeit der Teilnehmer
4.8.1 Methodik
4.8.2 Auswertung der Mitarbeit
4.8.3 Interpretation und Analyse
4.8.4 Kritische Diskussion und Zusammenfassung
4.9 Korrelationsanalyse und Erweiterung
4.9.1 Methodik der vertiefenden Analyse
4.9.2 Ein konsistentes Bild der Teilnehmer
4.9.3 Öffnen der Black Box
4.9.4 Eingerichtete langzeitarbeitslose SGB-II-Empfänger
4.9.5 Holistischer, individualisierter und langwieriger Ansatz
4.9.6 Normverschiebung und Normalitätsneubildung
4.10 Zusammenfassung und Ausblick
4.10.1 Holistisches und konsistentes Bild der Teilnehmer
4.10.2 Stetiger Transformationsprozess
Kapitel 05. Digitale Konditionierung
5.1. Die Mechanismen der digitalen Welt
5.1.1 Verhaltenskapitalismus
5.1.2 Moderne Reizgesellschaft
5.2. Historische Entwicklung des Reizrahmens
5.2.1 Die 50er-Jahre
5.2.2 Die 60er-Jahre
5.2.3 Die 70er-Jahre
5.2.4 Die 80er-Jahre
5.2.5 Die 90er-Jahre
5.2.6 Die 2000er-Jahre
5.2.7 Die 2010er-Jahre
5.2.8 Zeitalter des kollektiven Individualismus
5.2.9 Zusammenfassung
5.3 Erhebung der digitalen Konditionierung
5.3.1 Methodik
5.3.2 Auswertung der Befragung mit dem Fragebogen EDEDKI
5.3.2.1 Altersstruktur der Befragten
5.3.2.2 Internetnutzung der befragten LEILA-Teilnehmer ..
5.3.2.3 Internetnutzungsarten
5.3.2.4 Intensität der Internetnutzung
5.3.2.5 Gestiegener Internetkonsum durch COVID-19
5.3.2.6 Persönlichkeitsaufwertung durch Internetnutzung
5.3.2.7 Nutzung von Smartphones
5.3.2.8 Nutzungsverhalten
5.3.2.9 Präsenz in den sozialen Medien
5.3.2.10 Präferierte Internetplattformen
5.3.2.11 Bevorzugte Internetformate und deren Konditionierungseffekte
5.3.2.12 Lernverhalten und Informationsbeschaffung
5.3.2.13 Einschätzung der eigenen Multitasking-Fähigkeiten
5.4 Bio-Psycho-Soziale Auswirkungen
5.4.1 Psychologische Folgen
5.4.2 Biologische Folgen
5.4.3 Soziokulturelle Folgen
5.4.4. Zusammenfassung
5.5 Zusammenfassung und Diskussion
5.5.1 Methodologische und theoretische Rahmung
5.5.2 Diskussion der Ergebnisse
5.5.3 Ableitungen
5.5.4 Fazit
Kapitel 06. Milieumodell von SGB-II-Empfängern mit multiplen Beeinträchtigungen
6.1. Eine kleine Geschichte der Milieumodelle
6.2. Methodik
6.1.1 Auswahl für die Grundorientierung bzw. Veränderungsbereitschaft
6.1.2 Auswahl für die Aktivität
6.1.3 Limitationen der Ergebnisse
6.2 Milieumodell
6.2.1. Milieus
6.2.1.1 Skeptiker
6.2.1.2 Eingerichtete
6.2.1.3 Orientierungslose
6.2.1.4 Orientierungssuchende
6.2.1.5 Veränderungswillige
6.2.1.6 Veränderungsgehemmte
6.2.2 Übertragbarkeit
6.3 Diskussion
6.3.1 Bedeutung der Ergebnisse .
6.3.2 Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs
6.3.3 Limitationen und kritische Reflexion
6.3.4 Implikationen für die Praxis
6.4 Zusammenfassung
Kapitel 07. Zusammenfassung, Ableitungen, Diskussionen und Empfehlungen
7.1 Einleitung
7.2 Kritik und Limitationen
7.2.1 Rolle der Projektleitung
7.2.2 Datengrundlage
7.2.3 Digitale Einfl
7.2.4 Übertragbarkeit und Generalisierbarkeit
7.3 Zusammenfassung und Einordung selektierter Ergebnisse
7.3.1 Demografische Merkmale
7.3.2. Bildungshintergrund
7.3.3. Berufserfahrung
7.3.4. Migrationshintergrund
7.3.5. Wohnlage und Haushaltstyp
7.3.6 Psychische und physische Beeinträchtigungen
7.3.7 Suchterkrankungen
7.3.8 Weitere soziale und persönliche Belastungen
7.3.9 Grad der Behinderung und gesetzliche Betreuung
7.3.10 Zwischenfazit: Kohärenz bei Demographie und Belastungen
7.3.11 Soziale Milieus der Teilnehmer
7.3.12 Einstellung zu bürgerlichen Normen
7.3.13 Arbeitswille der Teilnehmer
7.3.14 Therapiebereitschaft der Teilnehmer
7.3.15 Motivation der Teilnehmer
7.3.16 Zuverlässigkeit der Teilnehmer
7.3.17 Eigeninitiative der Teilnehmer
7.3.18 Mitarbeit der Teilnehmer
7.3.19 Zwischenfazit: Die Entschlüsselung der „Black Box“ Mensch
7.3.20 Rahmen der digitalen Konditionierung
7.3.21 Internetnutzung der Teilnehmer
7.3.22 Arten der Internetnutzung
7.3.23 Persönlichkeitsaufwertung durch Internetnutzung
7.3.24 Smartphone-Nutzung der Teilnehmer
7.3.25 Eigene Präsenz in sozialen Medien
7.3.26 Einschätzung der eigenen Multi-Tasking-Fähigkeiten
7.3.27 Entwickeltes digitales Verhalten sowie Präferenzen
7.3.28 Entwicklung eines Milieumodells für Langzeitarbeitslose mit multiplen Beeinträchtigungen
7.3.29 Gesamtschau der Ergebnisse
7.3.30 Ableitungen
Kapitel 08. Die Welt als gemachter Wille und geformte Vorstellung: Abschluss und Ausblick
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Erich von Werner Gesellschaft
Verlag
VORWORT DES AUTORS
„Es gibt keine größeren Hindernisse als die, die wir uns selbst schaffen.“Friedrich Schiller
Der Mensch ist der Ausgangspunkt vieler Betrachtungen, ein unbekannter Bekannter, denn einerseits folgt er scheinbar kalkulierbaren Bahnen und doch bietet er immer neue Facetten, die gelegentlich überraschen, stetig jedoch faszinieren. Er schockiert, erfreut und verblüfft – entschlüsselt, simplifiziert und doch rätselhaft sowie unverstanden zugleich. Das gilt im profanen Alltag, aber auch für die Wissenschaft, die oft nicht nur die ungeklärten Fragen der Vergangenheit beschäftigt, sondern auch mit neuen Herausforderungen, getragen von Gegenwart und Zukunft, konfrontiert wird. Alles hängt zusammen, wie ein schwer zu entwirrender Knoten.
Wer daher die Rolle des Individuums tiefgehend erfassen möchte, muss anerkennen, dass dies selten in ruhigen oder gar den gleichen Gewässern geschehen kann, sondern immer nur unter wechselnden Bedingungen.1
Das gilt umso mehr für die heutige Zeit des dynamischen Wandels, in der vieles, was einst als sicherer Hafen der Normalität erschien, Stück für Stück an Bedeutung verliert. Große Veränderungen sind es, geprägt von einer Schwäche der westlichen Welt, dem Aufstieg neuer Konkurrenten auf den Weltmärkten, Veränderungen der Umweltbedingungen, dem Drang der Menschen nach einem menschenwürdigen, aber auch guten Leben sowie dem technologischen Fortschritt, der sprunghaft mit allen Chancen und Risiken neue Türen öffnet, die vielleicht noch vor einigen Jahren undenkbar waren. Nur eine Entwicklung davon, um ins Konkrete zu schwenken, ist die digitale Welt, die wohl zu Recht als der größte Einflussfaktor auf das Denken, die Entwicklung und das Handeln der Menschen in unserer Zeit bezeichnet werden kann und auf die in der Folge noch tiefer eingegangen wird. Es ist eine Welt in Bewegung, die sich auch auf die Gesellschaft auswirkt und sie mannigfaltig beeinflusst.
Als Folge zersplittert diese in immer kleinere Lebenswirklichkeiten mit teilweise völlig unterschiedlichen Werten, Ausrichtungen, Prioritäten und Vorstellungen von einem guten und richtigen Leben – ein stetig wirkender, fragmentierender Prozess ohne sichtbares Ende. Es ist eine Periode der stetigen Individualisierung, in der sich immer mehr die Frage nach Sicherheit, Identität und Normalität stellt. Das Ergebnis ist überall ersichtlich: in sozialen Verfestigungen, sinkender gesellschaftlicher Diskursbereitschaft, Milieukämpfen, im Wahlverhalten, in der wirtschaftlichen Lage, im Bildungssystem, in Entwicklungsprozessen Heranwachsender – die Liste ist lang und könnte beliebig erweitert werden. Die Umfeldfaktoren haben sich rasant gewandelt und dies wird sich fortsetzen. Beständigkeit ist eine Illusion und dem Drang nach Gewissheit geschuldet. Nur eine Manipulation der Wahrnehmung kann sie aufrechterhalten, manchmal etwas länger, gelegentlich kürzer.
Das tangiert, wie bereits angedeutet, auch die Wissenschaft, denn die Forschung kann sich nicht abseits jener neuen Wirklichkeiten und Transformationsprozesse stellen. Laborbedingungen existieren im sozialen Bereich nicht und Methoden müssen stetig überdacht werden. Jenseits der Veränderung wartet nur der Irrtum und eine trügerische, falsche Sicherheit, genehm nur in einer kleinen Realität, einer unbedeutenden Blase und ohne Belang für die Zukunft. Wenn der Zeitenwandel aber bereits dem einfachen Menschen die Normalität raubt, wie kann dann erwartet werden, dass er vor jenen Halt macht, die der Verpflichtung unterliegen, die Welt erklären und einordnen zu wollen? Terra incognita liegt vor der metaphorischen eigenen Haustür; eine neue Ära beginnt.
Doch wenden wir uns von der imaginären Schale zum Kern der nun folgenden Ausführungen, denn so relevant und wichtig die Verweise auf eine dynamische neue Zeit auch sein mögen, so sollen sie doch am Ende nur dazu dienen, dafür zu sensibilisieren, dass diese auch bestimmte Gruppierungen der Gesellschaft und ihre spezifischen Problemstellungen tangiert, denn in dieser neuen Welt existiert eine Herausforderung fort, die gerade in Deutschland seit vielen Jahren ungelöst bleibt und eine der drängendsten sozialen und ökonomischen Komplexitäten unserer Zeit darstellt: Langzeitarbeitslosigkeit. Hinter den nüchternen Zahlen und Statistiken verbergen sich persönliche Schicksale, gesellschaftliche Spannungen, politische Diskussionen, belastete Staatshaushalte und eine nicht ausgeschöpfte ökonomische Ressource. Das ist ein Ballast, der von der Vergangenheit in die Gegenwart getragen wurde und nun mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert wird – doch dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr.
Langzeitarbeitslosigkeit stellt jedoch kein vereinzeltes Element dar, sondern offenbart sich als vielschichtiges Phänomen, das tief in der Struktur unserer Gesellschaft eingebettet ist. Diese stille Reserve existiert häufig schon sehr lange. Ist sie überhaupt noch eine nutzbare, wenngleich auch schwierig abbaubare Ressource? Und wenn ja, woran liegt es, dass die Abschöpfung nicht erfolgreich ist? Wer sind diese Menschen eigentlich? Sind sie am Ende doch nur die bekannten Unbekannten, die man zu kennen glaubt, bei denen es aber dennoch nicht gelingt, sie in die gewünschte Normalität zu transferieren? Oder existiert diese Wirklichkeit nur für eine mutmaßliche Mehrheitsgesellschaft, tangiert aber ganze Milieus gar nicht mehr?
Langzeitarbeitslosigkeit ist daher zweifellos ein unbewältigtes Problem in Deutschland und trifft nun auf eine Wirklichkeit, in der gesellschaftliche Zersplitterung und Individualisierung immer schneller voranschreiten. Dies ist gleichfalls eine Herausforderung, vielleicht sogar die größte für Jahre, aber dennoch wohl auch die am wenigsten erkannte unserer Zeit. Sie wirft alte, aber auch neue Fragen auf:
Wie kann die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt heute nachhaltig gelingen?
Wer sind diese Menschen eigentlich?
Wie denken und handeln sie?
Was ist für sie Normalität?
Lassen sich vielleicht Langzeitarbeitslosen-Milieus identifizieren?
Gibt es neue Einflussfaktoren, die das Denken und Handeln von Langzeitarbeitslosen beeinflussen, die für passende Strategien berücksichtigt werden müssen?
Ist die Integration in den Arbeitsmarkt für viele Arbeitslose noch eine gesellschaftliche Norm?
Das sind grundsätzliche Fragen, denen sich die folgenden Seiten ausführlich widmen werden, und es obliegt dem Betrachter zu beurteilen, ob sie in einem befriedigenden Maße beantwortet werden.
Als Datengrundlage dienen dabei Erhebungen rund um das rehapro-Modellprojekt LEILArehaktiv, ein Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das innovative Methoden im Umgang mit seiner Zielgruppe, sei es in der operativen Durchführung oder in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, bewusst forciert und fördert.2 Damit jedoch beginnt bereits eine Einschränkung, denn besagte Initiative beschäftigt sich ausschließlich mit langzeitarbeitslosen SGB-II-Empfängern mit multiplen Einschränkungen, d. h. einer Gruppe, die – und die folgende Beschreibung mag bereits einen Euphemismus darstellen – gemeinhin als sehr schwierig vermittelbar gilt und in der Regel seit vielen Jahren im System verweilt. Doch sind es nicht gerade jene Personen, die Langzeitarbeitslosigkeit zum Phänomen machen und womöglich zur Milieubildung, vielleicht sogar zu Generationenschaffung neigen? Die folgenden Seiten werden es durch eine klare Identifikation der Population zeigen.
Das Modellprojekt verfolgt dabei einen ganzheitlichen, langfristigen Ansatz. Das Ziel ist, den Menschen zu verstehen, ihn bis ins imaginäre Mark zu durchleuchten, um ihm optimal zu helfen. Es versteht Langzeitarbeitslosigkeit nicht nur als wirtschaftliches Problem, sondern als komplexes Zusammenspiel aus gesundheitlichen, sozialen, bildungsbezogenen, verhaltenstechnischen und digitalen Herausforderungen. Betroffenen Menschen soll durch eine andauernde und umfassende Betreuung der Weg zurück in ein selbstbestimmtes und wirtschaftlich unabhängiges Leben geebnet werden, nicht über Monate, sondern über Jahre. Das Projekt erkennt dabei die Vielfalt der Problemlagen und die Einzigartigkeit jedes Teilnehmenden an. Es kombiniert moderne diagnostische sowie erhebungstechnische Methoden, wie die Evaluation digitaler Einflüsse oder die objektive Feststellung körperlicher und psychischer Leistungsfähigkeit, mit einem menschzentrierten Betreuungsansatz. Manche davon stellen dabei eine Innovation dar. Sie müssen ihre langfristige Tauglichkeit noch beweisen und sich bewähren.
Ob LEILArehaktiv am Ende der Projektlaufzeit als erfolgreich betrachtet werden kann, ist jedoch für die folgende Untersuchung irrelevant, denn diese widmet sich primär den oben aufgezählten Fragen und nutzt den Modellversuch primär als Datenbasis. Eine Auswertung des konkreten Erfolges kann erst in den kommenden Jahren erfolgen, da das Projekt gerade erst die Mitte seiner Laufzeit überschritten hat. Es kann aber wohl – und der Leser wird diese Ansicht nach Lektüre dieser Arbeit vermutlich erahnen – vorweggenommen werden, dass die Antwort sehr differenziert-diversifizierend ausfallen wird.
Die Zielgruppe ist es daher, die in den Mittelpunkt rückt, vollumfänglich und vermutlich in einer Tiefe, wie es bislang nur selten möglich war. Die vorliegenden Seiten bieten daher eine tiefgehende Analyse dieser Personen und ihrer Barrieren, die sich nicht auf demographische Variablen, Krankheitsbilder oder sonstige Umfeldbelastungen beschränkt, sondern auch versucht, die Überzeugungen, Normen, Verhaltensweisen, Einstellungen und digitalen Konditionierungen zu ermitteln sowie verschiedene Milieus zu bilden, aus denen sich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten lassen, die auch die allgemeine Debatte beleben können, in der das Phänomen Langzeitarbeitslosigkeit oft mit einer gewissen Schärfe diskutiert wird. Es ist letztendlich der Versuch, eine bestimmte Population ein Stück mehr zu entschlüsseln und ein wenig Licht in das Innere der „Black Box“ vordringen zu lassen3 – ein holistischer Gedanke, der zweifellos auch ein interdisziplinäres Vorgehen erfordert, und ein Versuch, der vermutlich auch in einem mögliche Scheitern wertvolle Erkenntnisse offerieren kann. Dies zu entscheiden, obliegt aber dem Betrachter.
Diese Publikation ist daher womöglich nicht nur eine Momentaufnahme, denn es kann durchaus diskutiert werden, ob die vorliegenden Erkenntnisse übertragbar sind. Mehr noch, sie stellt die Frage, ob es nicht eines generellen Perspektivenwechsels im Umgang mit Langzeitarbeitslosigkeit bedarf, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Ausführungen verstehen sich daher als Aufforderung, weiterzudenken und sich letztendlich einer Zeit und ihren umfangreichen Entwicklungen zu stellen.
Dass die vorgestellten Ergebnisse und angewandten Methoden mit strengem Blick kritisch diskutiert werden müssen, muss dabei eine Selbstverständlichkeit sein.
Mit diesem Gedanken richtet sich das vorliegende Werk an Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, an Wissenschaftler, Sozialarbeiter und alle, die das Potenzial von Menschen wiederentdecken und fördern möchten. Es soll den Dialog anregen und Denkanstöße dafür geben, wie eine Gesellschaft gestaltet werden kann, die einerseits niemanden zurücklässt, auf der anderen Seite aber sich darum kümmert, dass sich kein neuer Zustand der Realität bildet, in dem das Dasein in der sozialen Absicherung als dauerhaft normal empfunden wird.
Beides dürfen wir nicht wollen, wir können es uns in schwierigen Zeiten eines globalen Zeitenwandels aber auch nicht leisten.
Andreas Herteux
1. Frei nach Immanuel Kant (1724–1804): „Es ist nichts beständig als die Unbeständigkeit“. Das Bild des Gewässers wurde dagegen unzweifelhaft von dem griechischen Philosophen Heraklit (520–460 v. Christus) populär gemacht, erscheint aber auch Jahrtausende später durchaus treffend sowie verwendbar.
2. Im ersten Kapitel wird das Modellprojekt ausführlich dargestellt.
3. Man verzeihe an dieser Stelle die Zweckentfremdung der Metapher der „Black Box“ aus dem Behaviorismus. Die folgenden Kapitel werden zeigen, ob die Entlehnung als angemessen betrachtet werden kann. Dem zweifellos vorhanden „Reiz“, verschiedene Theorien und Schulen gegenüberzustellen, muss allerdings widerstanden werden. Humanistische Psychologie, kognitionspsychologische Modelle, Systemtheorie – es gäbe viel zu sinnieren und doch wäre es womöglich nicht zielführend genug.
VORWORT JOBCENTERVERBUND
Als das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vor einigen Jahren das Programm „Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“ ins Leben gerufen hat, beobachteten wir in den Jobcentern in Aschaffenburg die Entwicklung mit großem Interesse und waren von der Idee begeistert, innovative Leistungen und organisatorische Maßnahmen zu erproben, die es ermöglichen sollten, die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erhalten bzw. wiederherzustellen.
Uns war bewusst, dass eine Bewerbung aufwendig sein würde. Dennoch sahen wir in dieser Initiative eine echte Chance, über die klassischen Strukturen hinaus nicht nur auszuführen, sondern auch mitzugestalten. Gerade weil dies nicht unserer Regeltätigkeit entsprach, verstanden wir es als Teil unserer Verantwortung für das Gemeinwohl. Daher begannen wir zu konzipieren, denn hier tat sich eine echte Möglichkeit auf, sich weit über die üblichen Ressourcen hinaus für benachteiligte Personengruppen einzusetzen. Neue Ideen entwickeln, innovativ sein, in die Problemlagen eindringen und versuchen, das umzusetzen, was die Kundinnen und Kunden wirklich benötigen – dies war das Ziel.
Im Laufe dessen konnten wir weitere Jobcenter für unsere Idee sowie deren Ausarbeitung gewinnen und damit einen bereits früher schon bewährten starken Verbund aus den Behörden in der Stadt Aschaffenburg sowie den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Neckar-Odenwald, Main-Spessart und Main-Tauber wiederbeleben. Das Modellprojekt LEILArehaktiv entstand, das im Rahmen des zweiten Förderaufrufs durch die Fachstelle rehapro des BMAS auch genehmigt wurde.
Die operative Umsetzung übergaben wir bewusst mit einem Vergabeverfahren an privatwirtschaftliche Träger (konkret - die Gesellschaft zur beruflichen Förderung Aschaffenburg mbH und die Handwerkskammer Service GmbH), mit denen wir eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. So entstand eine nahezu idealtypische Verzahnung zwischen öffentlicher Struktur und freier Trägerlandschaft.
Neben der Umsetzung war uns von Beginn an eines besonders wichtig: die wissenschaftliche Begleitung. Denn nur, wenn aus den praktischen Erkenntnissen systematisch Schlussfolgerungen gezogen werden, können diese auch auf politischer Ebene wirken. Wir wollten nicht nur erfolgreich umsetzen, sondern aktiv dazu beitragen, künftige Maßnahmen mitzugestalten – dafür braucht es Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit in Politik, Ministerien und Fachöffentlichkeit.
Während wir bei der operativen Umsetzung von Modellprojekten, beispielsweise für ältere Arbeitslose oder Alleinerziehende, bereits viel Erfahrung hatten, gilt dies nicht für den wissenschaftlichen Bereich. Daher sind wir froh, auch hier einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der nicht nur den wissenschaftlichen Standard beherrscht, sondern zudem in der Lage ist, weit über diesen hinauszugehen und neue Erhebungsmethoden sowie Verfahren zu entwickeln und diese sowohl theoretisch als auch praktisch vor Ort umzusetzen. Auch die Präsentation nach außen darf als gelungen bezeichnet werden, denn es gab zahlreiche Vorträge auf renommierten Veranstaltungen und Vertretungen gegenüber wichtigen Repräsentanten.
Das vorliegende Werk befasst sich nun mit Langzeitarbeitslosen im SGB-II-Bezug mit multiplen Beeinträchtigungen und rückt allein diese in den Mittelpunkt. Auf den ersten Blick ist das eine Gruppe, die scheinbar jeder kennt und jedes Jobcenter kennen müsste. Auf den zweiten Blick wissen wir als Praktiker vor Ort allerdings, dass sie viel heterogener ist, als sie oft dargestellt wird. Um aber im hektischen und schwierigen Alltagsgeschäft klassifizieren und differenzieren zu können, fehlen uns bereits die Informationen, Erhebungsmittel sowie Ressourcen.
Die soziale Lage und demografische Faktoren wie z. B. Alter oder Bildungsstand können wir in der Regel einschätzen. Bereits bei Krankheiten und sonstigen Umfeldbelastungen wird es schwieriger, da Kundinnen oder Kunden häufig keine Befunde haben oder sich nicht öffnen.
Fast unmöglich wird es aber bei inneren Einstellungen – und diese sind nun einmal entscheidend: Was will der Mensch eigentlich? Was denkt er? Was ist für ihn denn normal? Gehört Arbeit überhaupt zu seinem Lebensentwurf? Hängen soziale Lage, Belastungen und Verhalten wirklich so kausal zusammen, wie es oft suggeriert wird? Wie wirkt sich das Internet auf diese Menschen aus? Verändert es ihr Denken und ihre Fähigkeiten? Lassen sich diese Personen womöglich völlig neu clustern? Brauchen wir vielleicht neue Ansätze?
In der vorliegenden wissenschaftlichen Auswertung taucht immer wieder die Metapher des „unbekannten Bekannten“ auf – ein gutes Bild für Menschen, die wir zu kennen glauben, die uns dann aber doch teilweise fremd bleiben. Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort erahnen vieles, und doch bleibt es flüchtig, weil es keine systematische Klassifizierung gibt.
Für viele dieser Gedanken existieren auch in der Fachliteratur bislang keine befriedigenden Antworten – und damit ist vielleicht auch der Werkzeugkasten der Regelinstrumente unvollständig, der sich daraus ableitet.
Das vorliegende Werk, das uns in seinem Umfang, seiner Innovationskraft und seiner Tiefe positiv überrascht hat, versucht diese Lücken zu schließen, indem es genau die genannten Bereiche erforscht und ein sehr klares Bild erzeugt, das aus einer mutmaßlich homogenen Masse heterogene Milieus macht, die alle eine unterschiedliche Herangehensweise benötigen, um sie überhaupt noch an den Arbeitsmarkt heranführen zu können.
Damit ist aber zugleich klar, dass diese Erkenntnisse auch ein Appell an Politik und Verantwortungsträger sein müssen: Die Heterogenität der Kundinnen und Kunden bedarf einerseits der vollen Breite aller Interventionsmaßnahmen – von Förderung bis Sanktion – und andererseits müssen bisherige Vorgehensweisen deutlich und auf Basis neuer Erkenntnisse überdacht werden.
Hierzu können wir als Praktiker und Umsetzer vor Ort nur auffordern – durch unsere Teilnahme am Bundesprojekt rehapro, durch die Arbeit vor Ort, aber auch durch die Unterstützung der unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation, deren Ergebnisse Teil der künftigen Debatten werden sollten – vielleicht auch müssen.
Christian Wolf Geschäftsführer Jobcenter Stadt Aschaffenburg
DANKSAGUNG UND DISCLAIMER
„Wenn alle gemeinsam voranschreiten, stellt sich der Erfolg von selbst ein.“Konfuzius
Ein Dank gilt folgende Institutionen, Behörden und Einrichtungen:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS); im Besonderen der Fachstelle rehapro, mit der stets ein konstruktiver Austausch möglich war.
Dem Jobcenterverbund, der die Tätigkeit der wissenschaftlichen Evaluation unterstützte und größte Offenheit für innovative Wege zeigte, bestehend aus:
Jobcenter Aschaffenburg Stadt
Jobcenter Landkreis Aschaffenburg
Jobcenter Miltenberg
Jobcenter Main-Spessart
Jobcenter Neckar-Odenwald
Jobcenter Main-Tauber
Hier seien Herr Christian Wolf (Geschäftsführer Jobcenter Aschaffenburg Stadt) und Herr Daniel Lutz (Projektkoordinator) gesondert genannt.
Dem Forschungskonsortium der externen Evaluation, für die Vernetzungsmöglichkeiten, bestehend aus:
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Universität Duisburg-Essen
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) e.V. an der Universität Tübingen
ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH
Institut für empirische Soziologie (IfeS) e.V. an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
IGES Institut GmbH
SOKO Institut, Sozialforschung und Kommunikation
Allen Mitarbeiter der Träger (u.a. der Handwerkskammer Service GmbH), welche die reine Datenerhebung, nach Anleitung und Konzeption, unterstützt haben.
Es sei allerdings folgender Hinweis ergänzt:
Sämtliche externen Grußworte, Erwähnungen oder Danksagungen dienen der Einordnung aus Sicht der Anwendungspraxis und begründen keine Mitverantwortung an Inhalt, Auswertung oder methodischer Konstruktion. Diese Publikation wurde als eigenständige wissenschaftliche Arbeit durch den Autor erstellt.
Sie basiert auf methodischen Entwicklungen, Konzeptstrukturen und Erhebungsdaten, die im Rahmen eines öffentlich geförderten Modellprojekts angewandt bzw. auf Anleitung hin erhoben wurden. Die Auswertung und Aufbereitung als schöpferisches Werk erfolgten durch den Autor. Die dargestellten Inhalte, Analysen, Bewertungen und Schlussfolgerungen spiegeln ausschließlich seine persönliche wissenschaftliche Einschätzung wider. Sie beanspruchen keine offizielle Position oder Mitverantwortung beteiligter Institutionen, Projektträger oder Kooperationspartner, auch, wenn sie dieses wohlwollend öffentlich erklären.
Die Erwähnung des Projektkontexts oder einzelner Stellen erfolgt ausschließlich zur Kontextualisierung der praktischen Anwendung und ist nicht als institutionelle Autorenschaft oder formale Mitwirkung zu verstehen. Alle Rechte an Text, Struktur, Auswertung oder Darstellung liegen beim Autor. Externe Logos wurden durch den jeweiligen Rechteinhaber für diese Publikation freigegeben. Eine Weitergabe, Nutzung oder Verwertung dieser Arbeit – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rechteinhabers zulässig.
EINLEITUNG
„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“Friedrich Nietzsche
Am Anfang soll eine simple Frage stehen: Muss eine Ausarbeitung zu einem bestimmten Themenfeld auch eine Einordnung in einen größeren Kontext wagen? Das hängt, um eine diplomatische Antwort zu wählen, vermutlich von den Inhalten und Erkenntnissen ab.
Im konkreten Fall geht es oberflächlich um Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Identifikation und Klassifizierung eines Teils der Betroffenen. Es geht um verfestigte Lagen, geprägt von multiplen Belastungen, um eine bekannte und zugleich unbekannte Zielgruppe sowie deren tiefgehende Analyse auf verschiedenen Ebenen: Demographie, soziales Umfeld, Gesundheit, Verhaltensmuster, Normen, Beeinflussungen, Konditionierungen durch die digitale Welt, Erstellen eines nutzbaren Milieumodells. Bereits diese Aufzählung verdeutlicht, dass die Herangehensweise mannigfaltig, teilweise innovativ und stets auch interdisziplinär sein muss.
Es ist eine Reise, die im sicheren Hafen beginnen wird. Die Formalitäten werden geklärt (Kapitel 1). Es folgt eine Fahrt in ruhige Gewässer, die tiefergehend sein wird als gewohnt und bereits damit einen Mehrwert hat, aber dennoch das wohlige Gefühl von Sicherheit vermitteln wird (Kapitel 2 und 3). Etwas bieder, aber vermutlich zufriedenstellend. Der größte Teil der wissenschaftlichen Literatur endet bereits an dieser Stelle.
Nicht so dieses Werk, denn nun wartet die offene See mit all ihrer Ungewissheit (Kapitel 4 und 5) und mündet schließlich in eine neue Welt, die nahelegen könnte, dass vieles, was bislang als selbstverständlich und bequem galt, grundsätzlich überdacht werden müsste (Kapitel 6 und 7).
Ob es am Ende eine gelungene Reise war, möge der Leser entscheiden. Er mag beurteilen, ob es gelungen ist, eine bestimmte Population zu erfassen und zu entschlüsseln, die so vertraut wirkt und doch nicht erreichbar erscheint – vielleicht schlicht, weil der mutmaßlich Bekannte am Ende doch ein Unbekannter ist, der nie ausreichend erfasst wurde? Um diese Lücke zu schließen, ist es nötig, die Schranken mancher Wissenschaftsgebiete zu ignorieren, vielleicht sogar einzureißen.
Das geschieht nicht aus falschem Mut, sondern aus Notwendigkeit. Ist der Drang nach Tiefe daher nicht vielleicht sogar mehr epistemische Verpflichtung denn Wagnis? Müsste nicht bereits bloße wissenschaftliche Redlichkeit dazu anhalten, schlicht genauer hinzusehen? Was wäre denn die Alternative? Sich am Ende auf eine bloße Evaluation bekannter Daten zurückzuziehen, diese gekonnt zu bestätigen? Die Augen zu schließen, sobald das Licht der Erkenntnis blendend dazu auffordert, weiterzugehen? Nein, das widerspräche doch jedem forschenden Ethos und tangiert auch die persönliche Integrität. In diesem Rahmen ging es aber nie um die Entscheidung eines Einzelnen, denn die vorliegende Arbeit ist zudem in einen gesellschaftlichen Rahmen eingebettet, der auch in den Folgekapiteln noch vorgestellt werden wird. Wir bewegen uns innerhalb des Modellvorhabens zur Stärkung der Rehabilitation (rehapro) nach § 11 Absatz 1 SGB IX. Die Arbeit entstand daher im Umfeld eines aufwendigen Förderprogramms des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), das gerade solche innovativen Vorgehensweise fördert und entsprechende Erkenntnis verlangt. Dies gebiert noch einmal eine gesonderte, vielleicht schwierig zu erfassende gesellschaftliche und politische Obliegenheit, nicht nur, weil staatliche Gelder eingesetzt werden, sondern auch, weil Grundlagen für künftige Entscheidungen dringend benötigt werden. Sich dem zu entziehen und an dieser Stelle einen wissenschaftlich unabhängigen Beitrag zu verweigern, würde Sinn und Zweck der ganzen Tätigkeit widersprechen, nein, sie sogar konterkarieren. Dies soll nicht heißen, dass genau diese Arbeit Grundlegendes bewegen wird, denn jenes werden sowieso erst die nachgelagerte Wirkungsgeschichte und vor allem die Leser entscheiden. Vielmehr sollte auch sie sich diesem höheren Ziel unterordnen und das versuchen, was im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit, auf eine neutrale Art und Weise und gleich ob nun bequem oder sperrig, dienlich sein kann.
Doch wo nur beginnt eine solche Pflicht und an welcher Stelle endet sie beim Betrachtungsgegenstand?
Damit stellt sich erneut die Frage nach dem Kontext, denn unsere Zeit ist von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. Sie sind dynamisch, sich gegenseitig beeinträchtigend und wirkungsmächtig. Keine Gesellschaft kann sich diesem globalen Wandel entziehen, sie kann nur lernen, bestmöglich mit ihm umzugehen.4
Besagter Zeitenwandel hat Folgen. Ins Auge sticht dabei die Ökonomie: Die westliche Welt verliert an Wettbewerbsfähigkeit, während andere Regionen ihre Chancen erkennen und mehr und mehr auch nutzen.5 Ein solcher Satz liest sich abstrakt, beinahe harmlos, und doch schlägt sich eine solche Entwicklung auf allen Ebenen nieder, letztendlich auch in den Perspektiven und Bedürfnissen eines künftigen Arbeitsmarktes6 sowie im staatlichen Haushalt und damit in den Mitteln, die für seine Belebung zur Verfügung stehen.7 Rahmenbedingungen verändern sich im Kleinen, weil sie vom Großen angetrieben werden.
Der deswegen entstehende Druck ist politisch spürbar und manifestiert sich einerseits in internationalen Krisen, denn letztendlich geht es nicht nur um die Wirtschaft,8 andererseits in einer nationalen Entwicklung, in der die bestehende freiheitlich-demokratische Ordnung hinterfragt wird. Die gewohnte Sicherheit zerrinnt, was sich im Besonderen in den verhärteten Diskursen, in den Milieukämpfen und im Wahlverhalten zeigt, aber auch zu einer Orientierungslosigkeit führt und die Frage der eigenen Identität in den Vordergrund rückt.9
Der Zeitenwandel führt zu technologischen Sprungentwicklungen, deren Konsequenzen bislang kaum abschätzbar sind,10 treibt Menschen auf dem ganzen Erdenrund dazu, ihr Glück in anderen Regionen zu suchen, und wird ergänzt durch eine Natur, die immer unberechenbarer erscheint.
All das wirkt sich auch auf die Gesellschaft und den Einzelnen aus. Zersplitterung von Milieus und Individualisierung, oft getragen von digitalen Einflüssen, sind die Folge. Fähigkeiten und Verhaltensmuster verändern sich in einem bislang ungekannten Ausmaß und geben manchem Beobachter Rätsel auf.
Das ist die neue Welt, in der sich auch die Forschung bewegen muss, und das, obwohl sie sich gerade noch mit den Herausforderungen der alten beschäftigt. Doch ein Wandel fragt selten danach, ob die Betroffenen Schritt halten können. Er wirkt, und dieser Umbruch tangiert nicht nur das Alltagsleben, sondern fordert nun auch die Wissenschaft heraus, bestehende Methoden und Ansätze zu überdenken. In einer Wirklichkeit, die sich immer schneller wandelt, wird die Notwendigkeit deutlich, sich neuen Realitäten zu stellen und nachhaltige Lösungen – wenn nötig auch interdisziplinär - zu entwickeln.
Die Notwendigkeit zur Kontextualisierung ist daher gerade in Bereichen, die sich mit menschlicher Entwicklung beschäftigen, immer und grundsätzlich gegeben.
Jahrhundertproblem Langzeitarbeitslosigkeit
Damit zurück zum eigentlichen Themenfeld dieses Werkes. Ein drängendes Problem, das sich in dieser komplexen Wirklichkeit besonders hervorhebt, ist ein altbekanntes: die Langzeitarbeitslosigkeit. Sie stellt nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, die tief in die Struktur unserer sozialen und ökonomischen Systeme eingebettet ist. Hinter den Zahlen und Statistiken verbergen sich menschliche Schicksale, soziale Spannungen und ökonomische Verluste. Langzeitarbeitslosigkeit zählt zu den größten ungelösten Herausforderungen in Deutschland – ein Phänomen, das durch gesundheitliche, soziale und bildungsbezogene Barrieren oft verfestigt wird. Gleichzeitig unterliegt der Arbeitsmarkt dynamischen Veränderungen, die den Anschluss für viele Betroffene erschweren.
Doch was genau bedeutet Langzeitarbeitslosigkeit? Im Gegensatz zur Kurzzeitarbeitslosigkeit, die üblicherweise nur wenige Monate umfasst, bezieht sie sich auf Personen, die über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr hinweg keine Arbeit finden.11
Diese Form der Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches, da sie komplexe soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen mit sich bringt – ein Zustand, der dem Arbeitsmarkt nicht nur Potentiale entzieht, sondern auch teilweise dramatische Folgen für das Individuum aufweist. Es ist ein Phänomen, das unser Land seit Jahrzehnten vor große Herausforderungen stellt, und das völlig unabhängig von dem nun ebenfalls wirkenden globalen Zeitenwandel, der zusätzlich seine Wirkung entfacht.
Gefahr der Verstetigung von Langzeitarbeitslosigkeit
Ein zentrales Problem der Langzeitarbeitslosigkeit ist dabei die Tendenz zur Verstetigung. Wer längere Zeit ohne Erwerbstätigkeit bleibt, sieht sich zunehmend mit Schwierigkeiten konfrontiert, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Nicht selten verhindern strukturelle Hindernisse wie unzureichende Qualifikationen, gesundheitliche Beeinträchtigungen und sozial-ökonomische Rahmenbedingungen eine erfolgreiche Eingliederung, aber ebenso können sich Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensmuster verschieben sowie neue Milieus bilden, für die die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit womöglich weder eine wünschenswerte Norm noch ein Ziel darstellt.
Damit wären wir erneut bei der Kontextualisierung angekommen. Wem bei der Betrachtung der Zielgruppe nicht bewusst ist, dass der globale Zeitenwandel die Strukturen in rasender Geschwindigkeit fragmentieren lässt, und nicht die Tendenz zur Individualisierung erkennt, dem bleibt der wichtige Gedanke schlicht fremd, dass es heute nicht mehr eine einzige Gesellschaft gibt, sondern zahlreiche Gesellschaften, die nebeneinander existieren, aber teilweise völlig unterschiedliche Ansichten von einem guten und richtigen Leben haben.12 Die Population verharrt, überspitzt formuliert, zu oft in der Betrachtung im Homogenen, obwohl sie sich heterogen zeigt.
Genau diese milieuspezifische Innenansicht ist es daher, die für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, neben all den anderen Variablen wie beispielsweise die soziale Lage oder Krankheitsbilder, eine große Rolle spielen müssten. Einfacher ausgedrückt: Was ist für die Zielgruppe eigentlich normal? Wissen wir das eigentlich oder nehmen wir nur an, dass wir es wissen? Das ist der bekannte Unbekannte, entschlüsselt und doch nicht so recht steuerbar.
Die Antwort ist ernüchternd: Es fehlt schlicht an Daten. Dass diese zweifellos schwer zu ermitteln sind, bleibt unbestritten. Das vorliegende Werk wird sich allerdings auch daran versuchen. Ob dies erfolgreich ist, obliegt der Beurteilung durch den kritischen Blick des Lesers.
Ungelöste Probleme
Die Herausforderung selbst ist dagegen klar: Statistiken zeigen, dass in Deutschland die Zahl der Langzeitarbeitslosen in den letzten Jahren trotz der insgesamt positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, die mittlerweile sogar durch einem Fachkräftemangel in vielen Branchen befeuert wird, hoch geblieben ist. Im Jahr 2024 waren beispielsweise durchschnittlich etwa 970.000 Menschen in Deutschland als langzeitarbeitslos gemeldet.13 Zugleich werden im Jahr 2024 etwa 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger in der Statistik geführt, von denen etwa 4 Millionen Personen grundsätzlich als erwerbsfähig eingeschätzt werden.14 Eine Differenzierung der beiden Gruppen ist im Rahmen dieser Ausführungen nicht notwendig.15
Ein erheblicher Teil dieser Personen ist jedoch aufgrund tatsächlicher Hemmnisse nicht oder nur eingeschränkt für den Arbeitsmarkt verfügbar, da etwa 40 % dieser erwerbsfähigen Empfänger entweder in Ausbildung sind, Angehörige pflegen oder aus anderen Gründen, wie multiple und verfestigte Problemlagen, nicht unmittelbar arbeiten können .
Trotzdem ist die Arbeitsfähigkeit bei einer beachtlichen Anzahl gegeben und es stellt sich daher die Frage, warum ihre Integration so oft scheitert. Dieser Frage möchten sich die kommenden Seiten annähern und nutzen als Datengrundlage ein Modellvorhaben, das genau aufgrund dieses Hintergrundes dafür konzipiert wurde, Erkenntnisse zu erlangen, um den notwendigen Paradigmenwechsel einzuleiten.
Modellprojekt LEILArehaktiv
Das Modellprojekt LEILArehaktiv wurde ins Leben gerufen und widmet sich gezielt der Herausforderung, langzeitarbeitslose SGB-II-Empfänger mit multiplen gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf ihrem Weg zur beruflichen Wiedereingliederung langfristig, auch über Jahre, zu unterstützen. Dieses Projekt verfolgt einen umfassenden Ansatz in allen Lebenslagen, vor Ort, aufsuchend, begleitend, der nicht nur die berufliche Qualifikation in den Fokus nimmt, sondern auch psychosoziale, digitale und gesundheitliche Faktoren berücksichtigt. Das Ziel besteht darin, Barrieren zu identifizieren und individuell angepasste Strategien mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu entwickeln, die eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen.16
Die vorliegende Ausarbeitung kann daher auf Daten aus dem besagten Modellprojekt zurückgreifen, das für insgesamt sechs Jobcenter durchgeführt wird, um auf dieser Basis womöglich allgemeine Ableitungen für die Gesamtheit der Personengruppe vornehmen zu können.17
Sie bietet damit, eventuell erstmalig, eine tiefgehende Analyse der speziellen Zielgruppe sowie die systematische Identifizierung der Problemlagen einer neuen sowie der alten Zeit und könnte aufzeigen, warum ein langfristiger, individualisierter, ganzheitlicher Ansatz einer Politik des Stückwerkes vorzuziehen ist – oder doch nicht? Das ist eine grundsätzliche Frage, die bei der Verwendung von öffentlichen Mitteln entscheidend sein müsste.
Ob LEILArehaktiv diesen Anspruch erfüllen kann, kann dagegen nur angedeutet bzw. in Teilen beleuchtet werden, da das Modellprojekt erst Ende 2026 abgeschlossen sein wird und gerade die Langfristigkeit und die intensive Betreuung ein Kernmerkmal ist, das entscheidend für den Erfolg sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt wird noch eine separate Evaluation erfolgen.18 Bereits jetzt, und damit wird schon etwas vorweggenommen, sei angemerkt, dass die Antwort genauso differenziert und heterogen sein wird wie auch die Zielgruppe, die bislang zu oft homogen betrachtet und behandelt wird.
Den Menschen erfassen und verstehen lernen
Die vorliegende Ausführung bemüht sich darum, die Zielgruppe umfassend und tiefgehend zu erfassen, und setzt dabei folgende Erhebungsschwerpunkte:
Demographisches
Bildungs- und Erwerbsbiographien
Krankheiten und Beeinträchtigungen
Einstellungen und Normen
Digitale Einflüsse
Milieubildung
Die Methodik wird dabei in den jeweiligen Kapiteln dargelegt und entweder direkt oder in einem separaten Abschnitt kritisch diskutiert. Angemerkt sei dabei vorab, dass auch der Weg das Ziel sein kann, d. h. wenn sich eine Vorgehensweise als untauglich erweist, diese durchaus auch in ihren Fehlern zielführend sein kann. Innovationen, von denen manche in diesem Rahmen wohl anzutreffen sind, können scheitern und dürfen es auch.
Grundsätzliche Fragestellungen
Die Datenerhebung verfolgt dabei einen tieferen Zweck. Sie soll helfen, sich den Antworten zu folgenden Fragestellungen anzunähern:
Wer sind diese Menschen eigentlich?
Lassen sich vielleicht spezifische Langzeitarbeitslosen-Milieus identifizieren?
Gibt es neue Einflussfaktoren, die das Denken und Handeln beeinflussen, die für passende Strategien berücksichtigt werden müssen?
Ist die Integration in den Arbeitsmarkt für die Zielgruppe noch eine gesellschaftliche Norm?
Lassen sich die Erkenntnisse auf eine größere Grundgesamtheit übertragen?
Wie kann die Integration in den Arbeitsmarkt heute nachhaltig gelingen?
Die Zielsetzung ist dabei ambitioniert, könnte aber auch bei einem Misslingen eine wertvolle Diskussionsgrundlage für bessere Vorgehensweisen bieten. Letztere wird, gerade im Hinblick auf eine sich dynamisch ändernde Zeit, auch benötigt. Unabhängig von den Erfolgsaussichten bedarf es daher eines interdisziplinären, integrativen Forschungs- und Analyseansatzes, der soziale Phänomene nicht mehr nur makro- oder mikrosoziologisch betrachtet, sondern in ihrer digitalen, normativen, verhaltens- und milieutheoretischen Vernetzung. Gefragt ist also ein Multi-Feld-Ansatz zur Sozialintegration im Zeitalter des kollektiven Individualismus, eine postindividualistische Sozialdiagnostik mit rotem Faden, bei der jedes Kapitel auf dem letzten aufbaut. Dieser rote Faden soll auf den folgenden Seiten entwickelt werden, vom Bekannten ins Unbekannte, um den unbekannten Bekannten noch näher kennenzulernen. Für den Moment bleiben daher nur noch einige Hinweise.
Sprachliche Inklusion
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf spezifische Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.19
Adressaten dieser Ausführungen
Dieses Werk soll sich an Fachkräfte in der Arbeitsmarktintegration, Sozialarbeiter, politische Entscheidungsträger und all jene richten, die sich für die nachhaltige Unterstützung von Langzeitarbeitslosen interessieren. Sie sind es, denen die Erkenntnisse nützen können, sei es in der Theorie oder in der Praxis.
Gleichzeitig bemüht sich die vorliegende Ausfertigung aber auch um Allgemeinverständlichkeit, um auch andere interessierte Gruppen oder Personen erreichen zu können, denn die zu diskutierenden Phänomene Langzeitarbeitslosigkeit, erfolgreiche Integration und staatliche Leistungen sind von einer so großen Bedeutung in der öffentlichen Diskussion, dass dies auch angestrebt werden sollte und daher einen kleinen Anteil daran haben könnte, den oft verrohten demokratischen Diskurs auf diesem Felde womöglich wieder ein wenig zu versachlichen.20
Dies wäre ein willkommener Nebeneffekt, und allein schon die Notwendigkeit der Erwähnung zeigt, wie relevant und fundamental die soziale Frage in diesem Zusammenhang auf Antworten drängt. Daher soll sich in der Folge an diesen Antworten versucht werden. Vielleicht geraten die Erkenntnisse des Werkes sogar noch tiefgründiger und umfangreicher als es das Thema vermuten lässt. Vielleicht schaffen sie einen ganz neuen Blickwinkel auf die Wirklichkeit, nicht aus Ambition, sondern schlicht aus Verantwortung. Ein solcher Versuch kann aber auch scheitern. Ob jenes vielleicht geschehen ist, mag der kundige sowie kritische Leser entscheiden.
4. Der derzeitige globale Umbruch kann nicht nur kulturhistorisch als Zeitenwandel verstanden werden:
„Unter einem Zeitenwandel versteht man einen zeitlichen Abschnitt, in dem sich dessen einzelne Elemente auf eine solche Art und Weise dynamisch gegenseitig beeinflussen, dass diese eine Neuordnung der bisherigen globalen Machtverhältnisse bewirken können. Diese Elemente sind:
Der technologische Fortschritt
Aufstieg neuer Konkurrenten auf den Weltmärkten
Schwäche der bisher dominierenden Mächte
Veränderung der Umweltbedingungen
Fehlende Perspektiven für Teile der Menschheit“
(Definition nach Herteux, Andreas. „Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert“. S. 23 f.)
Als interessantes historisches Pendant bietet sich an dieser Stelle die Entwicklung im Rahmen der industriellen Revolution an, bei der die gleichen Komponenten massive
Umbrüche mit sich brachten. Generell ist die Ansicht, dass sich die Welt in einem globalen Zeitenwandel und auf dem imaginären Sprung befindet, allgemeiner Konsens und unstrittig. Ebenso, dass dies zwangsläufig Gesellschaften und die Umweltvariablen des Individuums beeinflusst.
5. An dieser Stelle ließe sich nun trefflich darüber diskutieren, ob es ein „asiatisches Jahrhundert“ mit den neuen Weltmächten China und Indien als Fixpunkte geben oder ob sich die alte Welt dagegen erfolgreich erwehren wird. Noch ist dieses Ringen nicht abgeschlossen. Für etwaige historische Parallelforschung sei folgende, leicht zugängliche Lektüre empfohlen: Landis, David, Wohlstand und Armut der Nationen, Pantheon Verlag, 1998.
6. Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung verlief auch im Jahr 2024 nicht positiv. Ein Beispiel hierfür sind die Erhebungen des Brutto-Inlandsproduktes des Statistischen Bundesamt für 2024, die eine schlechtere Entwicklung ergaben als der europäische Durchschnitt. Quelle: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Uebersicht.html#396382 [zuletzt abgerufen im Januar 2025].
7. Ursprünglich sollten für den Haushalt 2025 ca. 180 Milliarden Euro für den sozialen Bereich zur Verfügung stehen, was ungefähr dem Niveau von 2024 entsprochen hätte. Diese Kalkulation hat sich nicht durchsetzen können. Letztendlich ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass eine neue Regierung nach den Bundestagswahlen im Februar 2025 keine massiven Kürzungen auf diesem Felde vornehmen wird. Quelle: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1015554 #:~:text=Laut%20Haushaltsentwurf%202025%20(20%2F12400,179%2C37%20 Milliarden%20Euro) [zuletzt abgerufen im Januar 2025].
8. Ein Zeitenwandel findet stets auf allen denkbaren Ebenen statt: Ökonomie, Kultur, Gesellschaft, Geo-Politik, Technologie, Migrationsbewegungen, Umwelt – einige davon auszublenden, mag temporär praktisch sein, doch langfristig wirkt sich derartiges verfälschend auf das Handeln und die Entwicklung von Lösungsansätzen aus.
9. Diese Grundsatzfragen werden im englischen Sprachraum bereits weitaus länger diskutiert. Einige Schwerpunktwerke hierfür wären:
Huntington, Samuel P., Kampf der Kulturen – Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Goldmann, 2002
Huntington, Samuel P., Who are We? Die Krise der amerikanischen Identität, Goldmann, 2006
Fukuyama, Francis: Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Hoffmann und Campe, 2019
Aber auch in Deutschland ist die Dynamik des Zeitenwandels längst Konsens. Einige Ansätze, von denen der eigene allerdings bezüglich seiner Bedeutung nicht in die Reihe der anderen gesetzt werden soll, sondern sich lediglich als Hinweis darauf versteht, dass sich der Autor dieser Zeilen sehr tiefgehend mit derartigen Transformationsbewegungen beschäftigt hat: Reckwitz, Andreas, Verlust. Ein Grundproblem der Moderne, Suhrkamp, 2025 Herteux, Andreas. Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert, Erich von Werner Verlag, 2021 Eine Nennung bedeutet nicht unbedingt eine positive inhaltliche Bewertung, denn es geht nur um diese Grunderkenntnis: Die Veränderungen beschäftigen. Letztendlich erscheint es daher in der Summe fahrlässig, diese externen Einflüsse bei einer interdisziplinären Arbeit auszuklammern und laborhafte Bedingungen bar jeglicher Dynamik vorauszusetzen.
10. Diese Veränderungen sind ein bislang in der Forschung noch unbespieltes Feld. Bisherige Ansätze, sich der Entwicklung anzunähern, werden noch im Laufe dieser Ausfertigung, im Besonderen in Kapitel 5, thematisiert, näher beleuchtet und auf die Zielgruppe auch angewandt.
11. Definition nach § 18 SGB III, Langzeitarbeitslose.
12. Die Fragmentierung der Gesellschaft sowie der Trend zur Individualisierung ist in der Sozialforschung allgemeiner Konsens. Beides führt zu einer Verschiebung von Werten und Normen und tangiert damit auch die Einstellung zur Arbeit. Dass die Forschung an dieser Stelle nicht mit der dynamischen Entwicklung Schritt halten kann, ändert nichts an dem grundsätzlichen Phänomen. Diese Elemente werden im Besonderen in den Kapiteln 4, 5 und 6 aufgegriffen.
Eine Empfehlung zur Vertiefung sei hier: Barth Bertram et al. (2023), Praxis der Sinusmilieus, 2. Auflage, Springer Verlag.
13. Statistisches Bundesamt. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/666199/umfrage/anzahl-der-langzeitarbeitslosen-in-deutschland/ [zuletzt abgerufen im Januar 2025].
14. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Mindestsicherung/aktuell-mindestsicherung.html#:~:text=Gesamtregelleistungen%20(B%C3%BCrgergeld%20f%C3%BCr%20erwerbsf%C3%A4hige%20und,knapp%205%2C5%20Millionen%20Menschen [zuletzt abgerufen Januar 2025].
15. Langzeitarbeitslosigkeit und SGB-II-Bezug können zusammenfallen, müssen es jedoch nicht. Eine genauere Differenzierung erfolgt auch deswegen nicht, weil die Zielgruppe, die im Rahmen dieser Ausführung in den Mittelpunkt rückt, ausnahmslos die Kriterien für beides erfüllt. Daher wird diese Kenntnis der Umstände fortan vorausgesetzt.
16. Einen schnellen Überblick bietet hier auch die 23-seitige Informationsbroschüre
„Innovative Wege in der Sozial- und Bildungsarbeit – Modellprojekt LEILArehaktiv“, die allerdings noch den Stand des Jahres 2024 aufweist. https://www.gbf-ab.de/leila-botschafter [zuletzt abgerufen im Januar 2025].
17. In welchem Umfang die Erkenntnisse übertragbar sind, wird im Rahmen dieser Ausfertigung noch thematisiert werden.
18. Das Modellprojekt ist bis 31.12.2026 genehmigt und befindet sich daher mitten in der Durchführungsphase. Die langfristige Arbeit mit Teilnehmern in schwierigen Lagen ist ein Kernelement des Modellprojektes.
19. Bezüglich dieses Themas ein kleiner Verweis auf eine externe Publikation, welche die Abwägung vertieft, die hier nur verkürzt dargestellt werden kann: Herteux, Andreas, Focus Online. Was die Gender-Debatte gefährlich für die Demokratie macht. https://www.focus.de/experts/andreas-herteux-gefahr-fuer-die-demokratie-die-auswirkungen-der-gender-debatte_id_259609015.html [zuletzt abgerufen März 2025]. Für etwaige praktische Auswirkungen in der Projektarbeit sei auf Kapitel 2.3 verwiesen.
20. Gerade die soziale Frage war eines der grundlegenden Themen im Bundestagswahlkampf 2025 und wird die öffentliche Diskussion noch lange mitprägen. Die Erkenntnisse der vorliegenden Ausarbeitung könnten daher für viele Bürger von großem Interesse sein und auch ein Verständnis dafür erzeugen, wie differenziert die beschriebenen Phänomene zu betrachten sind.
KAPITEL 1
DER MENSCH AM GESELLSCHAFTLICHEN RANDE?
„Jeder hält die Grenzen des eigenen Gesichtsfelds für die Grenzen der Welt.“Arthur Schopenhauer
1.1 Jahrhundertaufgabe Langzeitarbeitslosigkeit
„Man ist ja selbst nicht stolz darauf keine Arbeit zu haben, sich oft nichts leisten zu können, keine Anerkennung zu bekommen, von der Familie nicht und vom Freundeskreis auch nicht. Das Selbstbewusstsein leidet darunter, irgendwann macht einem jeder Brief im Briefkasten einfach nur noch Angst. Man ist ständig in einer Art Verteidigungshaltung, weil man auch selbst die Schuldgefühle und das eigene Scheitern einfach nicht mehr ertragen kann.“21
Diese selbstreflektierenden Aussagen stammen aus einem Teilnehmerinterview, das im Rahmen des Modellprojekts LEILArehaktiv geführt wurde und, wenngleich auf eine komprimierte Art und Weise, Einblick in eines der drängendsten und vielfältigsten Probleme unserer Zeit gibt: Langzeitarbeitslosigkeit.22
Ihre Folgen sind nicht zu unterschätzen. Sie greift tief in die Lebensrealitäten der Betroffenen ein, wirkt sich auf ihre Familien und sozialen Netzwerke aus und belastet die wirtschaftliche, politische wie gesellschaftliche Entwicklung gleichermaßen. Sie geht nicht selten auch an die Substanz des Einzelnen und beeinträchtigt die Gesundheit.23
Trotz zahlreicher Programme und Maßnahmen bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland ein persistentes Problem, das auf strukturelle, individuelle und systemische Ursachen zurückzuführen ist. Tatsächlich ist es seit gut 20 Jahren nicht gelungen, den Anteil der Langzeitarbeitslosen, gemessen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen, auf unter 30 % zu senken. Im November 2024 lag er bei 35,5 %.24 Absolut ist die Anzahl der Langzeitarbeitslosen seit 2010 im Jahresdurchschnitt nie unter ca. 727.000 Personen gesunken, was zumindest als Indikator für Verstetigungen interpretiert werden könnte. Aktuell sind ca. 970.000 betroffen.25
Damit bleiben viele Potentiale ungenützt. Die Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit stellt daher nichts weniger als eine Jahrhundertaufgabe dar. Dies liegt nicht nur an ihrer Komplexität, sondern auch an den vielfältigen Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Herausforderungen wie beispielsweise dem globalen Zeitenwandel,26 Migration,27 den politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen, der Digitalisierung, der sozialen Ungleichheit, aber auch an den oft unbekannten Einstellungen der Betroffenen.28
Viele der bisherigen Maßnahmen scheinen daher nicht auf eine befriedigende Art und Weise zu greifen. Eine nachhaltige Lösung – und dies wird in der Folge noch zu belegen sein – erfordert daher innovative Ansätze, ein holistisches Herangehen, langfristige Strategien und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Die Bedeutung dieser Aufgabe zeigt sich nicht nur in den individuellen Schicksalen der Betroffenen, sondern auch in ihren Auswirkungen auf das Gemeinwohl. Langzeitarbeitslosigkeit ist mehr als ein Problem der Arbeitsvermittlung, sie ist ein Maßstab für den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit eines Landes. Angesichts ihrer zentralen Rolle in der Gestaltung der Zukunft gehört die Bewältigung der Langzeitarbeitslosigkeit zu den größten Herausforderungen unserer Zeit und verlangt mutige sowie visionäre Lösungen, sowohl in der Erforschung als auch im praktischen Handeln vor Ort.
1.1.1 Langzeitarbeitslosigkeit und ihre Folgen
„Man ist ständig in der Verteidigungshaltung, weil man auch selbst die Schuldgefühle und das eigene Scheitern einfach nicht mehr ertragen kann.“29
Langzeitarbeitslosigkeit hat Folgen für alle: das Land, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, aber auch das Individuum. Um der Komplexität der einzelnen Verknüpfungen gerecht zu werden und ein methodisch vollständiges Bild zu ermöglichen, seien sie noch einmal in ausgewählter und verkürzter Form in Erinnerung gerufen.
1.1.1.1 Wirtschaftliche Dimension
Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Langzeitarbeitslosigkeit führt zu einem erheblichen Verlust an Wirtschaftspotenzial. Ungeachtet der vorhandenen Arbeitskraft bleiben Ressourcen ungenutzt, was das BIP negativ beeinflussen könnte.30 Eine Integration könnte das Wirtschaftswachstum daher im Idealfall fördern, wenn sich denn durch entsprechende Qualifikationsmaßnahmen Angebot und Nachfrage finden würden.
Fiskalische Kosten
Die finanziellen Belastungen für den Staat sind erheblich. Im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben des Bundes für das Bürgergeld auf insgesamt rund 37,4 Milliarden Euro, was einen erneuten Höchststand darstellt. Für das Jahr 2024 waren Ausgaben in ähnlicher Größenordnung geplant. Ein signifikanter Teil dieser Ausgaben entfällt auf Langzeitarbeitslose, die aufgrund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit umfassende Unterstützungsleistungen benötigen.31
Produktivitätsverlust und Fachkräftemangel
Langzeitarbeitslosigkeit trägt zum Fachkräftemangel bei, der in vielen Branchen Deutschlands herrscht. Durch den Verlust oder gar das gänzliche Fehlen von Fähigkeiten und Kompetenzen während der Arbeitslosigkeit werden Betroffene weniger attraktiv für den Arbeitsmarkt. Dies verschärft den ohnehin bestehenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.32
1.1.1.2 Gesellschaftliche Dimension
Soziale Exklusion und Armut
Langzeitarbeitslosigkeit ist ein bedeutender Risikofaktor für soziale Ausgrenzung und Armut. Die Armutsgefährdungsquote unter Erwerbslosen liegt bei über 50 %, verglichen mit dem
nationalen Durchschnitt von etwa 17 %.33 Soziale Isolation, finanzielle Einschränkungen und der Verlust von sozialen Netzwerken sind häufige Folgen, die die Reintegration in die Gesellschaft erschweren.
Auswirkungen auf die Gesundheit
Die andauernde Arbeitslosigkeit hat oft negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit. Studien zeigen, dass Langzeitarbeitslose ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen und chronische Krankheiten haben.34
Intergenerationale Effekte
Die Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit erstrecken sich in der Regel auch auf die nächste Generation. Kinder von betroffenen Eltern haben ein höheres Risiko, selbst in Armut aufzuwachsen und später arbeitslos zu werden.35 Dies perpetuiert den Kreislauf von Armut und sozialer Exklusion. Hinzu kommen unübersehbare Folgekosten und Belastungen. Soziale Lagen können daher ein belastendes Erbe darstellen.36
Normalisierung und Milieubildung
Flankiert durch neue Einflussfaktoren wie die digitale Welt, welche zur Werteverschiebung beitragen, wird womöglich eine Milieubildung gefördert, bei der die Arbeitslosigkeit und der Bezug staatlicher Leistung als Normalzustand betrachtet werden könnten.
Diese Entwicklung näher zu betrachten, wird ein Schwerpunkt dieser Ausführungen darstellen.37
1.1.1.3 Politische Dimension und zunehmende Polarisierung
Vertrauensverlust in politische Institutionen und Wahlverhalten
Langzeitarbeitslose sind häufig bei den Nichtwählern überrepräsentiert.38 Es gibt zudem die These, dass Menschen in schwierigen Situationen sich leichter und schneller populistischen Parteien zuwenden und damit indirekt zur Destabilisierung des Systems beitragen könnten.39
Die persistente Langzeitarbeitslosigkeit trägt daher zum Vertrauensverlust in politische Institutionen bei. Betroffene fühlen sich oft von der Politik im Stich gelassen, was zu einer Entfremdung von den etablierten Parteien oder gar der politischen Ordnung führen kann bzw. bereits geführt hat.40
Politische Debatten und Polarisierung
Die Langzeitarbeitslosigkeit ist zu einem zentralen Thema in politischen Debatten geworden. Unterschiedliche Parteien bieten verschiedene Lösungsansätze an, was zu einer Polarisierung führt, die längst auch die Parlamente verlassen hat und intensiv in den Medien und in der Bevölkerung diskutiert wird.41
1.1.1.4 Fazit: Risikofaktor Langzeitarbeitslosigkeit
„Ich wollte ja eh arbeiten, nur war meine private Situation einfach so chaotisch, dass ich nach mehreren privaten Rückschlägen einfach nicht mehr in der Lage war, einer geregelten Arbeit nachzugehen.“42
Über Jahrzehnte ist es in Deutschland nicht gelungen, das Phänomen der Langzeitarbeitslosigkeit wirksam und dauerhaft zu bekämpfen, was ein Risikofaktor nicht nur für das Individuum ist, sondern auch für die Gesellschaft und womöglich zudem für die wirtschaftliche und politische Stabilität Deutschlands. Die direkten und indirekten Auswirkungen sind vielschichtig und dynamisierend und dürfen gerade in einer Periode des globalen Zeitenwandels in keinem Fall unterschätzt werden.
Langzeitarbeitslosigkeit ist daher weitaus mehr als ein Zustand, der eine bestimmte Gruppe betrifft oder ein persönliches Schicksal darstellt. Sie tangiert letztendlich alle und hat in einer Zeit der Individualisierung und der fragmentierten Milieus das Potential zur Mitgestaltung sowie Umformung der Gesellschaft.
Vielleicht – aber diese Diskussion kommt an dieser Stelle wohl zu früh, da die empirischen Daten erst in den Folgekapiteln folgen –, könnte es manchen Lebenswirklichkeiten der untersuchten Population gelingen, zu einem negativen Leitmilieu zu werden, das zum Vorbild für nachwachsende Generationen werden könnte.43 So abstrus diese These auf dem ersten Blick auch im Moment erscheinen mag, so wenig wird sie es womöglich und bedauerlicherweise am Ende dieses Werkes sein. Das wiederum zeigt einerseits die Wichtigkeit – und die Redundanz möge verziehen werden – der Kontextualisierung sowie die Dringlichkeit, Langzeitarbeitslosigkeit als zweitrangiges Problem zu begreifen, bei dem Ruhigstellung eine Lösungsvariable darstellen kann.
1.1.2 Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit
„Zunächst war ich skeptisch gewesen, da ich ja schon einige Maßnahmen des Jobcenters mitgemacht hatte. Viel hatte mir das nie gebracht.“44
Die Bewältigung von Langzeitarbeitslosigkeit ist eine vielschichtige Herausforderung, die einer umfassenden Betrachtung bedarf. Langzeitarbeitslosigkeit ist nicht isoliert von den politischen, wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen, auch wenn sie sich teilweise gegenüber unterschiedlichsten Gegebenheiten resistent zeigt.45
Vielmehr müssen Strategien entwickelt werden, die diesen Dynamiken Rechnung tragen. Eine reine Symptombehandlung reicht nicht aus; stattdessen ist ein systemischer Ansatz erforderlich, der sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren berücksichtigt.
Die Arbeitsmarktpolitik verfolgt dabei traditionell drei Hauptziele:
Prävention
: Verhinderung des Eintritts in die Arbeitslosigkeit durch Förderung der Bildung und Qualifizierung sowie durch Stärkung der Beschäftigungssicherheit.
Reintegration
: Unterstützung Arbeitsloser, damit sie möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren.
Sozialer Ausgleich
: Absicherung und Unterstützung von Personen, die nicht oder nur eingeschränkt in den Arbeitsmarkt integrierbar sind.
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören:
Beratung und Vermittlung,
Förderung beruflicher Qualifikationen und Weiterbildung,
Subventionierung von Beschäftigungsmaßnahmen und
Unterstützung bei der Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen.