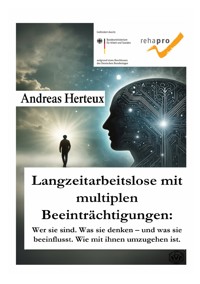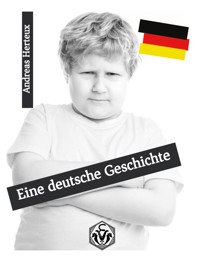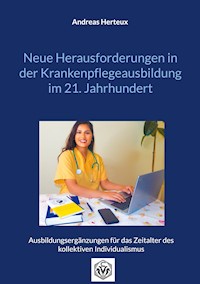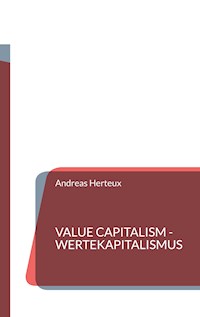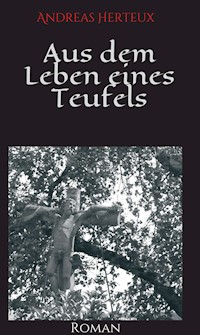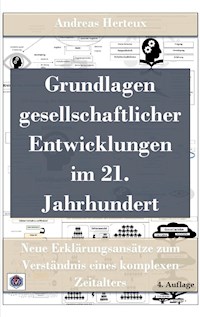
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"[..] Die vorgestellten Theorien sind wissenschaftlich fundiert, aber trotzdem allgemein verständlich. Das Buch bietet eine interessante Sicht auf das neue Zeitalter des kollektiven Individualismus [..]" Standpunkt, Ausgabe 10/2020 "[..] Interessante Lektüre [..]" Euro-Magazin, 10/2020 "[..] Das Buch ist ein wertvoller Beitrag für eine sachliche Diskussion, wenn man über Demokratie reden will und Diskussionen mit Niveau führen möchte und ganz nebenbei ein Lesegenuss, bei dem man viel erfahren kann [..]" Buchmonat, September 2020 "[..] Andreas Herteux Bestandsaufnahme erschließt die globalen Zusammenhänge des 21. Jahrhunderts in gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht mittels neuer interdisziplinärer Theorien und Modelle. Er bietet Deutungsansätze für die dynamisierte Gegenwart und faszinierende Entwürfe für eine Zukunft mit neuen gesellschaftlichen Spielregeln [..]" glaube aktuell, September 2020 Die Welt wandelt sich in rasender Geschwindigkeit. Alles dreht sich, wirkt aus den Fugen geraten. Eine Wirklichkeit, die nicht selten auf Unverständnis trifft und nach Erklärungen fordert. Diese gelingen aber oft nicht befriedigend, was die Frage aufwirft, ob sie ausreichend sind, um die komplexen Veränderungen darzustellen. Können sie das noch? Oder müssen sie weiterentwickelt werden? Bedarf es vielleicht anderer Ansätze, um das 21. Jahrhundert verstehen zu können? Andreas Herteux schließt die offenen Lücken, offeriert eine Vielzahl von neuen bzw. weiterentwickelten Erklärungsansätzen für globale gesellschaftliche, politische sowie wirtschaftliche Phänomene und bietet damit eine faszinierende Sicht auf ein neues Zeitalter: das des kollektiven Individualismus. 4. Auflage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur 4. Auflage
Einleitung
1. Die globale Erosion der Gesellschaft
1.1 Grundlagen der Milieumodelle
1.2 Globale Milieubildung
1.3 Ursachen gesellschaftlicher Entwicklungen
2. Der Aufstieg des Verhaltenskapitalismus
2.1 Grundthesen des Verhaltenskapitalismus
2.2 Grundlagen des Verhaltenskapitalismus
2.3 Der Kreislauf des Verhaltenskapitalismus
2.4 Bestandsaufnahme und Ausblick
3. Der Homo stimulus und die moderne Reizgesellschaft
3.1 Theoretische Grundlagen
3.2 Die Entwicklung der modernen Reizgesellschaft
3.3 Implementierung der Reizgesellschaft
4. Milieukampf und moderne Identifikationsdissonanz
4.1. Theorie der modernen Identifikationsdissonanz
4.1.1 Kognitive Dissonanz oder Identifikationsdissonanz?
4.1.2 Voraussetzungen, Rollen und Konflikte
4.1.3 Folgen der modernen Identitätsdissonanz
4.1.4 Das Ende der Milieus?
4.1.5 Zusammenfassung
4.2 Die Theorie des Milieukampfes
4.2.1 Milieukonflikt und Milieukampf
4.2.2 Natur der Milieukämpfe
4.2.3 Milieukoalitionen
4.2.4 Identifikation Führungswille
4.2.5 Erklärungsmuster für gesellschaftliche Prozesse?
5. Die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
5.1. Der Blick in die Zukunft
5.2. Die Herausforderungen der Gegenwart
5.3. Am Ende?
Glossar
Vorwort zur 4. Auflage
„Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, wenngleich die
Weichen auch gestellt sein mögen“
Ein Buch, das den etwas sperrigen Titel „Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert – Neue Erklärungsansätze zum Verständnis eines komplexen Zeitalters“ trägt, hat es in der Regel auf dem Markt nicht einfach. Trotzdem liegt dem Leser nun bereits die vierte Auflage vor. Ein erfreuliches Ereignis, das primär zeigt, wie wichtig und relevant die gestellten Fragen sind, die mit neuen diskutierbaren und ergänzenden Theorien und Modellen beantwortet wurden: Wie lässt sich die Gegenwart in all ihrer Komplexität besser erklären? Wie wird die Zukunft sein? Ist das 21. Jahrhundert das Zeitalter des kollektiven Individualismus? Wird der Mensch zum Homo stimulus? Wie lassen sich gesellschaftliche Konflikte besser erklären?
Nun also die vierte Auflage. Da die Editionen dazwischen weder über eine separate Kennzeichnung noch über ein erweitertes Vorwort verfügen – zu schnell schritten die Ereignisse voran und zu umfangreich waren die Aufgaben –, scheint es nun an der Zeit zu sein, die bisherige öffentliche Wahrnehmung des vorliegenden Werkes ein wenig zu rekapitulieren und einzuordnen.
Insgesamt ist festzustellen, dass das Buch und dessen Inhalte bislang wohlwollend aufgenommen wurden, was bei einer Diskussionsgrundlage, die gerade die Kontroverse sucht, durchaus positiv verwundern könnte, allerdings ist einerseits der Verbreitungs- und Meinungsbildungsprozess noch nicht abgeschlossen, andererseits sind die angesprochenen Themen so grundlegend, dass es beinahe unmöglich erscheint, diese nicht in den Mittelpunkt einer umfassenden Debatte zu rücken. Zu einem solchen Meinungsstreit gehört aber auch immer der Widerspruch. Er sei, falls er denn eines Tages heftig an der Tür klopfen sollte, ein stets willkommener Gast, solange das Benehmen den üblichen Gepflogenheiten entspricht.
Nein, man muss in diesem Buch kein „[..] visionäres [..] Diskursbuch“1 sehen. Es genügt, es als „[..] interessante Lektüre [..]“2 zu betrachten, die sowohl kritisier- als auch ergänzbar ist, denn letztendlich geht es um die Inhalte und diese betreffen uns alle. Es ist unsere Freiheit, unsere Zukunft – unser Leben. Wenn nun die wissenschaftliche Fundiertheit der Theorien herausgehoben wird,3 kann das eine Randnotiz bleiben, denn Derartiges sollte von Beginn an hinter der allgemeinen Verständlichkeit und Lesbarkeit zurücktreten. Konzipiert für einen möglichst breiten Leserkreis, nicht zu überfrachtet, war es bei Veröffentlichung allerdings keineswegs sicher, wie der Leser, der sich nicht stetig und in der Tiefe mit den jeweiligen Themen beschäftigt, das Buch aufnehmen würde. Er ist es, dessen Sinne geschärft und sensibilisiert werden sollten, denn es ist seine Wirklichkeit, die sich am Ende massiv verschieben wird. Tatsächlich erwiesen sich diese Bedenken als unbegründet und das Werk selbst erfuhr auch aus dieser Richtung eine überaus positive Rückmeldung. Dass es dabei immer wieder als eigenständiges bzw. abgeschlossenes Bild des 21. Jahrhunderts betrachtet wurde, erscheint dagegen zu absolut, denn es ist und bleibt eine offene Diskussionsgrundlage. Gleich, wie – der positive Tenor ist, und es soll nicht geleugnet werden, etwas, was den Autor erfreut und ermutigt, die Richtung für künftige Veröffentlichungen beizubehalten.
Zur vorherigen Auflage verändert sich daher auch wenig. Selbstverständlich wurde versucht, etwaige kleinere orthografische Unschärfen, die nicht durch das erste Korrektorat beseitigt werden konnten, in einem weiteren zu bereinigen. Inhaltlich gab es keine Ergänzungen, denn die vorgestellten Ideen und Theorien behalten selbstverständlich ihre Aktualität, aber auch das kann nicht überraschen, beschäftigt sich das vorliegende Werk doch mit den momentanen und künftigen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts.
Die Gegenwart ist bereits eingetreten und die Zukunft steht vor der Tür. Versuchen wir, den ersten Gast zu verstehen und uns so auf den zweiten vorzubereiten.
Andreas Herteux
Januar 2021
1 Kultur-Punkt (11/2020).
2 Euro Magazin (10/2020).
3 Standpunkt Magazin (10/2020).
Einleitung
„Und trotzdem haben alle Ideen ihren Wert, denn
gerade aus ihren Irrtümern erwachsen oft stärkere und
bessere Gedanken.“
Die Welt wandelt sich in rasender Geschwindigkeit und wirkt dabei für viele so komplex und undurchschaubar wie noch nie zuvor in der Geschichte. Alles dreht sich, ist aus den Fugen geraten. Die gespaltene Gesellschaft? Vertrauensverluste? Zweifel an der globalisierten Welt? Wie ist diese Skepsis, wie sind diese Konflikte entstanden? Wie lassen sich die gravierenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen erklären, die das Bestehende infrage stellen und möglicherweise in Teilen bereits obsolet gemacht haben? Was ist nur geschehen? Gestern war doch alles noch überschaubar und geordnet. Alles geht so schnell, dass kaum Zeit bleibt, die Entwicklungen ausreichend zu verifizieren, zu ordnen und darzustellen. Doch reichen alte Modelle und Ideen der Sozial-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften überhaupt noch aus, um die Realität des 21. Jahrhunderts abzubilden? Müssten sie nicht weiterentwickelt werden? Vielleicht erweist sich der Beobachtungsgegenstand als weitaus weniger komplex, wenn die Betrachtungsmethoden besser auf sie abgestimmt werden?
Diese Monografie möchte an diesem Punkt eine Hilfestellung geben und auf einige, womöglich auf alle, der genannten Fragen Antworten geben sowie neue Deutungen und Erklärungsmuster offerieren – als offene Diskussionsgrundlage, nicht als abschließende Darstellung. Dabei nutzt sie allerdings das Bestehende als Grundlage. Eine Fortentwicklung auf Basis des Gedankens, dass diese Welt auch im 21. Jahrhundert verstanden werden kann, es dafür lediglich einiger neuer Impulse bedarf.
Daher wird der Leser in dieser Monografie einer Vielzahl neuer interdisziplinärer Theorien und Modelle begegnen, die dazu dienen sollen, eine dynamisierte Zeit greif- und darstellbar zu machen.4 Anderer Ansätze, die vielleicht bei der Beschreibung der Wirklichkeit helfen können.
Folgende Theorien werden im Rahmen dieser Monografie neu betrachtet und zur Diskussion freigegeben:
Die Theorie der modernen Identitätsdissonanz
Das Modell des Verhaltenskapitalismus
Die Theorie der modernen Reizgesellschaft
Der Homo stimulus
Die Theorie des Zeitenwandels
Die Theorie des Milieukampfes
Das Zeitalter des kollektiven Individualismus
Es bleibt zu hoffen, dass diese einen debattierbaren Beitrag zum Verständnis des 21. Jahrhunderts leisten können. Doch egal wie, am Ende bleibt es, wie es immer war: Der zu erforschende Gegenstand, die gesellschaftliche Entwicklung, ist groß und der Acker weist genug Platz für mannigfaltige Pflanzen mit gar unterschiedlichsten Trieben auf. Manche von ihnen werden ewig blühen, manche werden abgeerntet sowie anschließend vergessen und andere wiederum verdorren.
Andreas Herteux
4 Dabei kann es nicht ausbleiben, die Fachsprache zu erweitern, denn neue Theorien, Modelle und Methoden bedürfen selbstredend auch ihrer ureigenen Ausdrucksform.
1. Die globale Erosion der Gesellschaft
„Die Wirklichkeit, die man zu sehen glaubt, ist oft nur ein
schwacher Abglanz der Vergangenheit, die oft mehr von den
eigenen Erinnerungen, denn von den Realitäten getragen
wird.“
Jedes Buch bedarf eines Anfangs. Das verhält sich bei einer Schrift über die gesellschaftlichen Strukturen des 21. Jahrhunderts ebenso wie bei jedem anderen Werk. Doch wo beginnen? Bei grundlegenden Begriffen aus den tangierten Fachdisziplinen? Nein, die vorliegende Monografie möchte nicht Bekanntes erneut präsentieren, sondern weiterentwickeln und einen neuen Blick wagen. Dann die Historie als Ausgangspunkt wählen? Nein, derartige Übersichten wären nur Seitenfüller. Die Geschichte soll nur dann eine Rolle spielen, wenn sie die Inhalte dieser Schrift tangiert.5 Womit dann beginnen? Warum nicht schlicht mit der Wirklichkeit und der Frage, wie die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aufgebaut ist? Ganz unmittelbar und mit einigen Thesen, die da lauten:
Eine vollkommen homogene oder überwiegend homogene Gesellschaft gibt es nicht.
Die Gesellschaft ist längst in viele Teile (Milieus) zerbrochen, die unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Lebenseinstellungen, Werte oder Verhaltensmuster aufweisen.
Der Zerfall ist kein europäisches oder westliches Phänomen, sondern kann global beobachtet werden.
Die Erosion zeigt ein Muster auf und ist noch nicht abgeschlossen.
Dieser Zerfall hat Ursachen und zieht Folgen für die Stabilität von Strukturen und Systemen nach sich.
Das wäre ein passender Beginn, denn das erste Kapitel, das noch wenig persönliche Originalität in seinen eigenen Überlegungen aufzeigt,6 wird sich diesen Thesen widmen und damit einen Teil eines Fundamentes der Wirklichkeit legen, welches für die weiteren Kapitel als Ausgangspunkt dienen soll. Es soll, in der gebotenen Kürze und Übersichtlichkeit, ein, was manchen Leser vielleicht überraschen mag, anerkanntes Abbild der Realität zeichnen. Zugleich bedeutet dieser Blick auf die Wirklichkeit aber auch eine Abkehr von vereinfachenden Erklärungsmustern, wie sie heute noch gerne für gesellschaftliche Vorgänge angewandt werden.7 Spätestens nach dem ersten Kapitel wird daher zumindest eine Ahnung entstanden sein, warum diese bestenfalls noch begrenzt tauglich sein können, um gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben oder gar zu erklären. Doch es soll von vorne, bei den Grundlagen der Milieumodelle, begonnen werden.
5 Es sei an dieser Stelle die persönliche Anmerkung erlaubt, dass das Herz des Autors an dieser Stelle leidet, wenn er auf das ursprüngliche, weitaus umfangreichere Manuskript mit all seinen Queransichten blickt. Nur, welcher Leser hätte seine Freude an einem 2000 Seiten dicken Buch gehabt, das stetig in die Geschichte abschweift, Parallelen sowie Anekdoten sucht und nebenbei weitere Theorien, wie die des Aufstiegs und Falles von Ländern und Räumen, aufstellt, die nur begrenzt mit dem 21. Jahrhundert zu schaffen haben? Mag das Herz auch bluten, das Endprodukt sollte doch eines für die Leser sein und nicht für den Autor.
6 Damit ist die des Autors gemeint, denn im ersten Kapitel wird primär ein einheitlicher Wissensstand hergestellt.
7 Man denke hier nur an das Links-Rechts-Schema, das heute noch zu oft als Erklärungsmuster für gesellschaftliche Konflikte herangezogen wird.
1.1 Grundlagen der Milieumodelle
„Je genauer die Betrachtung, umso mehr wirft auch
scheinbar Selbstverständliches Fragen auf.“
Um die Realität abbilden zu können, ist es fundamental, gesellschaftliche Strukturen des 21. Jahrhunderts zu kennen und zu verinnerlichen. Ein zentrales und nun benötigtes Element ist dabei der messbare Zerfall der globalen Gesellschaften in immer kleinere Lebenswirklichkeiten, die man als Milieus bezeichnet.8 Das bedeutet, dass die vorzustellenden Theorien und Modelle in den folgenden Kapiteln voraussetzen, dass es keine oder nur wenige homogenen Gesellschaften gibt.9 Im Gegenteil schreitet die Erosion stetig fort und muss zwangsläufig zu Konflikten zwischen den sich stetig im Wandel befindenden Lebenswirklichkeiten sowie zahlreichen weiteren Herausforderungen führen. Demnach handelt es sich um einen Prozess, der nicht abgeschlossen ist, sondern immer weiter fortschreitet.
Das mag auf den ersten Blick komplex anmuten, doch soll, um das Abstrakte zu konkretisieren, ein Beispiel herangezogen werden. Hierfür nutzen wir zwei Zeitpunkte aus der jüngeren deutschen Geschichte und vergleichen die gesellschaftlichen Strukturen. Dabei sei allerdings angemerkt, dass Deutschland hierbei, wie später noch demonstriert werden wird, keine Sonderstellung einnimmt, sondern es sich um ein globales Phänomen der Veränderung handelt. Hierzu jedoch zu einem späteren Zeitpunkt mehr.
Nach dem Krieg – wenige Milieus mit klaren Profilen
In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erschien die westdeutsche Gesellschaft wunderbar geordnet, denn es wurden lediglich vier Lebenswirklichkeiten unterschieden:10
das konservativ-protestantische Milieu,
das katholische Milieu,
das liberal-protestantische Milieu und
das sozialdemokratische Milieu.
Zwar ist nicht von einer absoluten Homogenität zu reden, wie sie in der nationalsozialistischen Propaganda einige Jahre zuvor noch angestrebt wurde11, und doch ist eine gewisse Übersichtlichkeit, die letztendlich auch das politische und kommerzielle Marketing erleichterte, festzustellen. Oder anders ausgedrückt: Es wurden klare Milieus mit eindeutigen Werten und Vorstellungen, deren Bedürfnisse relativ einfach zu erkennen und zu befriedigen waren, identifiziert.
In den folgenden Jahrzehnten veränderte sich die deutsche Gesellschaft allerdings augenscheinlich. Erst langsam, dann schneller, bis dieser Prozess schließlich – spätestens ab den mittleren 2000er-Jahren – durch den Zeitenwandel12 dynamisiert wurde. Wenige Jahrzehnte später ist daher von dieser scheinbaren Homogenität, oder besser von der überschaubaren Heterogenität, wenig geblieben.
Zerfall und Spaltung der Gesellschaft
Doch wie sah diese Veränderung aus? Um das aufzuzeigen, sollen Lebenswirklichkeitstheorien herangezogen werden, die diese Entwicklung aufzeigen. Grundsätzlich bestehen mehrere Milieumodelle, wobei das Sinus-Institut das bekannteste veröffentlicht hat.13 Zieht man diese Übersicht heran, so setzt sich die deutsche Gesellschaft aus nunmehr 10 (+3) Milieus zusammen, die sich in ihren Werten, Handlungen und Ansichten deutlich unterscheiden:14
Traditionelles Milieu (ca. 11 % der Bevölkerung)
Menschen, die dem traditionellen Milieu zugeordnet werden, legen großen Wert auf Sicherheit sowie den Erhalt jener Teile der Vergangenheit, mit denen man sich emotional verbunden fühlt. Sehr oft wird diese als „bessere Zeit“ oder als ein Sehnsuchtsort wahrgenommen. Bei der einheimischen Bevölkerung im Westen Deutschlands äußert sich das beispielsweise oft durch ein Festhalten an den Werten und Abläufen der alten Bundesrepublik. Bei Migranten durch ein inneres Bewahren des Heimatlandes, das sogar zu einer aktiven Verteidigung desselbigen führen kann, obwohl dieses seit Jahrzehnten nicht mehr besucht wurde und ein Leben dort auch nicht gewünscht wird. Das Vergangene bleibt für Personen, die sich dieser Kategorie zuordnen lassen, in manchen Bereichen ein Ideal und Traditionen der früheren Schicht (z. B. Bürgertum, Arbeiterklasse) werden beibehalten.
Man sieht sich als bodenständig, bewahrend, sparsam und bescheiden. Bei einigen spielt auch die Religion eine ausgeprägte Rolle. Einkommenstechnisch gehört man bestenfalls zur Mittel-, aber auch oft zur Unterschicht. Das war nicht immer so, aber nicht selten hat man in den letzten Jahren einen gewissen finanziellen Abstieg erlebt.
Skepsis gegenüber Veränderungen ist keine Seltenheit. Einen Hang zur Entwicklung gibt es nur begrenzt und wenn doch, hat jede Anpassung langsam zu erfolgen. Ein zu schneller Wandel führt mitunter zu einer innerlichen Überforderung, die unter Umständen eine Art innere Migration in die eigene Lebenswirklichkeit erwirkt, während störende Entwicklungen gezielt ausgeblendet werden, soweit das möglich erscheint. Aktiver Widerstand ist eher selten und lediglich bei extremen Störungen zu erwarten.
Das traditionelle Milieu wird seit 2020 in „verwurzelte Festhalter“ (4 %) sowie „modernisierende Bewahrer“ (7 %) unterteilt und ist seit 2018 um 2 % geschrumpft. Heute gehören ihm ca. 11 % der Bevölkerung an.
Prekäres Milieu (ca. 9 %)
Personen, die dem prekären Milieu angehören, zählen zur Unterschicht, die den Anschluss an die mittleren Milieus händeringend sucht und zum einen von realen Zukunftsängsten, aber auch von irrationalen Befürchtungen gelenkt wird. Man ist arm und fühlt sich auf jeder Ebene auch so. Das soziale Umfeld erschwert den eigenen Aufstieg und es bestehen nur wenige Möglichkeiten, die eigene Lebenswirklichkeit zu verlassen. Ausgrenzung erleben Angehörige dieser Kategorie des Öfteren und aus verschiedenen Gründen. Der Glaube an die eigene Benachteiligung ist stark ausgeprägt. Viele kämpfen aufopferungsvoll jeden Tag aufs Neue. Ihnen fehlt es emotional an gesellschaftlicher Anerkennung und das wird als schmerzlich empfunden. Es handelt sich um einen Zustand, der Betäubung erfordert. Der größte Teil des prekären Milieus versucht daher, derartige Gefühle durch Konsum zu kompensieren, was jedoch aufgrund der begrenzten Einkommen schwierig ist. So bleibt das Leben für ca. 9 % der Bevölkerung oft trostlos und grau.15
Hedonistisches Milieu (ca. 15 %)
Im hedonistischen Milieu finden sich die Anhänger der Spaßgesellschaft, die ganz einfach nur leben und dabei so viel Freude empfinden wollen wie möglich. Dabei betrachten sie Erwartungen als lästig und Traditionen sowie Konventionen als überflüssig. Die Angehörigen dieser Kategorie wollen etwas erleben und dafür zeigen sie sich extrem anpassungsfähig, denn letztendlich bindet sie nichts. Politik und Bildung interessieren diese Gruppe nur dann, wenn sie unterhalten. Sie sind unbekümmert, lassen sich leicht begeistern, laufen gerne Trends nach und lieben den Konsum, der auch einmal spontan sein darf, solange er sich in dem Moment gut anfühlt. Das Problem dabei ist, dass das insgesamt eher geringe Einkommen den Spaß doch immer wieder begrenzt. Das hedonistische Milieu wird seit 2020 außerdem in „Konsum-Hedonisten“ (8 %) sowie „Experimentalisten“ (7 %) unterteilt.16 Es umfasst ca. 15 % der Bevölkerung.
Bürgerliche Mitte (ca. 13 %)
Bei der bürgerlichen Mitte handelt es sich um den klassischen Mainstream, der die herrschende Ordnung stützt und dazu einen leistungsstarken Beitrag leistet. Die zentralen Themen sind Sicherheit, Ordnung sowie das Finden eines Platzes im bestehenden System. Im Gegensatz zum traditionellen Milieu akzeptiert man Veränderungen und trägt diese auch mit, wenn bewährte Kräfte sie glaubwürdig verkaufen. Es müssen schon extreme Geschehnisse sein, die den Lebensstil angreifen, wenn dieser Teil der Bevölkerung offen rebellieren soll. Der größte Teil davon verfügt über ein gutes oder sehr gutes Einkommen. Dennoch bestehen auch hier vermehrt Abstiegsängste. Manchmal zu Recht, gelegentlich nur gefühlt. Die bürgerliche Mitte wird seit 2020 noch in „Statusorientierte“ (7 %) und „Harmonieorientierte“ (6 %) unterteilt. Ihr gehören ca. 13 % der Bevölkerung an.
Adaptiv‐pragmatisches Milieu (ca. 11 %)
Bei der adaptiv-pragmatischen Lebenswirklichkeit handelt es sich um die junge und moderne Mitte der Gesellschaft, die primär von Nützlichkeitsaspekten geleitet wird. Sie ähnelt der bürgerlichen Mitte, ist aber noch biegsamer und flexibler, um einen Platz in der Gesellschaft zu erlangen, der das eigene Leben auf Dauer absichert. Diese „Schublade“ zeichnet sich daher durch eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. Sie ist weltoffen und steht Veränderungen positiv gegenüber. Da man überwiegend bereits in jungen Jahren über ein gutes Einkommen verfügt, kann man sich diesen Optimismus auch durchaus leisten. Gemeinhin wird dieses Milieu als die stärkste Lebenswirklichkeit der Zukunft betrachtet und spielt daher bei Gedankenspielen rund um die sogenannte „Neue Mitte“17 eine herausragende Rolle. Das Milieu ist seit 2018 um ca. 1 % gewachsen und umfasst ca. 11 % der Bevölkerung.
Sozialökologisches Milieu (ca. 7 %)
Die Anhänger des sozialökologischen Milieus sind die klassischen Verfechter der politischen Korrektheit und Vielfalt, die sich selbst als das soziale und ökologische Gewissen des Landes betrachten, aktiv versuchen, andere von ihren Idealen zu überzeugen, und den Anstoß für Veränderungen geben. Das Establishment sehen sie kritisch. Das gilt auch für den Kapitalismus oder den Konsum, obwohl sie, sehr oft mit relativ hohem Einkommen gesegnet, selbst nicht unter dem System leiden müssen. Ihnen geht es aber um grundsätzliche Veränderungen sowie globale Zusammenhänge. Daher sehen sie sich auch als starke Befürworter der multikulturellen Gesellschaft und neuer Gesellschaftsordnungen. In der Regel gelingt es ihnen, ihre Themen so zu platzieren, dass sie, im Verhältnis zu ihrem relativen Bevölkerungsanteil von 7 %, überproportional wahrgenommen werden.
Konservativ‐etabliertes Milieu (ca. 10 %)
Das konservativ-etablierte Milieu lässt sich als das klassische Establishment beschreiben. Man hat einen traditionellen Führungsanspruch und zumindest die alte Bundesrepublik maßgeblich mitgestaltet. Standesbewusstsein sowie Leistungsdenken sind ebenso Grundpfeiler des Selbstverständnisses wie der feste Glaube an den eigenen Wert und die Exklusivität. Teilweise existiert noch eine starke Verankerung in Traditionen. In den letzten Jahren ist der Einfluss der Angehörigen dieser Lebenswirklichkeit, die zur absoluten Einkommenselite zählen, gesunken, was aber nicht von Dauer sein muss, denn der natürliche Anspruch auf Führung wurde nicht aufgegeben und besteht noch immer fort. Diesem Milieu gehören ca. 10 % der Bevölkerung an.
Liberal‐intellektuelles Milieu (ca. 7 %)
Angehörige des liberal-intellektuellen Milieus kennzeichnen sich durch einen hohen Bildungsstandard sowie eine liberale Grundhaltung. Ihr Antrieb ist die Freiheit. Materielle Sorgen kennen sie in der Regel weniger und können daher vielfach interessiert sein. Ihre Ausrichtung ist kosmopolitisch. Das oft hohe Interesse an Kunst und Kultur ist nicht gespielt, während sie auf der anderen Seite wenig von alten Traditionen oder der Verklärung der Vergangenheit halten. Letztendlich zählen für sie Selbstverwirklichung sowie die persönliche Entfaltung. Der Anteil an der Bevölkerung beträgt ca. 7 %.
Milieu der Performer (ca. 8 %)
Zum Milieu der Performer zählt man die international orientierte Leistungselite des Landes. Sie denkt nicht mehr in nationalen oder gar regionalen Grenzen, sondern global. Konsum und Statussymbole sind für sie von zentraler Bedeutung, wobei letztere ganz bewusst zur exklusiven Abgrenzung dienen. Dementsprechend stark ausgeprägt ist auch das Konkurrenzdenken: Man weiß eben, dass die Welt ein Haifischbecken ist und die kleinen Fische letztlich nur Beute sind. Veränderungen oder das Nutzen von neuen Technologien sind für sie daher selbstverständlich. Dasselbe gilt für eine Vernetzung mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt. Dieser Lebenswirklichkeit gehören ca. 8 % der Bevölkerung an.
Expeditives Milieu (ca. 9 %)
In der expeditiven Lebenswirklichkeit findet sich eine junge, kreative und hochgebildete Elite, die sich geistig und seelisch neuen Ideen öffnet und Altes hinter sich lässt. Es handelt sich um Nonkonformisten, die wenig mit dem Establishment oder Traditionen anfangen können. Kein Denken in Grenzen und eine starke Vernetzung sind hier charakteristisch. Sie sind vollkommen offen für alternative Lebensweisen und Lösungen und können sich das finanziell auch leisten. Mit der politischen Zuordnung dieser Gruppe sollte man aber Vorsicht walten lassen, denn hier kann sich, soweit man Sympathien für das obsolete Links-Rechts-Schema verspürt, sowohl die moderne Linke als auch die moderne Rechte finden, die sich von der Vergangenheit gelöst hat und völlig neue Wege, oft gepaart mit neuester Technologie, zu suchen bereit ist. Die politische Einstellung ist daher kein besonders guter Indikator. Das Milieu ist seit 2018 um ca. 1 % gewachsen und umfasst ca. 9 % der Bevölkerung.
Eine Gesellschaft – viele Lebenswirklichkeiten
Soweit der Einblick in ein aktuelles, den Markt wohl dominierendes Milieumodell. Die Ergebnisse der Betrachtung der Lebenswirklichkeiten belegen einerseits die These, dass eine homogene deutsche Gesellschaft nicht existiert, und stellen darüber hinaus ein gewichtiges Indiz für die Schlussfolgerung dar, dass der Prozess des Zerfalls längst noch nicht abgeschlossen ist. Letzteres wird schon dadurch unterstrichen, dass seit 2018 weitere Unterteilungen der bestehenden Milieus, wie sie auf den letzten Seiten vorgestellt wurden, vorgenommen werden mussten.18
Nun mag der ein oder andere Leser einwenden, dass diese Schlussfolgerung zwar legitim ist, da eine entsprechende wissenschaftliche Grundlage gewählt wurde, es sich aber letztendlich nur um ein Modell handelt, das aus Sicht des Forschers Interesse generiert, aber nur begrenzten Praxisbezug aufweisen kann. Diese Annahme wäre allerdings ein fundamentaler Irrtum.
Ein Standard des politischen Marketings
Bei den Milieumodellen handelt es sich nicht um ein rein theoretisches Konstrukt, sondern sie dienen noch immer als Basis für wirtschaftliche und politische Entscheidungen.19
Insbesondere in Deutschland war und ist die Nutzung der Lebenswirklichkeiten-Modelle sehr ausgeprägt. Als Beispiel soll das politische Feld dienen, bei dem Milieubetrachtungen spätestens ab den späten Neunzigerjahren dazu geführt haben, sowohl die Kommunikation als auch die eigene Zielgruppe zu überdenken sowie neu auszurichten.
In die Öffentlichkeit drang dieses Umdenken allerdings erst spät und im Rahmen des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 1998. Hier im Besonderen durch die als „modern“ wahrgenommene Kampagne der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SPD).20
Später auch durch die Christlich Demokratische Union (CDU), bei der Milieumodelle einen wesentlichen Baustein für den Umbau der Partei darstellten.21 Dass diese Modelle auch mehrere Jahrzehnte später noch eine wichtige Rolle spielen, wird von mancher Partei selbst nach außen kommuniziert22 und ist auch in der politischen Berichterstattung ein Standard.23 Gleiches gilt für viele Bereiche des öffentlichen Sektors.24
Wirtschaft
Was für die Politik galt und gilt, ist auch für die Wirtschaft einschlägig. Auch sie orientiert sich im Vertrieb noch immer in großen Teilen an den Lebenswirklichkeiten der Kunden.25 Diese werden den Bedürfnissen der Auftraggeber entsprechend genauer ausgearbeitet und segmentiert. Die Automobilindustrie nutzt hier in Teilen beispielsweise die Sigma-Milieus des Sigma-Instituts, die Entwicklung eines Konkurrenten des Sinus-Instituts, als Grundlage für die Segmentierung von globalen Zielgruppen und Trends.26
Damit soll dieser Exkurs allerdings enden und die Eignung von Milieumodellen als theoretische und praktische Argumentationsgrundlage ausreichend nachgewiesen sein.
Eine homogene Gesellschaft gibt es nicht
Grundsätzlich gilt, dass Milieumodelle und damit die Erkenntnis der zerfallenen Gesellschaft heute nicht nur eine bedeutende Komponente des ökonomischen und politischen Marketings sind, sondern eine allseits akzeptierte Tatsache. Zudem lässt sich beobachten, dass dieser Trend weiter fortschreitet. Oder kurz zusammengefasst:
Die Gesellschaft setzt sich aus zahlreichen Milieus mit teilweise völlig unterschiedlichen Vorstellungen von der richtigen Lebensweise zusammen.
Der kritische Leser mag dies nun akzeptieren, aber zugleich die Frage stellen, ob an dieser Stelle nicht vielleicht eine spezifisch deutsche Konstellation beschrieben wurde. Ob es sich daher auch um ein globales Phänomen handelt, soll in einem nächsten Schritt untersucht werden.
8