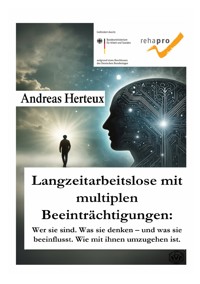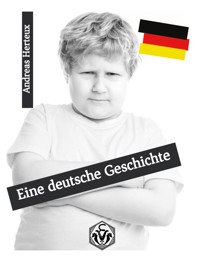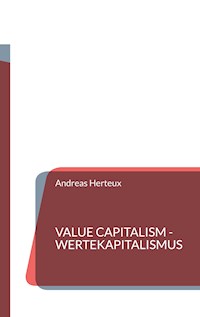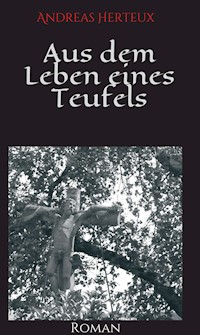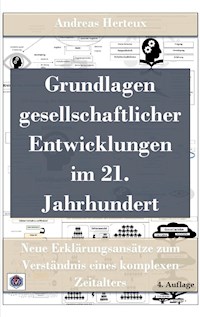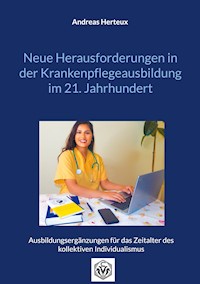
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kaum ein gesamtgesellschaftlicher Komplex hat eine größere Bedeutung als der der Pflege, denn dieser muss heute und in der Zukunft die Versorgung von Millionen Pflegebedürftigen erbringen. Ob er dies auf Dauer qualitativ-hochwertig noch zu leisten vermag, darf dagegen hinterfragt werden, denn zu offensichtlich sind die Lücken und Mängel im System. In der Regel werden diese Herausforderungen allerdings aus dem Blickwinkel der Nachfrage, des Bedarfs an Arbeitskräften, betrachtet, weniger aus dem der tatsächlichen oder potenziellen Pflegekräfte. Ein Ansatz, der oft verkennt, dass das Individuum heute einem völlig neuen Reizrahmen einer sich dynamisch wandelnden Wirklichkeit ausgesetzt ist, der sich prägend auf Persönlichkeitsentwicklung, Verhalten oder die Kompetenzen auswirkt. Aus dem Homo sapiens ist in vielen Fällen ein Homo stimulus geworden. Auf diesen Homo stimulus sind die aktuellen Formen der Pflegeausbildungen oft nur unzureichend vorbereitet. Die Folgen sind hohe Abbruchquoten und eine zunehmende Diskrepanz zwischen gesellschaftlichem Nutzen des Berufes und dessen Ansehen. Um den Bedarf an Pflegekräften für die Zukunft sichern zu können, erscheint es daher notwendig zu untersuchen, mit welchen Einflüssen des kollektiven Individualismus Auszubildende in der Pflege im 21. Jahrhundert konfrontiert werden, wie diese sich auf Persönlichkeit, Verhalten und Kompetenzen auswirken und wie mit ihnen umzugehen ist. Das Ziel von Andreas Herteux Standardwerk ist es daher primär, individuelle und gesellschaftliche Veränderungen der Gegenwart und der nahen Zukunft für die Pflegeausbildung darzulegen, die Folgen zu betrachten, und sekundär, erste Anpassungsvorschläge zu skizzieren, um auf ein geändertes Auszubildendenverhalten sowie variierende Kompetenzen reagieren zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
1.
Einleitung
1.1
Problemstellung
1.2
Forschungsfrage und Ziel
1.3
Aufbau
1.4
Grundannahmen und Einschränkungen
2.
Das Zeitalter des kollektiven Individualismus
2.1
Begriffsdefinitionen
2.1.1
Kollektiver Individualismus
2.1.2
Homo stimulus
2.1.3
Verhaltenskapitalismus
2.1.4
Zeitenwandel
2.1.5
Moderne Reizgesellschaft
2.1.6
Reizrahmen
2.1.7
Moderne Identifikationsdissonanz
2.1.8
Milieukampf
2.1.9
Milieukonflikt
2.2
Neue Einflüsse auf das Individuum im 21. Jahrhundert
2.2.1
Die Etablierung des Verhaltenskapitalismus ....
2.2.2
Homo stimulus und moderne Reizgesellschaft
2.2.3
Weitere Einflüsse
2.2.3.1
Erosion der Gesellschaft
2.2.3.2
Milieukonflikte und Milieukampf
2.2.3.3
Moderne Identifikationsdissonanz
2.2.3.4
Vollständiger oder unvollständiger kollektiver Individualismus?
2.2.3.5
Sonstiges
2.3
Zusammenfassung
3.
Die Pflegeausbildung in Deutschland
3.1
Kurze Historie der deutschen Pflegeausbildung
3.2
Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau
3.3
Reizrahmen der Auszubildenden in der Pflege
3.3.1
Die 50er-Jahre
3.3.2
Die 60er-Jahre
3.3.3
Die 70er-Jahre
3.3.4
Die 80er-Jahre
3.3.5
Die 90er-Jahre
3.3.6
Die 2000er-Jahre
3.3.7
Die 2009er-Jahre
3.3.8
Zeitalter des kollektiven Individualismus
3.4
Zusammenfassung
4.
Empirische Befragung der Auszubildenden in der Pflege
4.1
Methodik und Vorgehensweise
4.2
Datenerhebung und Auswertung
4.3
Ergebnisse
4.3.1
Demografische Angaben
4.3.2
Allgemeine Mediennutzung
4.3.2
Spezifisches Medienverhalten und Selbsteinschätzung
4.3.3
Berufliche Fragen
4.3.4
Fragen zur Arbeitsweise
4.3.5
Einschätzung von Lösungsvorschlägen
4.4
Dateninterpretation und Diskussion
4.4.1
Demografische Angaben
4.4.2
Allgemeine Mediennutzung
4.4.3
Spezifisches Medienverhalten, Selbsteinschätzung und Fragen zur Arbeitsweise
4.4.4
Berufliche Fragen
4.4.4
Lösungsvorschläge
4.4.5
Zusammenfassung
5.
Folgen für die Auszubildenden in der Pflege
5.1
Grundlegendes
5.2
Psychologische Folgen
5.2.1
Operante Konditionierung
5.2.2
Anerkennung und die Prägung der Identität ..
5.2.3
Veränderte Kompetenzen
5.2.3.1
Multitasking
5.2.3.2
Non-lineares Denken
5.2.3.3
Mobile Mediennutzung
5.2.3.4
Multimodale Verarbeitung (Sprache, Ton, Bild)
5.2.3.5
Kollaborative Zusammenarbeit
5.2.3.6
Komplementäre Entwicklungen
5.2.3.7
Fazit
5.3
Biologische Folgen
5.4
Soziokulturelle Folgen
5.5
Zusammenfassung
6.
Maßnahmen
6.1
Reizrahmenorientierte Pflegeausbildungsevaluierung (RoPav)
6.2
Einbau des kollektiven Individualismus in den Unterricht
6.3
Anpassung der Ausbildung an den Homo stimulus
6.4
Einführung eines Pflegeausbildungsbelohnungssystems (PABS)
6.5
Reizrahmenorientiertes Pflegeausbildungsmarketing (RoPam)
6.6
Zusammenfassung
7.
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
ANHANG
Anhang 1: Fragebogen
Anhang 2: Fragen und Auswertung der strukturellen Interviews Pflegeschüler
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Einflüsse auf das Individuum im Zeitalter des kollektiven Individualismus
Abbildung 2:
Kreislauf des Verhaltenskapitalismus
Abbildung 3:
Einbettungsprozess
Abbildung 4:
Formung des Homo stimulus
Abbildung 5:
Rollenkonflikt des Individuums im Zeitalter des kollektiven Individualismus
Abbildung 6:
Häufigkeit der Smartphone-Nutzung
Abbildung 7:
Zeitlicher Aufwand der SP-Nutzung
Abbildung 8:
Präferierte Internetformate
Abbildung 9:
Präferierte Arbeitsweisen
Abbildung 10:
Verbesserungsvorschläge
Abbildung 11:
Einflüsse auf das Individuum im Zeitalter des kollektiven Individualismus
„Es ist völlig ohne Bedeutung, wie sich der Mensch die Welterklärt; fest steht nur, dass er es muss.“
Vorwort
„Der Stillstand gibt immer so lange eine trügerische Ruhe, bis er sich zum Rückstand fortentwickelt.“
Kaum ein gesamtgesellschaftlicher Komplex hat eine größere Bedeutung als der der Pflege, denn dieser muss die Versorgung von Millionen Pflegebedürftigen erbringen. Ob er dies auf Dauer noch zu leisten vermag, muss dagegen hinterfragt werden, denn zu offensichtlich sind die Lücken und Mängel im System. Es gibt daher einen stetigen Optimierungs- und Anpassungsbedarf an eine sich wandelnde Zeit.
Dies bringt gewaltige Herausforderungen mit sich, denn einerseits gilt es, umfangreiche sowie vielschichtige Strukturen und Entwicklungen zu verstehen, andererseits, das Feld auch zu bestellen und die Saat zum Erblühen zu bringen.
Bereits das Erste ist häufig mit größeren Schwierigkeiten verbunden, denn neben den Betrachtungen der vielbenannten Probleme des Themenbereiches wie dem Fachkräftemangel existieren kaum Einordnungen in einen Gesamtrahmen, der ein sich stetig wandelndes, wirtschaftliches und vor allem gesellschaftliches Umfeld, das die Pflegekräfte der Zukunft unabänderlich in Verhalten, Einstellungen, Kompetenzen und auch Persönlichkeit prägt, angemessen berücksichtigt. Zu oft rücken daher Fragestellungen des Pflegebedarfs sowie die Strukturen selbst in den Mittelpunkt, während Prägungsentwicklungen durch eine neue Zeit, die in der Regel fundamental für die Tätigkeitswahl sind, kaum Berücksichtigung finden.
Dabei ist Letzteres vielleicht die größere Herausforderung, denn Pflegekräfte sind, anders als es die Statistiken gelegentlich erscheinen lassen, kein beliebig austauschbares Human-kapital, sondern Menschen, deren Erfahrungen, Konditionierungen oder Erleben darüber mitentscheiden, ob und wie sie einen Beruf erlernen oder dauerhaft ausüben möchten. Die hohen Abbruchquoten in der Pflegeausbildung in Deutschland machen dies mehr als deutlich und sollten hier als ein dringender Hinweis betrachtet werden,1 sich noch eingehender m it den potenziellen Pflegekräften der Zukunft zu befassen.
Es bleibt daher unzweifelhaft sinnvoll, sich am Bedarf oder an den Strukturen zu orientieren, es wäre aber auf der anderen Seite unverzeihlich, Veränderungen bei der Entwicklung der Pflegekräfte selbst zu ignorieren. Hierfür allerdings müssen die Einflüsse auf das Individuum im 21. Jahrhundert und deren Auswirkungen, die in diesem Buch dargestellt werden, Teil der Diskussion und damit auch der Lösung werden. Diese Elemente sollen daher auf den folgenden Seiten in den Mittelpunkt rücken und sich damit der Thematik auf eine andere Art und Weise annähern – nicht von der Seite der Nachfrage nach Arbeitskräften, sondern von der des Angebotes, denn dieses hat sich im Zeitalter des kollektiven Individualismus gewandelt.
Bezüglich des Aufbaus des Buches sei angemerkt, dass das vorliegende Werk, in leicht modifizierter Form,2 zum Erwerb eines akademischen Grades eingereicht, positiv begutachtet und anschließend in einem Rigorosum erfolgreich verteidigt wurde. Die Struktur war daher vorgegeben und blieb grundsätzlich unverändert, erscheint dennoch äußerst zweckdienlich.
Abschließend darf der Hinweis erfolgen, dass nicht jede These oder jeder Lösungsvorschlag den Beifall des Lesers finden muss, jedoch stets die Debatte anreizen soll, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zum einen darzulegen und zum anderen Ansatzpunkte geben zu können, diese auch zu meistern. In der Summe wird es aber vieler Steine bedürfen, um das Mosaik einer besseren und zukunftsfähigen Pflege zu vervollkommnen. Dieses Buch kann – im besten Falle – nur einer davon sein und auf seinen wichtigsten Forschungsgegenstand verweisen, den es interdisziplinär betrachtet: die Pflegekraft selbst, welche mit völlig neuen Reizen und Mechanismen konfrontiert wird, die sie in vielen Fällen zum Homo stimulus werden ließen. Auf diesen neuen Menschen müssen sich auch die Ausbildungen in der Pflege einstellen, denn einen anderen könnte es nicht mehr geben.
Andreas Herteux
1 Ca. 30%. Zur Quellenlage wird auf die folgenden Kapitel verwiesen.
2 Beispielsweise wurde im November 2021 ein neues Sinus-Milieu-Modell veröffentlicht, das eine Aktualisierung der verwendeten Vorlage zur Folge hatte.
1. Einleitung
„Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.“3
Ovid
Der Wandel ist ein stetiger Teil des Lebens. Einem fließenden Gewässer gleich, treibt er stets voran, trägt das Alte ab oder schwemmt es gleich hinweg. Eine solche Veränderung und deren Auswirkungen sollen auch im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, denn das 21. Jahrhundert hält für das Individuum mannigfaltige Umbrüche bereit, die sowohl das Verhalten als auch die Persönlichkeit sowie die Kompetenzen massiv beeinflussen können: Einerseits gibt es einen deutlichen Trend zur Individualisierung, auf der anderen Seite ist ein Zerfall der sozialen Milieus zu beobachten. Das Zeitalter des kollektiven Individualismus ist angebrochen, wird dominiert von Verhaltenskapitalismus, moderner Reizgesellschaft und Milieukämpfen, die teilweise bis in die Intimsphäre des Menschen vordringen – und irgendwo dazwischen findet sich der Mensch, der mehr und mehr Merkmale eines Homo stimulus annimmt. Doch was bedeutet das für die Gesellschaft? Was für das Individuum? Was für die Ausbildung in der Pflege? Auf welche Art und Weise ist mit dieser Entwicklung umzugehen? Das sind die Fragen, denen es sich auf den kommenden Seiten zu stellen sowie zu beantworten gilt.
1.1 Problemstellung
Der Lauf der Welt zeichnet sich durch Veränderung aus. Im Mittelpunkt dieses Buches sollen allerdings nicht die allgemeinen gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Zeitenwandels stehen, sondern die konkreten Auswirkungen auf die Ausbildung in einem bestimmten Bereich: dem der Pflege, was aber zugleich nicht bedeutet, dass grundlegende Erkenntnisse nicht auch auf andere Felder übertragen werden können:
Mit welchen Einflüssen werden daher Auszubildende im Zeitalter des kollektiven Individualismus im 21. Jahrhundert konfrontiert?
Welche Kräfte prägen diese neue Ära?
Wie können diese großen und unübersehbaren Trends den Einzelnen verädern?
Was bedeutet der Homo stimulus für die Pflegeausbildung?
Wie lässt sie sich anpassen?
Das wären die grundsätzlichen Fragen, die in dieser Arbeit gestellt, beantwortet und diskutiert werden sollen. Dabei soll der Wunsch nach der Debatte deutlich betont sein, denn die Themenstellung wagt sich unzweifelhaft auf ein Feld, das bislang noch nicht abgeerntet wurde. Zwar gibt es zahlreiche Studien und Arbeiten, die beispielsweise den Einfluss der modernen Reizgesellschaft auf den Einzelnen beleuchten, allerdings beschäftigen sich diese primär oft mit kritischen Bereichen wie der Sucht nach digitalen Medien, bleiben in der jeweiligen Disziplin verhaftet und bieten selten einen umfänglicheren Blick auf die Gesamtentwicklung. Das vorliegende Werk nutzt dagegen eine holistische, interdisziplinäre, selbstverständlich diskutable Perspektive und verengt sie anschließend auf die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, denn ohne eine solche Bündelung erscheint es weit schwieriger, die umfassenden Einflüsse auf das Individuum ausführlich darstellen zu können.
1.2 Forschungsfrage und Ziel
Der Einfluss des kollektiven Individualismus, letztendlich – wie noch zu zeigen und zu definieren sein wird – ein Sammelbegriff, ist zweifelsfrei mannigfaltig. Aus diesem Grund muss die Fragestellung noch präzisiert werden: Mit welchen Einflüssen des kollektiven Individualismus werden Auszubildende in der Pflege im 21. Jahrhundert konfrontiert, wie ist mit diesen umzugehen und die Ausbildung ggf. zu optimieren?
Dies soll daher der Schwerpunkt der kommenden Seiten sein. Das Ziel ist es daher primär, individuelle und gesellschaftliche Veränderungen der Gegenwart und der nahen Zukunft für die Pflegeausbildung darzulegen, die Folgen zu betrachten und sekundär erste Anpassungsvorschläge zu skizzieren, um auf ein geändertes Auszubildendenverhalten sowie variierende Kompetenzen reagieren zu können. Nicht Ziel ist es dagegen, die Ausbildung, Ausbildende oder Ausbildungsstätten umfassend zu beurteilen, zu kritisieren, zu reformieren oder allgemeine technologische sowie spezifische gesellschaftliche Aspekte in den Vordergrund zu rücken.
In der Summe ist davon auszugehen, dass eine derartige Fragestellung sowohl als theoretisches Objekt der Forschung wie auch für die Praxis der pflegerischen Ausbildung auf Interesse bei den jeweiligen Verantwortlichen stoßen wird und das Tor für weiterreichende Untersuchungen und Debatten öffnen kann.
1.3 Aufbau
Das Buch gliedert sich, nach dieser Einleitung, in einen deskriptiven, einen qualitativen befragenden, einen diskutierenden sowie einen lösungssuchenden Teil. Im beschreibenden Part werden zuerst die Grundlagen des Zeitalters des kollektiven Individualismus (Kapitel 2) vorgestellt. Der Abschnitt beinhaltet daher die Darlegung von Theorien zu den Einflüssen, die auf den Einzelnen im 21. Jahrhundert einwirken. Es folgen Ausführungen zur Historie, zur aktuellen Struktur der Pflegeausbildung in Deutschland sowie eine Entwicklungsgeschichte des Reizrahmens (Kapitel 3). Am Ende soll für den Leser das Stimuliumfeld klar erkennbar und damit ein Teil der Forschungsfrage beantwortet sein. Das 4. Kapitel widmet sich anschließend einer qualitativen Befragung von Auszubildenden in der Pflege sowie deren Auswertung und Einschätzung, um die Wirkungsweise des in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Reizrahmens spezifischer erfassen zu können. Hierfür wurden Auszubildende zum Gesundheits- und Krankenpfleger im letzten Lehrjahr zu ihren Medien-, Lern- und Onlinepräferenzen, Kompetenzen und zur Bewertung ihrer Ausbildung mithilfe einer qualitativen Erhebung befragt. Kapitel 5 beschäftigt sich, unter Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstandes sowie der eigenen Befragung, mit den Folgen des kollektiven Individualismus hinsichtlich Persönlichkeit, Verhaltensmuster und Kompetenzen. Diese Variationen werden dargestellt. Damit wird der zweite Teil der Forschungsfrage beantwortet. Die Abklärung des letzten Parts erfolgt in Kapitel 6. Es präsentiert abschließend erste Lösungsansätze, die wiederum auf den bisherigen Erkenntnissen aufbauen. Ein Ausblick (Kapitel 7), das Literaturverzeichnis sowie zwei Anhänge runden die Arbeit ab.
1.4 Grundannahmen und Einschränkungen
Dieses Werk folgt der allgemeinen Grundannahme, dass variierende, sich schnell wandelnde oder auch sich abzeichnende Rahmenbedingungen Auswirkungen auf das Individuum haben und diese daher Forschungsgegenstand sein müssen, um entsprechende Anpassungen vornehmen zu können, und es nur so möglich sein kann, gesellschaftlich wertvolle und entscheidende Bereiche wie die Ausbildung im Pflegebereich erfolgreich auf die Zukunft auszurichten. Es bejaht damit ausdrücklich die Notwendigkeit der Beobachtung von Veränderungen, Ableitungen aus diesen und eine entsprechende Adaption, auch als präventive Maßnahme. Eine derartige Grundannahme bedarf immer auch einer entsprechenden Basis, die fest verwurzelt im Fundament der Wissenschaftlichkeit sowohl den Blick auf das bereits empirisch Feststellbare als auch auf darauf basierende perspektivische Entwicklungen wirft.
Dabei fließen frühere Arbeiten des Autors mit ein. In der konkreten Sache ist dies für eine hinreichende Beantwortung der Fragestellung auch notwendig, da sich der Part zum Thema des kollektiven Individualismus auf Vorarbeiten der Erich von Werner Gesellschaft4 stützt, die wiederum auf dem wissenschaftlichen Stand aufbauen sowie Lücken in diesem schlie-ßen.5 Selbstverständlich sind auch diese Arbeiten wie jeder Versuch, einen neuen und unbekannten Bereich – in diesem Fall die gesellschaftlichen Entwicklungen im 21. Jahrhundert – zu erschließen, kritisch zu diskutieren und sie wurden und werden es im nationalen und internationalen Rahmen auch.6 Als junger Forschungsstand ist der Fortgang der Debatte noch offen. Die vorliegende Arbeit stellt in diesem Bereich daher eine Fortsetzung und eine konkrete Anwendung an einem spezifischen Beispiel, der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger (bzw. zum/zur Pflegefachmann/-frau), dar. Weiterhin sei darauf verwiesen, d ass im deskriptiven Bereich die deutsche berufliche Ausbildung in den Mittelpunkt rückt. Nicht das Studium, nicht die des Helfers. Es wird daher auf diese nationalen Normen oder Gesetzgebungen Bezug genommen. Dies geschieht, um die Thematik in diesem Bereich nicht ausufern zu lassen. Besagte Beschärnkung ist für die Grundaussage dieser Arbeit allerdings ohne Belang, denn die Einflüsse des kollektiven Individualismus wirken grundsätzlich auf jedes Individuum. Die Darlegungen sowie die Erkenntnisse sollten daher – mit der entsprechenden Justierung - auf andere Vergleichsgruppen übertragbar sein. Die folgenden Seiten verzichten aus Gründen der Lesbarkeit in der Regel auf eine separat gegenderte Sprache, sehen dies aber nicht als eine Herabsetzung einer persönlichen Identität, sondern als schlichte funktionale Anpassung an die Lesegewohnheiten.
3 Angelehnt an Ovid, Fasti 6,771.
4 Die Erich von Werner Gesellschaft ist eine unabhängige Forschungseinrichtung. Homepage: https://www.understandandchange.com/ [zuletzt abgerufen am 02.07.2021].
5 Neben zahlreichen Buchpublikationen, die sich im Literaturverzeichnis finden, auch Fachbeiträge, wie z. B.:
Herteux, Andreas: Behavioral Capitalism – A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence. Journal of Applied Business and Economics, 21(9), 2019, unter: https://doi.org/10.33423/jabe.v21i9.2688.Herteux, Andreas: THE HOMO STIMULUS: THE CREATION OF A NEW HUMAN BEING – SHAPED BY THE STIMULUS SOCIETY AND BEHAVIORAL CAPITALISM – IN THE AGE OF COLLECTIVE INDIVIDUALISM. Int. j. of Social Science and Economic Research, 5(1), 2020, 207–226, retrieved from: ijsser.org/more2020.php?id=14.Herteux, Andreas: SOCIETY IN THE 21st CENTURY: THE THEORY OF THE AGE OF COLLECTIVE INDIVIDUALISM. Int. j. of Social Science and Economic Research, 5(6), 2020, 1466–1475, retrieved from: ijsser.org/more2020.php?id=102.6 Die Erich von Werner Gesellschaft bietet hier einen Auszug der Rezeption: https://www.understandandchange.com/pressandmediareviews/ [zuletzt abgerufen am 02.07.2021].
2. Das Zeitalter des kollektiven Individualismus
„Innerhalb einer Epoche gibt es keinen Standpunkt, eine Epoche zu betrachten.“7
Johann Wolfgang von Goethe
Wie Goethe bereits im einleitenden Zitat anklingen lässt, ist die Beschreibung eines Zeitalters aus diesem heraus mit erheblichen Mühen verbunden, wenngleich, und hier irrt der Dichter, nicht unmöglich. Voraussetzung hierfür ist es, das Fundament, die Säulen und die Steine des Tempelbaus zu kennen und sie anzuordnen. Dies ist allerdings etwas, was im 21. Jahrhundert leichter fällt als zu dem Zeitpunkt, als Goethe seine Worte niederschrieb, denn heute ist es mit weitaus weniger Schwierigkeiten verbunden, mannigfaltige Informationen in Erfahrung zu bringen und sie auszuwerten.8
Besagter Fortschritt macht es daher möglich, das folgende Kapitel als erste Beschreibung einer neuen Epoche zu deuten oder auch nur als umfassende Bündelung und Ordnung von Einflüssen auf die Auszubildenden in der Pflege zu verstehen, die prägend für Verhalten, Kompetenzen und das Selbstbild sind. Dass, und dies sei zusätzlich angemerkt, eine neue Theorie einer Ära immer auf Kritik im Detail treffen muss, erscheint dabei nicht weiter erwähnenswert. Selbstverständlich kann der Tempel auch auf eine andere Art und Weise errichtet werden; trotzdem ändert sich weder etwas an dem Fundament noch an den Säulen oder Bausteinen, denn diese stehen bereits zur Verfügung – oder einfacher artikuliert: gleich, wie unter welchen Begriffen die Einflüsse auf den Einzelnen auch zusammengefasst sein mögen, sie existieren. Nur, ist es nicht eine Aufgabe der Wissenschaft, mögliche Zusammenhänge zu untersuchen, Systematiken zu erkennen, Ordnungen darzulegen und zur Diskussion anzubieten?9 Hierzu gehört auch immer das