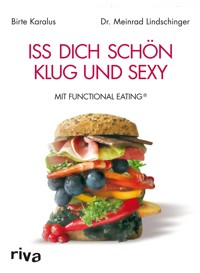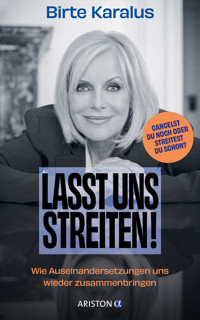
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ariston
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rosarot ist keine Option!
Eine Aufforderung zum Streit? Wird öffentlich nicht schon genug gestritten, mit schrillen Tönen auf der einen Seite und ängstlichem Schweigen auf der anderen? Mit Schlammschlachten in den sozialen Medien und Sprachlosigkeit in vielen Familien? So kann es nicht weitergehen! Unser Miteinander und damit am Ende auch unsere Demokratie stehen auf dem Spiel, wenn wir Kontroversen nicht mehr lösungsorientiert austragen.
Dies ist kein Buch über oberflächliche »Streittechniken«. Es ist ein Buch für eine andere Haltung zum Streit – und damit zu unserem Gegenüber. Denn streiten müssen wir, um uns in einer vielfältigen Gesellschaft auf gemeinsame Werte und Regeln zu einigen. Wir alle haben es in der Hand zu gestalten, in welcher Gesellschaft wir leben! Wir sehnen uns nach Zusammenhalt. Der Appell der bekannten Moderatorin lautet: Tun wir etwas dafür!
- Sie bringt Streitparteien an einen Tisch: TV-Moderatorin und Mediatorin Birte Karalus
- Ob Familienstreit, politischer Konflikt oder harte Verhandlung: Birte Karalus verrät ihre Erfolgsgeheimnisse zur Lösung festgefahrener Situationen
- Mit einem Nachwort von Arun Gandhi - Autor des Bestsellers »Wut ist ein Geschenk«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Rosarot ist keine Option!
Eine Aufforderung zum Streit? Wird öffentlich nicht schon genug gestritten, mit schrillen Tönen auf der einen Seite und ängstlichem Schweigen auf der anderen? Mit Schlammschlachten in den sozialen Medien und Sprachlosigkeit in vielen Familien? So kann es nicht weitergehen! Unser Miteinander und damit am Ende auch unsere Demokratie stehen auf dem Spiel, wenn wir Kontroversen nicht mehr lösungsorientiert austragen.
Dies ist kein Buch über oberflächliche »Streittechniken«. Es ist ein Buch für eine andere Haltung zum Streit – und damit zu unserem Gegenüber. Denn streiten müssen wir, um uns in einer vielfältigen Gesellschaft auf gemeinsame Werte und Regeln zu einigen. Wir alle haben es in der Hand zu gestalten, in welcher Gesellschaft wir leben! Wir sehnen uns nach Zusammenhalt. Der Appell der bekannten Moderatorin lautet: Tun wir etwas dafür!
Zur Autorin:
Birte Karalus war eine der erfolgreichsten Talkmasterinnen im deutschen Fernsehen. Über zwei Jahrzehnte stand sie vor Fernsehkameras und auf den relevanten Bühnen von Wirtschaft und Politik.
Heute ist Birte Karalus ausgebildete Mediatorin, Verhandlungsführerin und Peacemaker. Als Kommunikationsexpertin ist sie in internationalen Verbänden, Parteien und Unternehmen mit hochkarätigen Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft genau dafür zuständig: das Potenzial in Konflikten aufzudecken und zu fördern, Meinungen zu moderieren und gemeinsame Lösungen zu erstreiten.
Birte Karalus
LasstunS streiten!
Wie Auseinandersetzungen uns wieder zusammenbringen
Cancelst du noch oder streitest du schon?
Mit einem Nachwort von Arun Gandhi
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Buch auf das Gendern verzichtet. Auch darüber kann man – wie über fast alles – konstruktiv streiten. Im Buch finden Sie meine Position dazu. Fühlen Sie sich also bitte angesprochen, auch wenn Sie selbst gendern würden.
© 2024 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Unter Mitarbeit von Dr. Petra Begemann, Bücher für Wirtschaft + Management, www.petrabegemann.de
Illustrationen: © Ferreira Studio 2024, Inh. João Ferreira.
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur Zürich
unter Verwendung eines Fotos von © Manfred Baumann
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-30657-1V001
Inhalt
Prolog Rosarot ist keine Option
1 Lob des Streits Über die Kraft, die alles schafft
7 Argumente für Streit als positive Kraft
Warum Streiten ein Imageproblem hat
Alles beginnt mit einem Konflikt mit uns selbst
Vorsicht Satire: Kurze Anleitung für schlechtes Streiten
Auseinandersetzen, um zusammenzufinden: konstruktives Streiten
2 Vom Streit zum Zank, zum Hass, zur Tat Die Gesellschaft der Unkultur vor dem Kollaps
Von HB-Männchen umgeben? Woher die Wut kommt
»Factfulness« – den Tatsachen ins Auge blicken
Medien machen uns die Welt, die uns nicht gefällt
Die große Enttäuschung: Stimmen unsere Maßstäbe noch?
Die große Verschwörung: Wir glauben die Geschichte, die uns am besten gefällt
3 Die Entdeckung der Freundlichkeit Weil ein Lächeln alles verändert. Sofort
Magie der Freundlichkeit: Klimawandel im Miteinander
Vertrauensvorschuss: Verbale Abrüstung
Freundlichkeit ist nichts für Schwache
Furchtbar oder fruchtbar – die Haltung macht den Unterschied
Wie geht Freundlichkeit?
4 Zuhören Die Königsdisziplin der Freundlichkeit
Zuhören ist anstrengend und nichts für Egogetriebene
Zuhören ist eine effektive Lösungsstrategie
Wer zuhört, bewirkt mehr
Zuhör-Sünden: Von Tabu-Sätzen und vier Ohren
5 Die Feinde des Miteinanders Von Cancel-Culture bis Fake News
Cancel-Culture: Die Inquisition ist zurück
Political Correctness: Zensur statt Zugewandtheit
»Wir« gegen »die«: Wenn das Stammesdenken regiert
Identitätspolitik: Welche Mythen, wem zum Nutzen?
Fake News: Die neue Herrschaft der Lüge
6 Zusammenbringen, was zusammengehört Eine neue Streitkultur der Freundlichkeit
Was uns bis hierhergebracht hat, wird uns nicht weiterbringen
Streitbar für eine neue Streitkultur: Warum es sich lohnt
Die eigene Stärke entdecken
Die Macht der Freundlichkeit nutzen
Sie machen den Unterschied
Epilog Die Kraft der Freundlichkeit
Endnoten
PrologRosarot ist keine Option
Mein Name ist Birte Karalus. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Konsensfinderin. Mein Anliegen ist es, Menschen zusammenzubringen und die bestmögliche Alternative in Konflikten zu finden. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch von meiner Talkshow Ende der Neunzigerjahre, in der die »Fetzen flogen«. Und heute ein Buch mit dem Titel »Lasst uns streiten!«? Wie so vieles, hat auch dies eine Geschichte. Lassen Sie mich erzählen.
Das Ziel: streiten, um zu lösen
Wenn die herausfordernde Zeit der Coronapandemie für mich etwas Gutes hatte, war es, dass ich seit einer gefühlten Ewigkeit nun über zeitlichen Freiraum verfügte. Zum ersten Mal wurde ich nicht durch einen komplett durchgetakteten Terminkalender getrieben. Ich konnte reflektieren, was war, und vor allem, was es für mich beruflich zukünftig sein sollte. Mit Kollegen, Kunden und Freunden konnte ich mich über die eigenen Stärken und Schwächen austauschen. Übereinstimmend war die Meinung: »Hol Birte dazu, wenn die Situation verhärtet ist, wenn es scheinbar kein Vor oder Zurück gibt. Sie schafft es, ein Klima herzustellen, in dem auch die ärgsten Gegner gesichtswahrend miteinander reden können. Sie hat ein Gespür für Menschen und Auswege.«
Ein Gespür entwickelt sich – entwickelt sich nicht von heute auf morgen und entwickelt sich vor allem dann, wenn man selbst tief eintaucht in das Thema und eigene, nicht selten schmerzhafte, Erfahrungen macht. Beim Streiten holen sich die meisten von uns die ersten Erfahrungen sicherlich in frühen Kindertagen im Kinderzimmer. Das Spielzeug des anderen war immer das spannendste. Und jeder von uns hat den verzweifelten Ruf der Mutter noch im Ohr: »Hört endlich auf zu streiten!« Was natürlich immer nur kurzfristig wirkte.
Zwei Jahre Ausnahmezustand:
eine harte Schule.
Seit vielen Jahren bin ich nun auf internationalen Bühnen für Wirtschaft, Industrie und Politik als Talkerin tätig und streite wirklich gerne um gute, um beste Argumente. In all dieser Zeit bekam ich einen intensiven Einblick in die Entstehung und Dynamik von Auseinandersetzungen innerhalb von Parteien, Institutionen und Konzernen. In dieser Zeit erlebte ich, wie schwer man sich auch in großen Unternehmen tat, eine gute Konfliktkultur zu schaffen, und wie dadurch aus kleineren Konflikten große Krisenherde werden konnten. Ich verstand, wie wichtig die Perspektive von außen zur Klärung von Konflikten sein konnte. Also entschied ich mich, mir hier mehr Wissen anzueignen: Mediation, Verhandlungsführung, Peacemaking.
Die nur scheinbar paradoxe Lösung:freundlich sein – und streitbar!
Zu dieser Zeit hatte ich auch fast 20 Jahre vor Fernsehkameras gestanden. Neben der Moderation der Nachrichten, dem Sport, Autosendungen und einigen anderen Formaten war das die vorausgegangenen zwei Jahre die Moderation einer erfolgreichen und in jeglicher Hinsicht streitbaren Talkshow Ende der Neunzigerjahre. Hier prallten unterschiedliche Ansichten und Meinungen lautstark und wie am Fließband aufeinander, mit Gezeter und Geschrei. Und nicht zu vergessen der dazu gehörende analoge Shitstorm, der es in sich hatte: kurzgefasst, zwei Jahre Ausnahmezustand. Hier hatte ich nicht die komfortable Ausgangsposition, die Perspektive der Metaebene einzunehmen. Hier war ich im Zentrum des Konflikts. Das hat mich in jeglicher Hinsicht bis heute sehr geprägt. Aus dieser Zeit stammt unter anderem mein Gespür für Dynamiken in Konflikten und mein Wahrnehmungsradar für menschliches Verhalten.
Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine Offensive der Freundlichkeit, kombiniert mit einer Revitalisierung der Streitkräfte. Auch wenn es sich paradox anhören mag: Ich glaube, dass es wichtig ist zu streiten, sich auseinanderzusetzen, um gut miteinander in Frieden leben zu können.
Denn uns muss einiges gelingen: Pandemie, Digitalisierung, Globalisierung, das Schützen unserer Umwelt. Kriege rücken an uns heran. Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Nichts ist mehr selbstverständlich. Dass uns dies Angst macht und wir uns reflexartig aggressiv verhalten oder uns zurückziehen, ist nachvollziehbar. Doch so eskalieren Auseinandersetzungen, Lösungen sind kaum noch erreichbar, Beziehungen und Bindungen zerbrechen – die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft ist greifbar. Wenn wir aus dieser Sackgasse herauswollen, müssen wir in Auseinandersetzungen hinein: müssen Klarheit finden, um Entscheidungen zu treffen, mit deren Konsequenzen wir noch lange leben müssen. Wir müssen uns begegnen, mit allen Ecken und Kanten. Wohlwollend kann uns das gelingen.
Gemeinsame Werte und Spielregeln verhindern Spaltung.
Ich nehme daraus zwei Erkenntnisse mit. Die erste: Rosarot ist keine Option, wenn wir miteinander auskommen wollen. Ein falsches Harmoniebedürfnis, der wohlbekannte imaginäre Teppich, den man nur allzu gerne über Konflikte ausbreiten möchte, um sie unsichtbar zu machen, verhindert nicht, dass sie bleiben. Wahrscheinlich werden sie sogar größer. »Streit« ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir wollen oder nicht. Ein Streit kann uns auf immer entzweien, wenn wir in eine Eskalationsspirale von Vorwürfen und Gegenvorwürfen geraten und keinen Ausweg mehr daraus finden. Genauso kann ein Streit uns enger verbinden und sogar zusammenschweißen, wenn wir uns respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Zum Streit gibt es keine Alternative. Menschen sind verschieden, in ihren Anliegen, Werten, Lebensentwürfen. Um uns auf Gemeinsamkeiten zu einigen, müssen wir über unsere Positionen reden – wir müssen uns auseinandersetzen, um zusammenzufinden. Kurz: Wir müssen streiten! Nur in Diktaturen und gleichgeschalteten Systemen gibt es (offiziell) keinen Streit. Hinter den Kulissen brodelt es dann umso stärker. Das gilt auch im Privaten.
Deshalb: Lassen Sie uns streiten, oder wie ich es lieber ausdrücke: Seien wir bereit, uns auseinanderzusetzen! Diesen Appell braucht es heute mehr denn je. Unsere Gesellschaft zersplittert in immer mehr Gruppen und Grüppchen, die alle zu ihrem Recht kommen wollen. Ohne konstruktive Auseinandersetzung werden wir keine gemeinsame Basis finden. Wir müssen uns einigen – auf Werte und auf Regeln, die für alle gelten. Doch scheinen wir vom konstruktiven – lösungsorientierten – Streiten weiter entfernt denn je. In einem Klima der Krisen und der Verunsicherung zerfällt das öffentliche Auseinandersetzen in schrille Misstöne und harsche Angriffe auf der einen und ängstliches Schweigen auf der anderen Seite. In den sozialen Medien dominiert eine laute Minderheit die Mehrheit, die sich lieber gar nicht mehr äußert, um nicht zur Zielscheibe wüster Angriffe zu werden. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich immer weiter. Lügen und Verleumdungen sind salonfähig geworden, selbst in der großen Politik. Autoritäten bröckeln, Vertrauen schwindet. Wem soll man noch trauen? Was »darf« man noch sagen?
Meine zweite Erkenntnis ist eine starke Wirkungsmacht, die wir wieder oder vielleicht auch neu entdecken müssen: Freundlichkeit. Sollte das in Ihren Ohren zu einfach, womöglich sogar banal klingen, treten Sie einen Moment zurück und erinnern Sie sich an Ihren letzten Konflikt. Wie hätte sich das Szenario verändert, wenn Sie Ihrem Gegenüber mit etwas mehr Freundlichkeit begegnet wären? Freundlichkeit ist eine hochkomplexe, vielfach unterschätzte und in einer Ego-Gesellschaft akut bedrohte Tugend. Hinzu kommt ein zweites Erfolgsmoment richtigen Streitens: zuhören. Sich öffnen, dem anderen seine Aufmerksamkeit schenken. Weder rhetorische Kniffe noch manipulative Taktiken führen einen Konflikt zum Erfolg – wenigstens dann nicht, wenn man »Erfolg« als einen Ausgang definiert, der die Beziehung aufrechterhält und mit dem beide Seiten dauerhaft leben können. Das muss nicht immer eine harmonische Lösung sein. Das kann auch bedeuten: In diesem Punkt werden wir uns nicht einig. Besinnen wir uns daher auf das, was uns (dennoch) verbindet.
Wir sehnen uns nach Zusammenhalt.Tun wir etwas dafür!
Ich bin überzeugt: Wir alle teilen die Sehnsucht nach einem friedvollen Miteinander – als Eltern, Beziehungspartner, Kollegen, Teilnehmer im Straßenverkehr, als Nachbarn und Freunde. Lassen Sie uns deshalb konfliktfähig und damit widerstandsfähig werden – in aller Freundlichkeit!
»Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten,
sondern jene, die ausweichen.«
Marie von Ebner-Eschenbach
1Lob des Streits
Über die Kraft, die alles schafft
Braucht es das wirklich: ein »Lob des Streits«? Wird nicht schon mehr als genug gestritten, in den sozialen Medien, in den Talkshows, in der großen Politik und auf der Straße? Längst macht sich Überdruss breit angesichts des Dauergezänks allerorten. Die Quoten der Talkshows sinken, weil mehr und mehr Zuschauer genug haben von vorhersehbaren Wortgefechten in immer gleicher Besetzung. Viele von uns kämpfen dazu noch mit den Irritationen oder gar Verwüstungen, die der Streit über Coronamaßnahmen in vielen Freundschaften und Familien hinterlassen hat. Und schon gibt es neue Krisen und neue Streitanlässe: Krieg in Europa und im Nahen Osten, Klimakleber und Migrationsfrage, Gendern und Cancel-Culture, Rechtspopulismus und linker Aktivismus – um nur einige zu nennen. Viele Alltagsgespräche gleichen inzwischen einem Tanz um rohe Eier: Heikle Themen werden lieber ausgespart beim Austausch mit dem Nachbarn, auf dem Betriebsfest oder beim Familientreffen. Zu groß ist die Sorge, unversehens einen Streit zu provozieren. Das Leben ist schließlich anstrengend und kompliziert genug.
Statt »auf den Tisch« alles »unter den Teppich«
So verständlich diese Reaktion ist (und ich ertappe mich gelegentlich selbst dabei): Wirklich gut fühlt sich das nicht an. Eine erzwungene Harmonie ist nicht befreiend, sondern belastend. Unterdrückte Konflikte sind wie Wasserbälle, die man nur eine bestimmte Zeit unter die Oberfläche pressen kann. Dann poppen sie mit Macht wieder hoch, manchmal an einer Stelle, an der man es gar nicht erwartet. An Weihnachten oder im Urlaub ist Hochkonjunktur für Beziehungsstress. In Familien bricht sich der aufgestaute Groll zum Beispiel oft Bahn, wenn es darum geht, das Erbe aufzuteilen. Häufig wird mit einer Erbitterung um den Nachlass gestritten, die sich nur damit erklären lässt, dass hier alte Rechnungen beglichen werden. Da geht es allenfalls am Rande um die verwohnte Immobilie oder den Biedermeierschrank der Urgroßmutter, eigentlich geht es darum, dass man sich schon immer gegenüber den Geschwistern zurückgesetzt fühlte und nun eine Kompensation dafür beansprucht. Hätte man sich zu Lebzeiten mit den Eltern auseinandergesetzt, wären einem selbst vielleicht jahrelanger Kummer und der Familie ein endgültiger Bruch erspart geblieben. Doch statt zu reden, hat man stumm gegrollt, oft jahrelang.
Was man unter den Teppich kehrt, wird früher oder später zur Stolperfalle.
Unterdrückter Streit schafft nicht Harmonie, sondern Unbehagen. Das gilt in der Familie wie in der Gesellschaft insgesamt. More in Common, eine gemeinnützige Organisation, die sich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in den westlichen Demokratien beschäftigt, veröffentlichte 2023 eine Studie unter dem Titel »Zukunft, Demokratie, Miteinander: Was die deutsche Gesellschaft nach einem Jahr Preiskrise umtreibt«. Auch wenn es angesichts von Inflation und explodierenden Energiepreisen nicht zu den von manchen befürchteten (und von Populisten sogar herbeigewünschten) Massendemonstrationen gekommen ist, zeichnet die Studie ein düsteres Bild. Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg sagen 80 Prozent der Befragten, in Deutschland gehe es »eher ungerecht« zu. Bei der Frage nach den hervorstechendsten »Eigenschaften« der deutschen Gesellschaft belegt »gespalten« den Spitzenplatz (54 Prozent), gefolgt von »bürokratisch« (52 Prozent) und »unfähig« (22 Prozent). Als »erfolgreich« empfinden nur noch ganze 5 Prozent unser Land. Insgesamt entsteht das besorgniserregende Bild eines rückständigen und in sich zerrissenen Gemeinwesens – und das in einem der nach wie vor reichsten Länder der Erde mit einem im internationalen Vergleich vorbildlichen Sozialsystem. Die Trendforscher rund um Matthias Horx sprechen sogar von einer »Zukunftsdepression«, die weite Kreise der Bevölkerung angesichts miteinander verzahnter globaler »Omnikrisen« erfasst habe.1 Damit nicht genug. Gleichzeitig befinden wir uns in einer akuten Vertrauenskrise, was gesellschaftliche Institutionen angeht: Der Bundesregierung und den Wirtschaftsvertretern vertraut nur noch eine Minderheit (29 bzw. 21 Prozent). Die Kirchen haben noch mehr abgewirtschaftet und genießen auf dem vorletzten Platz des Rankings kaum mehr Vertrauen als die Regierung Russlands, sprich Putin. Großes Vertrauen schenkt man nur noch im engen privaten Umfeld seinen Angehörigen und Freunden (92 Prozent).2
Merkwürdige Zeiten: Konfliktscheu auf der einen, Polarisierung auf der anderen Seite.
All das passt schlecht zur relativen Grabesruhe in der Öffentlichkeit, die im politischen Bereich Anfang 2024 ein Ende hatte. Hunderttausende gingen auf die Straße, nachdem CORRECTIV, ein spendenfinanziertes Medienhaus, ein Treffen publik gemacht hatte, bei dem Rechtsextreme und AfD-Politiker Pläne zur »Remigration« diskutierten. Doch bei den Demonstrationen für unsere Demokratie trafen sich Gleichgesinnte. Gestritten – im konstruktiven Sinne – wird auf Kundgebungen nicht, eine Auseinandersetzung um politische Positionen findet nicht statt. Heftig gestritten wird vor allem in den sozialen Medien, von einer lauten und oft unflätigen Minderheit. Gestritten wird auch in der Politik, aktuell in einer Dreierkoalition, deren Sprunghaftigkeit und Gezänk viele an ihrer Kompetenz und Handlungsfähigkeit zweifeln lässt. Gestritten wird, wie erwähnt, in Talkshows, meist ohne neue Erkenntnisse und mit schalem Nachgeschmack. Jenseits dieser öffentlichen Bühnen mag man sich privat kaum noch streiten, trotz der vielen denkbaren Anlässe und trotz der stillen Verzweiflung in unserem Land. Das ist kein Phänomen der unmittelbaren Gegenwart. Schon 1990 attestierte der Sozialwissenschaftler Claus Leggewie der Gesellschaft »Konfliktscheu bei hoher Bereitschaft zur Polarisierung«.3 Inzwischen aber eskaliert dieses Phänomen. Man muss kein Wissenschaftler sein, um das private Harmoniebedürfnis vieler Bürgerinnen und Bürger mit einem Gefühl der Überforderung in einer immer komplexeren Umwelt in Verbindung zu bringen. Je mehr vertraute Sicherheiten wegbrechen, desto verführerischer ist die Strategie der bekannten drei Affen, die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen, sondern offenbar einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Das rheingold Institut für Marktforschung kommt in einer aktuellen Studie zu ganz ähnlichen Befunden wie More in Common und resümiert die Ergebnisse von Tiefeninterviews und repräsentativer Onlinebefragung unter der Überschrift »Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit«. Von der Politik enttäuscht, ziehen sich viele Menschen ins Private zurück. Salopp gesagt: Wir machen es uns zu Hause schön, um das Elend da draußen zu vergessen. Auf der Strecke bleibt dabei unter anderem eine »konstruktive Gesprächskultur«, so Institutsleiter Stephan Grünewald. Das wirke bis ins Private hinein: »… die Gemeinschaften [werden] immer hermetischer und grenzen sich von Andersdenkenden ab. Menschen, die anstrengend sind, weil sie eine andere Meinung oder Haltung vertreten, werden oft aussortiert.«4
Keine Lösung: der Rückzug in die Blase Gleichgesinnter.
Alles in allem ein unschönes Bild. Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Ich fühlte mich ein wenig ertappt. Aber geht es uns gut dabei? Genauer gefragt: Geht es Ihnen gut? Bleibt nicht eher eine kribbelige Unruhe, eine gärende Sorge, eine leise Wut, die sich mal besser, mal weniger gut verdrängen lässt? Und wäre es da nicht klüger, öfter über brisante Themen zu reden und sich auseinanderzusetzen – in der Hoffnung, gemeinsam neue und geeignetere Lösungen zu finden? Oder auch, um festzustellen, dass wir in unseren Positionen gar nicht so weit auseinanderliegen, wie wir befürchtet haben? Manche Konflikte sind ja wie der Scheinriese Tur Tur in der Augsburger Puppenkiste – je weiter der Bogen ist, den man um sie schlägt, desto größer und bedrohlicher wirken sie. Nähert man sich ihnen, schrumpfen sie auf Normalmaß und man kann mit ihnen umgehen. An manchem Aufreger aus der Vergangenheit wundert uns heute ohnehin nur noch eines: wie groß die Aufregung einst war. Im Vorfeld der Anschnallpflicht im Auto beispielsweise flogen die Fetzen. Von gefährlichen »Fesseln« war Mitte der Siebzigerjahre die Rede, von Freiheitseinschränkungen, sogar Busenschäden wurden befürchtet. Mutmaßungen und Gerüchte – kaum jemand war interessiert, konstruktiv zu streiten. Wie das geht, werden wir uns später noch genauer anschauen.
Viele, wenn nicht die meisten Konflikte wurzeln meiner Erfahrung nach im Mangel an Kommunikation, in der Familie ebenso wie in der Welt der Unternehmen oder der Politik. Würden wir mehr (respektvoll) streiten, ginge es uns allen am Ende besser. In Konflikten besteht eine meiner Hauptaufgaben darin, Menschen wieder ins Gespräch miteinander zu bringen, sodass die Visiere hochgeklappt werden, bisher Ungesagtes endlich auf den Tisch kommt und bereits Gesagtes in einen Kontext eingeordnet werden kann. Das erfordert Mut von den Beteiligten, und es ist oft schmerzhaft, weil sich hier natürlich auch Emotionen entladen. Meine Aufgabe ist dann erfolgreich, wenn es mir gelungen ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der selbst die härtesten Gegner sich zuhören, ohne reflexhaft zurückzuschlagen.
Ich erinnere mich an einen Konflikt in einem Familienunternehmen. Das hochbetagte Familienoberhaupt hatte große Schwierigkeiten, das Ruder an die jüngere Generation zu übergeben. Es gab fast täglich heftige, unschöne und persönliche Auseinandersetzungen. Ein sehr gewinnbringender Verkauf drohte zu scheitern, an Altersstarrsinn, wie die Nachfolger glaubten: Der »Alte« gönne den »Jungen« nicht den finanziellen Erfolg. In einem aggressiven Schlagabtausch kamen unvermittelt die Gefühle des Loslassens, des Verlusts und auch der Trauer des Seniors auf den Tisch. Sehr zum Erstaunen der Jüngeren. Über Gefühle wurde weder in der Familie und schon gar nicht in der Firma gesprochen. Als der Patriarch es endlich schaffte, seinen Kindern diese sehr persönliche Perspektive seines Widerstandes zu zeigen, war der Anfang für einen gemeinsamen Neuanfang gemacht.
Mangelnde Kommunikation kostet Vertrauen.
Ein anderes eindrückliches Beispiel aus meiner Praxis ist ein schwelender Konflikt in einem Großunternehmen, das drei mittelständische Firmen aufgekauft hatte. Die Mittelständler waren in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld sehr erfolgreich, nicht zuletzt dank gut ausgebildeter und hoch motivierter Mitarbeiter. Doch nach der Übernahme wendete sich das Blatt. Immer mehr Mitarbeiter schalteten nicht nur einen Gang, sondern gleich ein paar davon herunter. Viele hatten augenscheinlich innerlich gekündigt. Dadurch drohte die gesamte Zusammenarbeit zu scheitern. Ich wurde in die kleineren Unternehmen eingeladen, um dort in Vorabgesprächen herauszufinden, was nach der Übernahme passiert war. Nun saßen mir die Mitarbeiter der Firmen gegenüber und schilderten mir ihre Perspektive des Vorgangs. Der Mutterkonzern lud anschließend zu einem großen Meeting ein. Das Setting ähnelte einer Talkrunde, da hier die Beteiligten offen gehört werden sollten. Im Publikum saßen die Kollegen. Ich durfte das Gespräch moderieren. Was ich bewundere, ist, dass der CEO den Konflikt zur Chefsache gemacht hatte, Verantwortung übernahm und die Angelegenheit nicht delegierte. Konfliktfähigkeit ist eine starke Führungsqualität. Relativ schnell stellte sich die Ursache für den Stimmungsumschwung heraus. Die Belegschaften der aufgekauften Firmen gingen von einer feindlichen Übernahme aus, die früher oder später mit ihrer Kündigung enden würde. Niemand hatte ihnen erklärt, dass ihre Unternehmen als Erfolgsmodelle genau wie bisher erhalten bleiben sollten. Niemand hatte sie im Großkonzern willkommen geheißen. Ganz nach dem alten Motto: »Schweigen ist Lob genug«.
Mangelnde Kommunikation und Missverständnisse sind oft der Anfang von Konflikten, die sich in einer Eskalationsspirale nach oben schrauben. Im Nachhinein kann sich dann niemand mehr so richtig daran erinnern, womit alles begann. »So simpel kann es doch wohl nicht sein!«, war die erstaunte Erkenntnis in der Gesamtorganisation. Gleich anschließend wurde die Klarstellung über die Gründe des Firmenkaufs ebenfalls zur Chefsache gemacht. Nichts ist eben selbstverständlich! Miteinander zu reden, auch kontrovers, bringt uns im Allgemeinen weiter. Doch das ist nur ein Verdienst des Streits – eines unter vielen.
7 Argumente für Streit als positive Kraft
Es ist nicht der Streit, der Probleme schafft, es ist die Art, wie wir streiten. »Stellen Sie sich eine Kultur vor, in der der Streit als Tanz gesehen wird, die Streitenden als Performer und es das Ziel ist, so ausgeglichen und schön wie möglich zu tanzen«, schreiben die Sprachwissenschaftler und Kognitionsforscher George Lakoff und Mark Johnson in ihrem Buch Metaphors We Live By. Vorher haben sie aufgezeigt, dass wir im Alltag häufig in Kriegsmetaphern über Streit sprechen. Wir »schmettern Argumente ab«, »treffen ins Schwarze«, wir »gehen zum Angriff über« und so weiter.5 Sprache ist sehr verräterisch. Im Deutschen können wir in einem »Wortgefecht«(!) jemanden sogar »mundtot« machen. Offensichtlich geht es uns beim Streiten normalerweise ums Siegen oder Unterliegen, es gibt folglich Gewinner und Verlierer. Wir kämpfen, wenn wir streiten, und niemand verliert gern. Die Vorstellung vom »Tanz« wirkt da erst einmal befremdlich. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass ein Streit nicht zwingend verbrannte Erde hinterlassen muss, sondern respektvoll, mit echtem Interesse an der Meinung des anderen und der Bereitschaft zum Austausch erfolgen kann, rücken die Vorteile des Streitens ins Blickfeld. Dann wird der Streit zum kooperativen Event, zu einer Art Tanz eben. Würdigen wir also den Streit als Kraft, die alles schafft:
Durch Streiten bilden und entwickeln wir unsere eigene Identität. Um uns zu vergewissern, wer wir sind, müssen wir uns gelegentlich an anderen reiben und von ihnen abgrenzen. Ist es da erstaunlich, dass wir gerade in Lebensphasen, in denen wir Entwicklungssprünge machen, auch besonders streitbar sind? Das gilt für die frühkindliche Trotzphase ebenso wie für die Pubertät oder mögliche Krisen in der Lebensmitte. Passend dazu hat die Entwicklungspsychologie das negativ gefärbte »Trotzphase« inzwischen durch den Begriff der »Autonomiephase« ersetzt, in der das Kind erstmals die Grenzen der Selbstbestimmung auslotet.Es ist nicht der Streit, der Probleme schafft.Es ist die Art, wie wir streiten.
Durch Streiten lernen wir etwas Neues. Ein Streit fordert uns heraus, stellt alte Gewissheiten infrage. Im besten Fall lernen wir in einer Auseinandersetzung etwas dazu, gewinnen neue Einsichten und Erkenntnisse über die Welt, das Gegenüber und nicht zuletzt auch über uns selbst. Das bleibt auch das Ideal jeder öffentlichen Debatte – ein Ideal, das wir gemeinsam wieder zum Leben erwecken können.Streit bahnt Innovationen den Weg. Jede Neuerung trifft auf Gegner, die das Alte verteidigen. Ohne Streit bliebe alles auf ewig, wie es ist. Das gilt für den wissenschaftlichen Disput, für die unternehmerische Debatte, für eine politische Auseinandersetzung und selbst für die private Diskussion darüber, ob man die Stelle wechseln, das Haus renovieren oder Weihnachten mal ganz anders feiern sollte als in den letzten Jahren.Ohne Streit keine Demokratie. (Pseudo-)Harmonie gibt’s nur in Diktaturen.
Nur durch Streiten können wir zu einem Konsens finden. Sosehr wir uns nach Harmonie sehnen: Nur in brutalen Diktaturen und Dystopien wie Orwells 1984 sind sich alle immer einig. Einigkeit macht aber nur dann stark, wenn sie nicht erzwungen ist, sondern freiwillig eingegangen wurde. In einer offenen Gesellschaft treffen zwangsläufig unterschiedliche Meinungen, Werthaltungen und Lebensentwürfe aufeinander. Wir müssen uns auf Spielregeln einigen, auf unantastbare Basiswerte (wie die Menschenrechte oder unser Grundgesetz), aber auch auf Kompromisse in weniger grundsätzlichen Fragen. Das geht nur, indem wir uns auseinandersetzen. Ohne Streit keine Demokratie. Und mit der Sehnsucht nach Harmonie und Einigkeit wäre es schnell vorbei, wenn wir selbst dafür Unterdrückung und Gleichschaltung in Kauf nehmen müssten. Mögen diese auch erst »die anderen« treffen, irgendwann holen sie in einer autokratischen Gesellschaft jeden ein.Streit räumt Missverständnisse aus. Die häufigste Form der Kommunikation sei das Missverständnis, wird scherzhaft behauptet. Was ich meine und was ich sage, was beim anderen davon ankommt und wie der das dann vor dem Hintergrund seiner persönlichen Prägung und Erfahrung interpretiert – auf diesem Weg gibt es jede Menge möglicher Stolpersteine. Wie oft haben Sie schon gesagt, »Das habe ich überhaupt nicht gemeint!« und sind aus allen Wolken gefallen, wenn Ihr Gegenüber aus (scheinbar) nichtigem Anlass heftig zu streiten begann? Es ist besser, früh zu streiten als zu spät, bevor sich erste Irritationen zu massivem Groll und Zorn ausgewachsen haben.Streiten belebt, Streit kann sogar Spaß machen. Eine lebhafte Diskussion vertreibt jede Langeweile. Eine Tischrunde, in der sich alle einig sind, plätschert vorhersehbar dahin, im schlimmsten Fall mit dem immer gleichen Small Talk über Fußball, Urlaub, Kunst und Co. Mit dieser einlullenden Oberflächlichkeit ist es schnell vorbei, wenn ein kontroverses Thema aufkommt. Plötzlich sind alle wieder wach, werden emotional und intellektuell herausgefordert.Wer sich Versöhnung zutraut, wächst am Streit.
Streit schweißt zusammen. Mit etwas Lebenserfahrung betrachtet man symbiotische Harmonie mit Skepsis. Paare, die sich »nie streiten«, sind mitunter urplötzlich geschieden. Kein Wunder, denn wo zwei Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Prägungen, Erwartungen, Persönlichkeiten aufeinandertreffen und viel Zeit (Jahre und gar Jahrzehnte) miteinander verbringen, gibt es zwangsläufig Kontroversen. Zusammengeschweißt wird man nicht durch (künstliche) Harmonie, sondern durch gemeinsam durchlebte und bewältigte Stürme. Das gilt auch für Freundschaften und in der Familie, im Kollegenkreis oder im Kirchenchor – und selbst im großen Ganzen. Wäre die DDR auch so rasch untergegangen, wenn es eine gelebte Streitkultur und damit eine Chance auf Wandel gegeben hätte statt der alten Parolen über den »Sieg des Sozialismus«?Fazit: Wir brauchen hin und wieder Streit, im Privaten wie im Gemeinwesen. Streit ist so vieles: Entwicklungsbeschleuniger, Innovationsmotor, Kompromissgenerator, Langeweilevertreiber. Wieso hat der Streit dann so ein mieses Image?
Warum Streiten ein Imageproblem hat
»Streitet euch nicht!« ist das 11. Gebot, das viele von uns von Kindesbeinen an mitbekommen haben. Doch wie sollte das gehen, sich als Kind nicht um Spielzeug, elterliche Aufmerksamkeit oder die Hauptrolle beim Abenteuerspiel zu streiten? Die Zahl der Kinderbücher zum Thema »Streit« ist wohl auch deshalb so groß – der größte Onlinebuchhändler bietet rund 1000 Treffer zum Thema. Dabei geht es in den pädagogisch wertvollen Publikationen viel um die Vorteile des selbst gewählten Sich-wieder-Vertragens. Im hektischen Alltag beschränkt sich die elterliche Streiterziehung jedoch oft auf den ebenso hilflosen wie energischen Appell: »Hört auf zu streiten!« – »Vertragt euch!« Wohin man als kleiner Mensch mit seinen aufgewühlten Emotionen soll, mit all der Ungerechtigkeit, die einem gefühlt entgegenschlägt, kümmert in vielen Elternhäusern wenig. Und die Großen machen es häufig ja auch nicht besser. Ob lautstarker Zoff oder tagelanges eisernes Schweigen, ihr Streit hat oft etwas Bedrückendes oder Ängstigendes. Wenn Kinder dann mit all ihren Gefühlen erschrocken den sich Dauerstreitenden gegenüberstehen und auf die Frage, »Was ist denn los?«, nur zu hören bekommen, »Nichts ist los, Mami und Papi haben sich doch lieb!«, dann sollte allen Eltern klar sein: Kinder sind eines sicherlich nicht – emotional einfältig! Doch wie wir streiten, lernen wir von Vorbildern, am ehesten in der Familie. Deshalb ist es auch keine gute Entwicklung, dass seit einiger Zeit Eltern für ihre Kinder, selbst die beinahe erwachsenen, »in den Ring steigen«. Das geht sogar so weit, dass zum Beispiel an einer Sportuni bei den Prüfungen der Studenten ein Absperrband die Eltern davon abhalten soll, die Prüfer anzugehen, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Schützlinge bei der Bewertung zu schlecht weggekommen seien.
Das alles lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Der Streit hat vor allem deswegen ein schlechtes Image, weil wir so schlecht streiten. Und wir streiten schlecht, weil wir zwar Schleifchenbinden, Dreisatz und Gedichtinterpretation systematisch beigebracht bekommen, nicht aber, wie man richtig streitet. Das Zusammensitzen am Esstisch, nicht nur zum Essen, sondern auch um miteinander zu reden und sich zuzuhören, wäre definitiv erstrebenswert. Das könnte ja auch schon mit der Frage beginnen, was es zu essen gibt. Das allein würde heute schnell zu einem Streit führen. Streiten heißt, konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Und zu Hause kann man das am besten lernen.