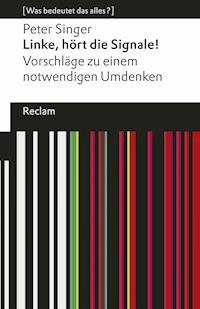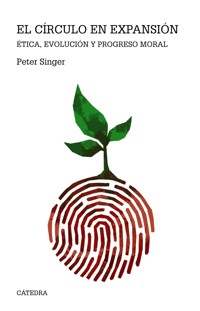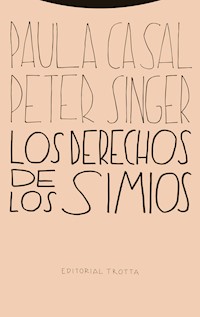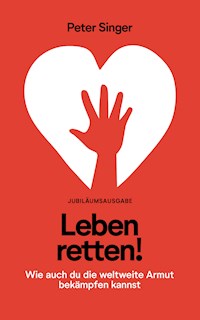
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dieser Jubiläumsausgabe von Leben retten! bringt Peter Singer zehn Jahre nach der Erstausgabe sein bahnbrechendes Werk auf den neuesten Stand. Er wiederholt nicht nur seine überzeugenden Argumente für den Kampf gegen extreme Armut stark, sondern untersucht auch die inzwischen erreichten Fortschritte und berichtet davon, wie die Erstauflage das Leben vieler Menschen verändert hat. Erfahre auch du, wie du Teil der Lösung sein kannst, indem du Gutes für andere tust und gleichzeitig auch dein Leben bereicherst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LEBEN RETTEN!
Wie auch du die weltweite Armut bekämpfen kannst
Peter Singer
Aus dem Amerikanischen von Julia Naji in Anlehnung andie Erstübersetzung von Olaf Kanter
Weitere Informationen zu diesem Buch,der Idee und den Organisationen dahinterfindest Du unter:
www.effektiv-spenden.org/leben-rettenwww.thelifeyoucansave.org
MEINUNGEN ZU LEBEN RETTEN!
„Herr Singer ist bei weitem nicht der einzige ernstzunehmende Denker zum Thema Armut, mit Leben retten! jedoch hat er sich zum lesenswertesten und zum mitreißendsten gemacht.“
– The New York Times
„Angesichts seiner Argumente ist es schwer, sich nicht zu fragen, wie es um das eigene Spenden steht. Ja, ich werde weiterhin Dinge kaufen, die ich nicht wirklich brauche. Aber ja, dieses Buch hat mich auch davon überzeugt, dass ich mehr spenden sollte – deutlich mehr – um denen zu helfen, die weniger Glück hatten als ich.“
– Financial Times
„Kraftvoll und augenöffnend… Singer gibt eine anspruchsvolle ethische Richtschnur für menschliches Verhalten vor.“
– Sunday Star Ledger
„Dieses kurze und überraschend fesselnde Buch versucht, zwei schwierige Fragen zu beantworten: warum Menschen in wohlhabenden Ländern Geld für die Bekämpfung der weltweiten Armut spenden sollten und wie viel jeder einzelne spenden sollte… Singer fordert die Leser nicht auf, sich zwischen Askese und Zügellosigkeit zu entscheiden; seine Lösung liegt in der Mitte, und sie ist für alle annehmbar und erschwinglich.“
– Publishers Weekly (Sternebewertung)
„Wenn du glaubst, dass du es dir nicht leisten kannst, für Bedürftige Geld zu spenden, empfehle ich dir dringend, dieses Buch zu lesen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du bereits genug spendest und an die richtigen Organisationen, solltest du dieses Buch erst recht lesen. In Leben retten! legt Peter Singer überzeugend dar – stringent und sachlich, aber durchaus mit Nachdruck –, warum jeder von uns mehr für die Armen der Welt tun sollte. Dieses Buch wird dich dazu herausfordern, ein besserer Mensch zu werden.“
– Holden Karnofsky, Mitbegründer von GiveWell
INHALTSVERZEICHNIS
Titel
Meinungen zu Leben retten!
Impressum
Widmung
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort zur Jubiläumsausgabe
Einleitung von Peter Singer
DIE STREITFRAGE
1. Ein Kind retten
Armut heute
Wohlstand heute
2. Ist es verwerflich, nicht zu helfen?
Das Auto oder das Kind?
Die zugrunde liegende Logik
Almosen für Arme – traditionelle Auffassungen
3. Die üblichen Ausreden
DIE NATUR DES MENSCHEN
4. Warum spenden wir nicht mehr?
Das Opfer braucht ein Gesicht
Die eigene Nachbarschaft kommt zuerst
Die Mühe ist doch vergeblich
Ich bin dafür nicht verantwortlich
Das Gerechtigkeitsdilemma
Psychologie, Evolution und Ethik
5. Eine neue Kultur des Gebens
Tue Gutes und rede darüber
Zusammen erreichen wir mehr – Spendenversprechen und Spendergemeinschaften
Auf eigene Faust
Social Media – Die Kultur des Effektiven Spendens großziehen
Den Bedürftigen ein Gesicht geben – die Spender und Empfänger zusammenbringen
Der richtige Anreiz
Company Giving – Unternehmen engagieren sich
Die kommende Generation
Ein Angriff auf den Eigennutz
DIE FAKTEN: UNSERE HILFE FÜR DIE ARMEN
6. Wie viel kostet es, ein Leben zu retten – und wie finden wir heraus, welche Organisation es am besten macht?
Eine Hilfsorganisation finden, die wirklich einen Unterschied macht
Die Suche nach den wirksamsten Wohltätigkeitsorganisationen
Was es wirklich kostet, ein Leben zu retten
Die besten Hilfsorganisationen
Weitere empfohlene Hilfsorganisationen
7. Wie wir die Hilfe optimieren
Die Kritiker
Entwicklungshilfe und Wirtschaftswachstum
Schwache Institutionen machen gute Projekte zunichte
Bewerten, was wirkt
Verschieden bewerten
DIE LÖSUNG: EIN NEUER MASSSTAB DES SPENDENS
8. Das eigene Kind – und die Kinder der anderen
9. Zu viel verlangt?
Ein gerechter Anteil
Eine maßvolle Herausforderung
10. Ein realistischer Ansatz
Ein Urteil über Reiche und Prominente
Der Standard für alle
Der größte Motivationsschub
Was ein Einzelner tun kann
Nachwort: Spende grosszügig und rette Leben!
Nachwort: Vom Denken zum Handeln
Danksagungen
Anhang: Die Spendenskala
Endnoten
Biographie
Weitere Werke von Peter Singer
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty in den USA bei Random House, New York; in Australien und Neuseeland bei Text Publishing, Melbourne; und in Großbritannien bei Picador, Pan MacMillan, London.Copyright © 2009 by Peter Singer.Alle Rechte vorbehalten.
Die überarbeitete Jubiläumsausgabe wurde 2019 unter dem Titel The life you can save: How to do your part to end world poverty von The Live You Can Save, Bainbridge Island, Washington, USA und Sydney, Australien weltweit veröffentlicht.
Überarbeitete Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum © 2019 by Peter Singer.
Leben retten! Wie auch du die weltweite Armut bekämpfen kannst. Deutschsprachige Ausgabe veröffentlicht von The Life You Can Save, Bainbridge Island, Washington, USA und Sydney, Australien in Zusammenarbeit mit Effektiv Spenden – UES gemeinnützige GmbH für effektives Spenden, Berlin, 2022Alle Rechte vorbehalten.
Aus dem Amerikanischen von Julia Naji in Anlehnung an die Erstübersetzung von Olaf KanterKorrektorat: Lars Osterloh© Buchcover-Design: W. H. ChongSatz und Layout: Daniela Rohr / www.skriptur-design.de
Obwohl der Autor, die Verleger und die Übersetzer alle Anstrengungen unternommen haben, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Buch zum Zeitpunkt der Drucklegung der Originalausgabe 2019 korrekt waren, übernehmen der Autor, Verleger und Übersetzer keine Haftung für Verluste aufgrund von Fehlern oder Auslassungen, unabhängig davon, ob diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführen sind, und lehnen hiermit jegliche Haftung ab. Für die Inhalte von den in diesem Buch referenzierten Webseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweiligen Webseiten verantwortlich. Der Verlag und der Autor haben keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Webseiten.
www.effektiv-spenden.org/leben-rettenwww.thelifeyoucansave.org
Für Renata, ohne die …
Diese Übersetzung gendert. Sie nutzt an den Stellen,an denen es um alle Menschen geht,abwechselnd das Femininum und das Maskulinum.
Alle Währungsangaben in Dollar beziehen sich auf US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
„Das teuerste Buch, das ich jemals gekauft habe“
Sebastian Schwiecker,Gründer und Geschäftsführer von Effektiv Spenden
Durch die erste Auflage von Leben retten! bin ich vor mehr als 10 Jahren erstmals auf Peter Singer aufmerksam geworden. Noch während ich es las, sagte ich zu meiner späteren Frau, dass dies das vermutlich mit Abstand teuerste Buch sei, das ich jemals gekauft habe. Damit sollte ich doppelt recht behalten: Zum einen wurde es durch die Spenden, zu denen es mich motiviert hat, mein teuerstes Buch, zum anderen ist es bis heute das mir teuerste Buch, denn es hat mein Leben maßgeblich verändert.
In der Theorie war ich zwar ähnlich wie Peter Singer zu der Erkenntnis gelangt, dass man den Großteil des eigenen Wohlstands mit den Ärmsten der Welt teilen sollte, und warf als Teenager meinem großen Bruder voller Inbrunst vor, dass ihm Menschenleben weniger wert seien als ein neues Handy. In der Praxis aber hatte ich mich mit der Zeit immer weiter vom eigenen Anspruch entfernt und das allmählich steigende Einkommen mehr und mehr in Konsum investiert, der mir noch einige Jahre zuvor ebenso unerschwinglich wie unnötig erschien.
Leben retten! kam daher für mich zur rechten Zeit, um mir noch einmal klar zu machen, welche Ziele mir im Leben wirklich wichtig sind. Sollte es mir genügen, durch Lebensstil, Job und vielleicht die eine oder andere Spende, die Welt zumindest nicht schlechter zu machen, oder wollte ich den Idealen meiner Jugend gerecht werden, einen echten Beitrag leisten und alles dafür tun, dass die Welt durch mich eine bessere wird?
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, habe ich mich für einen Kompromiss entschieden und lebe ein im Vergleich zum Großteil der Menschheit nach wie vor überaus komfortables Leben. Dennoch habe ich allein durch meine Spenden in den letzten Jahren vermutlich mehrere Kinder vor dem Tod bewahrt.
Mehreren Kindern das Leben gerettet? Ich?
Lange hatte ich es nicht für möglich gehalten, das jemals über mich sagen zu können, aber es ist wahr. Wie Peter Singer in diesem Buch ausführt, kannst du dies auch für dich wahr werden lassen. So hat etwa das Forschungsinstitut GiveWell ermittelt, dass du mit lediglich 3.000-5.000 Euro nachweislich ein Kind vor dem sonst sicheren Tod bewahren kannst. Wenn man bereit wäre, etwa 10 % seines Einkommens zu spenden, kann man also bereits mit einem durchschnittlichen Gehalt in Deutschland das Leben eines Kindes retten. Und jedes weitere Jahr ein weiteres Kind.
Natürlich sind 5.000 Euro für die meisten von uns sehr viel Geld. Aber zu diesem Preis ein Leben retten? Das erscheint mir günstig. Zumal man selbst nach Abzug dieser Spende mit einem deutschen Durchschnittsgehalt noch immer zu den reichsten 5 % der Menschheit gehört. Wenn das zum Glücklichwerden nicht genug ist, wann ist es dann genug?
Nein, im Endeffekt war Leben retten! nicht das teuerste Buch, das ich jemals gekauft habe, sondern das erfüllendste, denn es hat mir geholfen, zu mir zu finden und ich hoffe, dass es dir auch so ergeht.
September 2022
VORWORT ZUR JUBILÄUMSAUSGABE
„So habe ich das noch nie gesehen.“
Michael Schur,Erfinder der Fernsehserie The Good Place
Ich bin erstmals 2006 auf Peter Singer aufmerksam geworden – durch einen Artikel, den er für das New York Times Magazine geschrieben hat. Er schrieb über das „Goldene Zeitalter der Philanthropie“. Warren Buffett hatte gerade 37 Milliarden Dollar an die Gates Foundation und andere Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, was, so Singer, inflationsbereinigt „mehr als das Doppelte dessen war, was die beiden einstigen philanthropischen Giganten, Andrew Carnegie und John D. Rockefeller, zusammen im Laufe ihres Lebens gespendet hatten“. Singer warf einige schlichte Fragen auf: Was sollte ein Milliardär für wohltätige Zwecke spenden? Was sollten wir (die Nicht-Milliardäre) spenden? Und wie kann man diese Summen berechnen?
Was mich an Singers Argumenten beeindruckte, war, dass jene Zahlen für ihn nicht abstrakt waren. Sie waren klar ermittelbar. Man braucht eine bestimmte Menge Geld, um ein gutes Leben zu führen – um ausreichend Mittel für Miete, Kleidung, Essen und Freizeit zur Verfügung zu haben. Und wenn man zusammengerechnet mehr als diesen Betrag zur Verfügung hat, so seine These, sollte man das Übrige abgeben – weil man es selbst nicht braucht, jemand anderes auf der Welt aber sehr wohl.
Die Unverblümtheit dieser Aussage brachte mich zum Lachen. Es war ein schonungslos nüchternes, achselzuckendes Argument, und während ich nach eigenen Antworten darauf suchte, hatte ich immer wieder denselben Gedanken:
„Menschenskind! So habe ich das noch nie gesehen.“
Zehn Jahre später recherchierte ich zu verschiedenen moralphilosophischen Themen für eine von mir entwickelte Fernsehserie namens „The Good Place“. Als ich mich dabei in den Utilitarismus einarbeitete – eine Philosophie, die davon ausgeht, dass sich der moralische Wert einer Handlung nach ihren Auswirkungen bestimmt – tauchte Singer immer wieder auf. Bei jedem seiner Artikel oder Bücher, die ich las, ertappte ich mich dabei, darauf wieder mit der gleichen Mischung aus Faszination, Betroffenheit, Aufregung und Ungläubigkeit zu reagieren. Seine Texte waren klar, unmissverständlich, kompromisslos, manchmal sogar schockierend. Argumente, die ich zunächst für absurd hielt, erschienen mir plötzlich äußerst vernünftig … und umgekehrt.
Aber was mir beim Lesen seiner Texte am meisten im Gedächtnis geblieben ist – vor allem, wann immer es ums Spenden ging –, war die Tatsache, dass mein allererster Gedanke immer wieder zu mir zurückkam: „So habe ich das noch nie gesehen.“ Selten hatte ein Gedanke einen so starken Einfluss auf mich.
Selbst ein bescheidenes Leben in einem wohlhabenden, (relativ) stabilen Land wie den USA kann ein Maß an Komfort bieten, das sogar dasjenige von Ludwig XIV. in seinem Palast in Versailles übertrifft – ich übertreibe nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du über die meisten oder alle der folgenden Dinge verfügst: fließendes Wasser, Sanitäranlagen im Haus, Klimaanlage, Kühlschrank, Fernseher, Internetzugang und eine Waschmaschine. (Informiere dich mal über die Hygiene im 18. Jahrhundert: Ludwig XIV. hätte vermutlich die Hälfte seines Reichtums für eine mechanische Waschmaschine hergegeben.) Selbst heute sind diese einfachen Annehmlichkeiten im weltweiten Vergleich aberwitzig luxuriös, zugleich sind sie – relativ gesehen – ziemlich erschwinglich. Der verbreitetste Luxus aber, den das Leben in einem reichen Land mit sich bringt, ist zugleich der heimtückischste: die Selbstgefälligkeit. Selbst für eine Person mit durchschnittlichem Einkommen ist es leicht, die grundlegenden Annehmlichkeiten des Lebens als absolut selbstverständlich zu betrachten. Und für die Wohlhabenden ist es das absolut Normalste der Welt, dies zu tun.
Was nicht heißen soll, dass das Leben der meisten Menschen einfach ist, ganz und gar nicht. Das Leben der meisten Menschen, selbst in den reichsten Ländern, ist geprägt von finanziellem Stress, von schmerzhaften Erlebnissen, persönlichen und beruflichen Enttäuschungen, von gesundheitlichen Problemen; es ist voller schwieriger Entscheidungen, voller Irrungen und Wirrungen, voller Ängste und Leiden. Umso schwieriger ist es, sich vor Augen zu halten, dass drei Dollar für einen Hamburger einen Luxus bedeuten, den sich Hunderte von Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, nicht einmal vorstellen können.
Nun kommt Peter Singer mit Leben retten! ins Spiel.
Im Kern fordert uns Singers Buch dazu auf, über eine ganz schlichte Wahrheit nachzudenken: Ein Leben ist ein Leben, egal wo es gelebt wird. Ein menschliches Wesen dort ist nicht weniger wert als ein menschliches Wesen hier. Es fordert uns zudem angesichts dieser schieren Universalität des Wertes Mensch dazu auf, das Leben dort mit der gleichen Fürsorge und Achtung zu behandeln wie das Leben hier. Das ist alles. Das ist die „Bitte“. Wenn du dir von mir eine Klappentext-Version der Singer’schen Ideen erhofft hast, habe ich diese hiermit geliefert.
In diesem Buch wirst du von verschiedenen Menschen erfahren, die auf beispielhafte Weise für sich erkannt haben, dass alles Leben gleich wertvoll ist. Du wirst von Menschen lesen, die ihr gesamtes Vermögen – dutzende Millionen Dollar – verschenkt haben, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass es moralisch problematisch ist, einen einzigen Dollar mehr zu besitzen, als sie zum Leben brauchen. Du wirst von Menschen lesen, die erfahren haben, dass die Wahrscheinlichkeit, mit nur einer Niere zu sterben, bei 1 zu 4000 liegt, und die infolgedessen freiwillig eine Niere verschenkt haben – denn ihnen war klar geworden, dass das Nichtverschenken ihrer „zusätzlichen“ Niere bedeutet hätte, dass sie ihr eigenes Leben 4000 Mal höher bewerten als das eines anderen Menschen.
Wenn es dir geht wie mir, wirst du diese Geschichten lesen und viele Dinge gleichzeitig fühlen. Du wirst Ehrfurcht und Bewunderung für Menschen empfinden, die sich mit so viel Hingabe dafür einsetzen, anderen zu helfen. Du wirst dich schämen, nicht zu diesen Menschen zu gehören. Du wirst aber auch das Gefühl haben, dass diese Menschen ziemlich verrückt sind, denn in eine Arztpraxis zu gehen und zu sagen: „Bitte nehmen Sie eine meiner Nieren und geben Sie sie einem Fremden, der sie dringend braucht“ ist vermutlich nichts, was jemals auf deiner Wunschliste stand. Vielleicht kommst du dir sogar wie ein furchtbarer Heuchler vor, denn obwohl du bereits viel tust, um anderen Menschen in Not zu helfen, besitzt du auch einen großen Flachbildfernseher, einen kuscheligen Bademantel und einen von deinem Lieblingsspieler signierten Baseballschläger, der 300 Dollar gekostet hat – nichts davon „brauchst“ du, streng genommen. Und dann wirst du vielleicht wütend, weil du dich für jemanden hältst, der oder die versucht, wann immer es geht, das Richtige zu tun; und du magst deinen kuscheligen Bademantel – er ist verdammt nochmal wirklich kuschelig! Und wer ist dieser Kerl, der sich herausnimmt, dir zu sagen, du sollst dir diesen Bademantel nicht kaufen. Und dann spricht er auch noch davon, eine Niere zu verschenken! Was ist daran bitte angemessen?!
Aber das ist genau der Punkt. Wichtiger als das, was du empfindest, wenn du dieses Buch liest, ist das, was du nicht empfinden wirst: eben Selbstgefälligkeit.
Du wirst nicht mehr das Gefühl haben, dass andere Menschen keine Rolle spielen. Du wirst nicht mehr unbekümmert an Berichten über nahe und ferne Katastrophen vorbeiscrollen, ohne auch nur für einen Moment an die Auswirkungen für all die Betroffenen zu denken. Stattdessen wird dir der Gedanke im Kopf herumgeistern, dass es vielleicht etwas Einfaches gibt, was du tun kannst, um zu helfen. Etwas, das dein Leben nicht beeinträchtigt und dich oder deine Familie nicht in Gefahr bringt.
Also keine Sorge, künftiger Leser: Du musst nicht deine Niere verschenken oder dich selbst in den Bankrott treiben, um das Leben der Ärmsten zu verbessern, wenn du dem Kompass dieses Buches folgen möchtest. Du musst dir nur ein paar Fragen stellen: Was tue ich als Mensch auf dieser Erde, um den weniger Bevorzugten zu helfen? Kann ich vielleicht ein bisschen mehr tun? Und wenn ja, wie?
Dies sind Fragen, die es wahrlich wert sind, gestellt zu werden.
Juli 2019
EINLEITUNG VON PETER SINGER
Als er sah, wie der Mann auf die Gleise der U-Bahn stürzte, zögerte Wesley Autry keine Sekunde. Obwohl er die Lichter des einfahrenden Zuges bereits sehen konnte, sprang Autry auf das Gleisbett. Er riss den Mann in eine Entwässerungsrinne zwischen den Schienen, warf sich schützend über ihn, der Zug donnerte über sie hinweg und hinterließ eine schmierige Ölspur auf Autrys Mütze. Für diese Tat erhielt er eine Einladung nach Washington zur alljährlichen Rede des Präsidenten zur Lage der Nation und dieser lobte seinen Mut. Aber Autry spielte den Vorfall herunter: „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas Spektakuläres getan habe. Ich habe einen Menschen in Not gesehen, der Hilfe brauchte. Ich habe bloß getan, was ich für richtig hielt.“1
Und wenn ich dir nun sage, dass auch du ein Leben retten kannst, möglicherweise sogar viele Leben? Steht eine Flasche Wasser oder eine Dose Limonade neben dir auf dem Tisch? Solange du dafür Geld ausgibst, obwohl sauberes Wasser aus dem Wasserhahn fließt, hast du offensichtlich Geld für Dinge, die du nicht wirklich brauchst – während gleichzeitig auf diesem Planeten 700 Millionen Menschen einen ganzen Tag mit weniger Geld auskommen müssen, als du für dieses eine Getränk ausgegeben hast.2 Diese Menschen können sich nicht einmal eine medizinische Gesundheitsversorgung leisten, ihre Kinder können jederzeit an einer harmlosen und leicht heilbaren Krankheit wie Durchfall sterben.
Du kannst ihnen helfen. Und dafür musst du dich nicht einmal vor einen Zug werfen.
Seit mehr als 40 Jahren denke ich darüber nach, wie wir mit Hunger und Armut umgehen sollten. Was in diesem Buch steht, habe ich zuvor bereits Tausenden von Studierenden in meinen Seminaren und in meinem Online-Kurs über effektives Spenden vorgestellt und in Zeitungen, Zeitschriften, einem TED-Talk, in Podcasts und Fernsehsendungen diskutiert.3 Infolgedessen musste ich immer wieder auf gut durchdachte Kritik reagieren.
Die erste Ausgabe dieses Buches entfachte weitere Diskussionen und offenbarte neue Herausforderungen. Der Effektive Altruismus wurde als Bewegung immer stärker und inspirierte mehr und mehr Forschung darüber, welche Formen der Hilfe die größte Wirkung erzielen. Diese aktualisierte Ausgabe zum 10. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Leben retten! fasst nun alles zusammen, was ich im Laufe der Jahre darüber gelernt habe, warum wir geben oder nicht geben – und was wir ändern sollten.
Wir leben in einer einzigartigen Zeit. Der Anteil der Menschen, die ihre körperlichen Grundbedürfnisse nicht stillen können, ist heute kleiner als je zuvor in der jüngeren Geschichte, vielleicht sogar in der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig ist, kurzfristigen Konjunkturschwankungen ungeachtet, auch der Anteil der Menschen, die weit mehr haben, als sie brauchen, so hoch wie nie zuvor. Vor allem aber sind heute Arm und Reich auf eine noch nie dagewesene Weise miteinander verbunden: Berührende Bilder von Menschen, die ums Überleben kämpfen, werden in Echtzeit auf unsere Mobilgeräte übertragen. Wir wissen nicht nur sehr viel über das Leben der Ärmsten der Armen, wir können ihnen auch mehr denn je zur Verfügung stellen: eine bessere Gesundheitsversorgung, verbessertes Saatgut und bessere landwirtschaftliche Techniken, neue Technologien zur Stromerzeugung. Noch erstaunlicher ist, dass wir ihnen durch direkte Kommunikation und offenen Zugang zu Informationen (in einer Fülle, die das Angebot der größten Bibliotheken des Vor-Internet-Zeitalters weit in den Schatten stellt) die Möglichkeit geben können, in der weltweiten Gemeinschaft eine Rolle zu spielen. Wenn wir es nur schafften, ihnen dabei zu helfen, die Armut weit genug zu überwinden, dann wären sie endlich dazu in der Lage, diese Gelegenheit zu ergreifen – und zwar auf Dauer.
Die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedsstaaten haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Beendigung extremer Armut bis 2030 .4 Dafür bleiben jetzt nur noch 11 Jahre. Eine Herausforderung, aber: Wir haben schon beachtliche Fortschritte auf dem Weg dahin gemacht. 1960 starben nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF 20 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag. In der ersten Ausgabe dieses Buches 2009 konnte ich meinen Lesern, mit Blick auf die damals neuesten mir verfügbaren Berechnungen, die gute Nachricht überbringen, dass die Zahl der Todesfälle auf 9,7 Millionen gesunken war. Diese Jubiläumsedition kann das noch toppen: Laut neuestem Bericht sind 2017 5,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren gestorben.5 In diesem Jahr starben also jeden Tag 11.780 Kinder weniger (das sind 21 vollbesetzte Airbus A380) als in der ersten Ausgabe erwähnt und 40.000 Kinder weniger als 1960. Große Impf- und Aufklärungskampagnen gegen Pocken, Masern und Malaria haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Sterblichkeit bei Kindern so stark zurückgegangen ist. Auch der wirtschaftliche Aufschwung in vielen Ländern hat dabei geholfen. Es ist eine wirklich beeindruckende Entwicklung, erst recht, wenn man sich vor Augen führt, dass sich die Weltbevölkerung seit 1960 mehr als verdoppelt hat. Trotzdem dürfen wir uns damit nicht zufriedengeben. Denn jedes Jahr sterben immer noch 5,4 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag, mehr als die Hälfte an Krankheiten, die mit einfachen, erschwinglichen Mitteln hätten verhindert oder schnell behandelt werden können. Das ist eine unermessliche Tragödie – vom moralischen Versagen einer Welt, die so reich ist wie die unsere, einmal ganz abgesehen.6
Wir können unsere Situation mit dem Versuch vergleichen, den Gipfel eines riesigen Berges zu erklimmen. In allen Epochen der menschlichen Existenz sind wir durch dichte Wolken aufgestiegen. Wir wussten nicht, welche Strecke noch vor uns liegt oder ob der Aufstieg überhaupt machbar ist. Nun haben wir den Nebel endlich hinter uns gelassen und können einen Weg über die letzten steilen Hänge bis zum Gipfel erkennen. Der Gipfel liegt noch in einiger Entfernung vor uns. Manche Abschnitte des Wegs werden uns das Äußerste abverlangen, aber wir sehen jetzt: Das Ziel ist tatsächlich zu erreichen.
Jeder von uns kann seinen Teil zum Gelingen dieses historischen Vorhabens beitragen. In den vergangenen Jahren wurde über einige Personen berichtet, die sich mit großem Engagement und in aller Öffentlichkeit auf den Weg gemacht haben. Warren Buffett zum Beispiel hat sich verpflichtet, 99% seines Vermögens – entweder noch zu Lebzeiten oder nach seinem Tod – für wohltätige Zwecke zu spenden. Seit 2006 hat er mehr als 30,9 Milliarden Dollar gespendet. Bill und Melinda Gates haben rund 50 Milliarden Dollar gespendet und sie werden es nicht dabei belassen. Sowohl für Buffett als auch für Bill und Melinda Gates hat die Bekämpfung der extremen Armut höchste Priorität.7 Was sie spenden können, sind natürlich immense Summen. Wir werden am Ende dieses Buches aber sehen: Sie machen nur einen Bruchteil dessen aus, was die Gesamtheit der in reichen Industrieländern lebenden Menschen spenden könnte – und zwar ohne dass jeder einzelne seinen Lebensstandard wesentlich einschränken müsste. Wir werden unser Ziel, das Ende der globalen Armut, nicht erreichen können, wenn sich nicht viel mehr Menschen daran beteiligen.
Deshalb ist es jetzt für jeden so weit, sich zu fragen: Was kann ich tun, um zu helfen?
Ich verfolge mit diesem Buch zwei Ziele, die in die gleiche Richtung gehen, aber vom Ansatz her verschieden sind. Das erste Ziel: Ich möchte dich zum Nachdenken auffordern – über unsere Pflicht denjenigen gegenüber, die in extremer Armut gefangen sind. Im ersten Teil des Buches werden einige sehr hohe – manche werden sagen: unmöglich hohe – Maßstäbe ethischen Verhaltens definiert. Ich werde behaupten, dass wir nur dann ein moralisch integres Leben führen können, wenn wir mehr geben, als die meisten für menschenmöglich halten. Das mag absurd klingen, aber die Begründung ist erstaunlich simpel. Sie beginnt mit der Flasche Wasser, also mit dem Geld, das wir für Dinge ausgeben, die wir nicht wirklich brauchen. Wenn es so einfach ist, Menschen zu helfen, die ohne eigenes Zutun in Not geraten sind, und wir nicht helfen, läuft dann nicht etwas verkehrt? Wenigstens das möchte ich mit meinem Buch erreichen: Dich davon zu überzeugen, dass mit unseren gängigen Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben ausmacht, etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.
Das zweite Ziel dieses Buches: Ich möchte dich dazu bewegen, freiwillig mehr von deinem Einkommen an Menschen in Armut zu spenden. Aber sei beruhigt – mir ist klar, dass ich von den Höhenflügen einer theoretisch-philosophischen Diskussion Abstand nehmen muss, wenn ich herausfinden will, was konkret wir ändern müssen, um etwas zu bewirken. Ich werde mich schlicht mit den Gründen befassen, die wir oft gegen das Spenden äußern – einige sind relativ überzeugend, andere weniger. Auch mit den psychologischen Hürden, die uns mitunter im Weg stehen, werde ich mich befassen. Menschliches Verhalten spielt sich innerhalb bestimmter Grenzen ab. Das werde ich in meine Überlegungen einbeziehen – um dann zu zeigen, wie Einzelne einen Weg gefunden haben, diese Grenzen zu überwinden. Am Ende werde ich einen Spendenvorschlag machen, der den meisten Menschen keine großen Opfer abverlangt, sie dafür glücklicher und erfüllter macht als je zuvor.
Dennoch, es gibt Gründe, warum vielen von uns der Gedanke schwerfällt, Menschen Geld zu geben, die uns fremd sind, die zudem in einem Land leben, in dem wir noch nie gewesen sind. Ich werde diese Gründe in diesem Buch untersuchen. Meine Hoffnung ist, dass du, wenn du es liest, alles im Gesamtbild betrachten kannst und darüber nachdenkst, was es bedeutet, moralisch integer in einer Welt zu leben, in der jedes Jahr 266.000 Kinder an Malaria sterben, also an einer Krankheit, die sowohl vermeidbar, als auch heilbar ist, in einer Welt, in der eine Million Frauen an einer Geburtsfistel leiden – einer verheerenden, aber heilbaren Geburtsverletzung, welche die Frau inkontinent macht. In der vier von fünf blinde Menschen ohne großen finanziellen Aufwand vor der ihre Sehkraft zerstörenden Krankheit bewahrt oder mit einer kleinen Kataraktoperation geheilt werden könnten.8
Bitte denk an jemanden, den du liebst, und frag dich, wie viel du hergeben würdest, um diese Person vor einem Malariatod zu retten; um ihr die Behandlung einer Geburtsverletzung zu ermöglichen, die sie zu einer sozial geächteten Person gemacht hat; um ihr Augenlicht wiederherzustellen, wenn sie erblindet ist? Dann frag dich bitte, wie viel du tust, um Menschen zu helfen, die in Armut leben und nicht die Mittel haben, genau diese Dinge für sich und ihre Familien zu tun.
Ich glaube, wenn du dieses Buch bis zum Ende liest, wenn du ehrlich und gewissenhaft sowohl die dargelegten Fakten, als auch die ethischen Argumente überdenkst, wirst auch du sagen, dass wir handeln müssen.
In den letzten Kapiteln findest du Links und Hinweise, die dir zeigen, wie das geht.
Peter Singer
DIE STREITFRAGE
KAPITEL 1
EIN KIND RETTEN
Auf dem Weg zur Arbeit kommst du an einem kleinen Teich vorbei. Manchmal, an heißen Tagen, spielen Kinder dort; das Wasser ist nur knietief. Doch heute ist das Wetter eher kühl. Es ist noch sehr früh am Tag, und deshalb bist du überrascht, dass ein Kind im Wasser planscht. Als du näher kommst, siehst du, dass es sich um ein Kleinkind handelt, das hilflos mit den Armen rudert. Es kann nicht richtig stehen und schafft es auch nicht, das Ufer zu erreichen. Du schaust dich um und suchst nach den Eltern oder einem Babysitter, aber es ist niemand zu sehen. Das Kind kann seinen Kopf immer nur für wenige Sekunden über Wasser halten. Wenn du nicht sofort handelst, wird es ertrinken. In den Teich zu waten dürfte kein Problem sein für dich, aber du wirst dir dabei wohl deine Schuhe ruinieren, die du gerade erst vor ein paar Tagen gekauft hast, und dein Anzug wird nass und schmutzig werden. Bis du das Kind gerettet, die Eltern oder den Babysitter gefunden und dich umgezogen hast, wird so viel Zeit vergangen sein, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Was solltest du tun?
Ich gebe an der Universität ein Seminar mit dem Titel „Praktische Ethik“. Bevor wir über die weltweite Armut diskutieren, frage ich meine Studierenden immer, wie sie in einer solchen Situation reagieren würden. Nicht wirklich überraschend antworten sie, dass man das Kind retten müsse. „Aber was ist mit euren Schuhen?“, frage ich sie dann, „und Ihr kommt zu spät zur Arbeit.“ Meine Studierenden lassen den Einwand nicht gelten. Wie könne man auch nur für eine Sekunde auf die Idee kommen, ein Paar Schuhe oder eine Verspätung seien ein Grund, das Leben eines Kindes nicht zu retten?
Die Geschichte vom ertrinkenden Kind habe ich zum ersten Mal in Famine, Affluence and Morality (deutscher Titel: Hunger, Wohlstand und Moral) erzählt, einem meiner ersten Artikel überhaupt, der 1972 veröffentlicht wurde und immer noch in Ethikkursen besprochen wird. Im Jahr 2011 ereignete sich in der südchinesischen Stadt Foshan etwas, das der hypothetischen Teich-Situation ähnelt. Ein 2-jähriges Mädchen namens Wang Yue lief ihrer Mutter weg und rannte auf eine kleine Straße, wo ein Lieferwagen sie anfuhr. Der Wagen hielt nicht an. Eine Überwachungskamera hielt den schockierenden Vorfall fest. Was dann aber folgte, war noch viel schockierender: Wang Yue lag blutend auf der Straße, 18 Personen liefen oder fuhren mit dem Fahrrad vorbei, niemand hielt an, um ihr zu helfen. Die Kamera zeigte, dass die meisten das Mädchen zwar sahen, ihren Blick dann aber abwandten und vorbeigingen. Ein zweiter Lieferwagen näherte sich und überfuhr ihr Bein. Erst dann schlug ein Straßenreiniger endlich Alarm. Wang Yue wurde in ein Krankenhaus gebracht, aber leider war alles zu spät. Sie starb.9
Wie die meisten Menschen denkst du jetzt wahrscheinlich: „Ich wäre nicht an dem Kind vorbeigelaufen. Ich hätte geholfen.“ Vielleicht hättest du das wirklich getan; aber erinnere dich daran, dass im Jahr 2017 5,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren zu Tode kamen. Die meisten dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen.
Hier ein solcher Fall, den ein Mann in Ghana einem Feldforscher der Weltbank schilderte:
Heute Morgen ist hier ein Junge an Masern gestorben. Wir alle wissen, dass er im Krankenhaus hätte geheilt werden können. Aber die Eltern hatten kein Geld. Der Junge starb einen langsamen und schmerzhaften Tod – keinen Maserntod, nein, einen Armutstod!10
Man darf nicht vergessen, so etwas passiert hunderte Male jeden Tag. Manche Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Noch mehr sterben an Masern, an Malaria oder Durchfall – Krankheiten, die es in reichen Industrieländern entweder gar nicht gibt oder die quasi nie tödlich verlaufen. Die Kinder sind diesen Krankheiten schutzlos ausgeliefert – weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder sanitären Anlagen haben und weil sich ihre Eltern keine medizinische Behandlung für sie leisten können. Oft ist ihnen nicht einmal bewusst, dass eine Behandlung notwendig ist. Oxfam, die Against Malaria Foundation, Evidence Action und viele andere Organisationen arbeiten daran, Armut zu bekämpfen, Moskitonetze oder sicheres Trinkwasser bereitzustellen. Ihr Einsatz verringert bereits die Zahl der Todesopfer. Hätten diese Organisationen mehr Geld, könnten sie noch mehr erreichen, noch mehr Leben retten.
Jetzt denk kurz einmal an deine eigene Situation. Mit einer kleinen Spende könntest du das Leben eines Kindes retten – mit etwas mehr vielleicht als dem, was du für ein Paar neue Schuhe bezahlen würdest. Wir alle geben Geld für Dinge aus, die wir nicht wirklich brauchen. Sei es für Getränke, für Restaurantbesuche, für Kleidung, Filme, Konzerte, Urlaube, für neue Autos oder für Umbauarbeiten am Haus. Ist es möglich, dass du, indem du dein Geld für solche Dinge ausgibst und nicht an eine Hilfsorganisation spendest, ein Kind sterben lässt? Ein Kind, das du hättest retten können?
Armut heute
Wir werden uns gleich fragen, warum wir alle mehr für Menschen in extremer Armut tun sollten. Zuerst aber ein kleiner Test: Bitte such dir etwas zu schreiben und beantworte die folgenden Fragen:
1. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt, …
a) fast verdoppelt
b) nicht verändert
c) beinahe halbiert.
2. Wie viele aller einjährigen Kinder auf der Welt sind heute gegen irgendeine Krankheit geimpft?
a) 20%
b) 50%
c) 80%
3. Wo lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung?
a) In Ländern mit niedrigem Einkommen
b) In Ländern mit mittlerem Einkommen
c) In Ländern mit hohem Einkommen.i
Über die letzten Jahrzehnte haben Hans Rosling (bereits verstorben) und die Gapminder Foundation im Rahmen der „Gapminder Misconception Study“ Tausenden von Menschen in aller Welt diese und ähnliche Fragen gestellt.11 In ihrem Buch Factfulness präsentieren Hans Rosling, sein Sohn Ola Rosling und seine Schwiegertochter Anna Rosling Rönnlund die durchaus überraschenden Ergebnisse aus ihren Tests. Hier eine Zusammenfassung:
Nach Angaben der Weltbank ist der Anteil der Weltbevölkerung, der unterhalb der von ihr festgesetzten Armutsgrenze lebt, von 34 % (1993) auf 10,7 % (2013) gesunken. Dies legt nahe, dass der Anteil nicht nur um die Hälfte, sondern sogar um zwei Drittel zurückgegangen ist. Da sich extreme Armut aber nur schwer messen lässt, hat man konservativ geschätzt. Wie dem auch sei, dieser dramatische Rückgang ist einer der größten Triumphe in der Menschheitsgeschichte – jedoch weiß kaum jemand davon. Das haben die Tests gezeigt: Im Durchschnitt beantworteten nur 7 % der Teilnehmenden die erste Frage richtig. In den Vereinigten Staaten sogar noch weniger: 19 von 20 Amerikanerinnen, die an der Umfrage teilnahmen, glaubten fälschlicherweise, der Anteil der Menschen in extremer Armut habe sich während der letzten 20 Jahre nicht verändert bzw. sei sogar stark gestiegen.
Ähnlich verhielt es sich mit der zweiten Frage zu den Impfungen. Fast alle Kinder weltweit sind heute geimpft – ein Phänomen, das die Autoren von Factfulness zu Recht „großartig“ nennen. Wieder wussten nur sehr wenige Menschen – nur 13 % – von diesem bemerkenswerten Erfolg im Kampf für einen verbesserten Gesundheitsschutz von Kindern in aller Welt.
Du kannst dir schon denken, dass die meisten Teilnehmer auch bei der dritten Frage durchgerasselt sind. Wir haben uns daran gewöhnt, die Welt in „Industrieländer“ und „Länder mit niedrigem Einkommen“ einzuteilen, was keinen Platz fürs Mittelfeld lässt, nämlich die „Länder mit mittlerem Einkommen“. In ihnen leben aber drei Viertel der Weltbevölkerung. Zählt man die Menschen hinzu, die in Ländern mit hohem Einkommen leben, kommt man insgesamt auf 91 % der Weltbevölkerung. Dann bleiben nur noch 9 % übrig, die in Ländern mit niedrigem Einkommen leben. Und natürlich sind nicht alle von ihnen von extremer Armut betroffen. Aber man sollte sich noch nicht zurücklehnen: In großen Ländern mit mittlerem Einkommen wie Indien und Nigeria ist der Wohlstand sehr ungleich verteilt. Auch hier leben viele Millionen Menschen in extremer Armut.
In Kapitel 3 werden wir erfahren, dass viele Menschen auf Spenden an Hilfsorganisationen verzichten, die sich konkret um die Bekämpfung der extremen Armut bemühen. Sie glauben, es handle sich dabei schlicht um eine hoffnungslose Aufgabe, man mache keine nennenswerten Fortschritte. Es ist daher wichtig, dass mehr Menschen von den immensen Fortschritten in der Armutsbekämpfung erfahren, die sich in den korrekten Antworten auf die obigen Testfragen widerspiegeln. Es ist ebenfalls unumgänglich, dass wir den Menschen, die in extremer Armut leben, zuhören, dass wir herausfinden, was sie im Alltag erleben und welche Veränderungen sie sich wünschen. Vor ein paar Jahren beauftragte die Weltbank ein Team von Feldforscherinnen damit, Menschen in extremer Armut zu interviewen. Sie dokumentierten die Erfahrungen von 60.000 Frauen und Männern in 73 Ländern. Immer wieder, in verschiedenen Sprachen und auf allen Kontinenten, bekamen sie von Menschen, die in Armut leben, zu hören, was Armut für sie bedeutet und wie Armut sie am Fortkommen hindert:
Nahrungsmittel sind das ganze Jahr über knapp. Oft gibt es nicht mehr als eine Mahlzeit pro Tag; manchmal muss man sich entscheiden, ob man den Hunger seiner Kinder stillt oder den eigenen. Manchmal geht beides nicht.
Es ist praktisch unmöglich, Geld zu sparen. Wenn ein Mitglied der Familie krank wird und man Geld für einen Arzt braucht oder wenn die Ernte ausfällt und es nichts zu essen gibt, muss man beim örtlichen Verleiher einen Kredit aufnehmen. Die Zinsen dafür sind so hoch, dass der Schuldenberg ständig wächst und man möglicherweise nie wieder schuldenfrei wird.
Man kann es sich einfach nicht leisten, seine Kinder in die Schule zu schicken. Oder man muss sie wegen schlechter Ernte wieder abmelden.
Die eigene Hütte ist provisorisch, sie besteht aus Lehm oder Stroh und muss alle paar Jahre erneuert und nach jedem Unwetter wieder aufgebaut werden.
Es gibt kein sauberes Trinkwasser in der Nähe. Man muss das Wasser aus weit entfernten Quellen holen und selbst dann macht es einen krank, wenn man es nicht abkochen kann.
Extreme Armut bedeutet nicht nur, dass elementare Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Sie geht oft Hand in Hand mit einem entwürdigenden Gefühl der Ohnmacht. Selbst in Ländern, die demokratisch und gut regiert sind, haben Befragte der Weltbank-Studie immer wieder Situationen beschrieben, in denen sie Demütigungen widerstandslos hinnehmen mussten. Werden einem die wenigen Habseligkeiten gestohlen und man meldet den Diebstahl der Polizei, ermittelt diese möglicherweise gar nicht erst. Auch vor Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch bietet das Gesetz nicht unbedingt Schutz. Außerdem muss man mit der ständigen Scham leben, seine Kinder nicht ausreichend versorgen zu können. Armut ist eine Falle. Man verliert irgendwann die Hoffnung, ihr je zu entkommen, weil selbst harte Arbeit letzten Endes kaum mehr garantiert als das nackte Überleben.12
Die Weltbank definiert extreme Armut so: Das Einkommen reicht nicht aus, um elementare menschliche Bedürfnisse zu befriedigen – ausreichend Nahrungsmittel, Wasser und Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu sanitären Einrichtungen, zu einer Gesundheitsversorgung und zu Bildungseinrichtungen.
Zwischen 1990 und 2015 haben sich mehr als eine Milliarde Menschen aus der extremen Armut befreit. Wir können also mit Fug und Recht behaupten: Die globale Armutsquote ist heute niedriger als je zuvor. Mit Blick auf die aktuellsten verfügbaren Daten leben aber immer noch 736 Millionen Menschen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag – das ist die von der Weltbank festgelegte Armutsgrenze.13
Vielleicht ist dein erster Gedanke, wenn du die Vorstellung von 1,90 Dollar pro Tag als Armutsgrenze vor Augen hast, dass es in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen doch möglich sein sollte, vergleichsweise viel damit zu machen – mehr als in reicheren Nationen. Vielleicht bist du selbst schon einmal mit dem Rucksack um die Welt gereist und mit weniger ausgekommen, als du je für möglich gehalten hättest. Du vermutest also, dass dieses Minimum nicht so extrem ist, dass es sich damit mancherorts viel leichter lebt als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in Deutschland oder in der Schweiz. Denkst du so etwas? Dann solltest du diese Gedanken sofort verabschieden. Die Weltbank hat das Kaufkraftniveau nämlich bereits angepasst: Ihre Berechnungen beziehen sich auf die Anzahl an Menschen, die täglich von einem Gesamtverbrauch an Gütern und Dienstleistungen leben – ob verdient oder selbst hergestellt –, der vergleichbar ist mit der Menge an Gütern und Dienstleistungen, die man in den Vereinigten Staaten für 1,90 Dollar kaufen kann.
In wohlhabenden Gesellschaften ist Armut relativ. Menschen fühlen sich arm, weil viele der in der Fernsehwerbung angepriesenen Produkte ihr Budget übersteigen – aber sie haben immerhin einen Fernseher. Wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten: Hier besitzen 97 % der Menschen, die vom Census Bureau als arm eingestuft worden sind, einen Farbfernseher. Drei Viertel von ihnen besitzen ein Auto. Ebenso viele verfügen über eine Klimaanlage.14
Ich nenne diese Zahlen nicht, weil ich bestreiten möchte, dass die Armen in Amerika mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber ihre Probleme bewegen sich, verglichen mit den Lebensbedingungen der Ärmsten dieser Welt, in einer anderen Dimension. Für die 736 Millionen Menschen, die in extremem Elend leben, gilt ein absoluter Armutsstandard, der sich an den elementaren Bedürfnissen bemisst. Diese Menschen werden – zumindest über eine bestimmte Spanne des Jahres – hungrig bleiben. Selbst wenn es ihnen gelingt, den Magen zu füllen, werden sie an Mangelerscheinungen leiden, weil ihnen wichtige Nährstoffe fehlen. Bei Kindern kann eine solche Mangelernährung das Wachstum beeinträchtigen und sogar bleibende Hirnschäden verursachen. Diese Ärmsten der Armen werden kaum in der Lage sein, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Selbst eine minimale Gesundheitsversorgung bleibt für sie in der Regel unerreichbar. Diese Art von Armut ist tödlich. Während ein Kind, das heute in Spanien geboren wird, mit einer Lebenserwartung von über 83 Jahren rechnen kann, haben Kinder, die in Ländern wie Sierra Leone, Nigeria und Tschad geboren werden, eine Lebenserwartung von weniger als 55 Jahren.15 Subsahara-Afrika ist nach wie vor die Region mit der weltweit höchsten Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren: Eines von 13 Kindern stirbt vor seinem fünften Geburtstag, eine zwanzigmal höhere Sterblichkeitsrate als in Australien und Neuseeland (eins von 263 Kindern).16 Und zu den Zahlen von UNICEF, nach denen jedes Jahr 5,4 Millionen Kleinkinder an vermeidbaren Armutsfolgen sterben, müssen wir noch Abermillionen ältere Kinder und Erwachsene hinzurechnen. Alles in allem bedeutet dies, dass jeden Tag zehntausende Menschen sterben. Menschen, die nicht sterben müssten; sie alle könnten gerettet werden, mit ganz einfachen, erschwinglichen Mitteln.
Als ich an der ersten Auflage dieses Buches schrieb, war Südasien seit Langem die Region mit den meisten in extremer Armut lebenden Menschen. In Indien lebten mehr extrem arme Menschen als in jedem anderen Land der Welt. Das hat sich in nur einem Jahrzehnt vollkommen geändert. Das Wirtschaftswachstum in Südasien führte zu einer starken Armutsreduktion: Die Zahl der Menschen, die in Südasien in extremer Armut lebten, ging von einer halben Milliarde (1990) auf 216,4 Millionen (2015) zurück. Indien war 2015 immer noch das Land mit der größten Anzahl extrem armer Menschen, nämlich 176 Millionen, und somit fast ein Viertel der weltweiten Gesamtzahl, aber diese Zahl dürfte weiterhin recht schnell sinken. Einigen Schätzungen zufolge würden 2019 mehr Nigerianer als Inder in extremer Armut leben.17
Die Asien-Pazifik-Region konnte den dramatischsten Rückgang von Armut verzeichnen. Hier ist die Armutsquote von 60 % im Jahre 199018 auf erstaunliche 2,3 % im Jahre 2015 gesunken (und das, obwohl in China immer noch fast 10 Millionen Menschen in extremer Armut leben sowie eine geringere Anzahl in anderen Ländern dieser Region).
Der Armutsbericht 2018 der Weltbank enthält eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: In den 25 Jahren zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil der extrem Armen weltweit um durchschnittlich einen Prozentpunkt pro Jahr gesunken, von fast 36 % auf 10 %. Die schlechte Nachricht: Dieser Trend hat sich verlangsamt. Zwischen 2013 und 2015 ist die Quote insgesamt nur um einen Prozentpunkt gesunken. Dies liegt daran, dass die Armutsbekämpfung in Subsahara-Afrika, der Region, in der weltweit die meisten extrem armen Menschen leben, langsamer voranschreitet als in Asien. Subsahara-Afrika ist auch die Region mit dem höchsten Armutsanteil – etwa vier von zehn Menschen sind betroffen. Die Weltbank berichtet, dass „extreme Armut zunehmend zu einem subsahara-afrikanischen Problem wird“ und stellt fest, dass „von den 28 ärmsten Ländern der Welt 27 in Subsahara-Afrika liegen, alle mit Armutsraten von über 30 Prozent“. Die Brookings Institution, ein amerikanisches Forschungsinstitut, fügt hinzu: „Bis 2023 wird der Anteil Afrikas auf über 80 % ansteigen (von 60 % im Jahr 2016). Damit bis 2030 die extreme Armut in Afrika beendet werden kann, müsste von jetzt an mehr als ein Mensch pro Sekunde langfristig dem Elend entkommen; stattdessen werden in Afrika immer mehr Menschen extrem arm.“19
Wohlstand heute
Im September 2018 gehörte zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mehr als die Hälfte aller lebenden Menschen zur Mittelschicht oder sogar zu einer höheren. Gemeint ist, dass sie über ein ausreichendes Einkommen verfügten, um z. B. ins Kino gehen, Urlaub machen, Konsumgüter wie Waschmaschinen kaufen oder eine Phase von Krankheit oder Arbeitslosigkeit überstehen zu können, ohne arm zu werden.20
Heute leben also etwa 3,8 Milliarden Menschen in einem Wohlstand, der früher nur Monarchen und dem Hochadel vergönnt war. Als „Sonnenkönig“ konnte es sich Ludwig XIV. leisten, Versailles zu bauen, den prächtigsten Palast, den Europa je gesehen hatte. Trotzdem war es ihm nicht möglich, seine Gemächer im Sommer so kühl zu halten, wie es Menschen in Industrieländern heute zu Hause problemlos können. Seine Gärtner waren trotz all ihrer Fähigkeiten nicht dazu in der Lage, ihm dieselbe Vielfalt an Früchten und Gemüse zu liefern, die wir das ganze Jahr über im Supermarkt zur Verfügung haben. Wenn Ludwig XIV. Zahnschmerzen bekam oder krank wurde, standen seinen Ärzten nur Methoden zur Verfügung, die uns heute Angst und Schrecken einjagen.
Es geht uns heute nicht nur besser als dem Sonnenkönig vor Jahrhunderten. Wir genießen auch einen höheren Lebensstandard als unsere Urgroßeltern – schon allein deshalb, weil wir mit einer 30 Jahre höheren Lebenserwartung rechnen dürfen. Noch bis vor einem Jahrhundert starb eins von 10 Kindern bereits im Säuglingsalter. In den meisten Industriestaaten liegt die Zahl heute bei weniger als einem von 200 Kindern.21 Ein weiterer wichtiger Indikator unseres Wohlstands ist die bescheidene Zahl an Stunden, die wir arbeiten müssen, um unseren Grundbedarf zu erwirtschaften. Amerikanerinnen geben heute im Schnitt nur 6,4 % ihres Einkommens für Lebensmittel aus.22 Wenn ein US-Bürger also 40 Stunden pro Woche arbeitet, benötigt er gerade einmal zwei Stunden, um sich für die ganze Woche mit Nahrung zu versorgen. Er kann den Großteil seines Einkommens für Konsumgüter, für Freizeitaktivitäten und für seinen Urlaub ausgeben.
Und dann gibt es noch die Superreichen, die ihr Geld für palastartige Häuser, für lächerlich große, luxuriöse Boote und für Privatflugzeuge ausgeben. Laut Forbes gab es 2019 weltweit 2.153 Milliardäre – fast doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Sie werden immer reicher und vergrößern mehr und mehr die Kluft zwischen sich und einfachen Arbeitnehmerinnen.23 Für genau solche Kunden hat Boeing Business Jets im Dezember 2018 den BBJ 777X auf den Markt gebracht: ein neues Boeing Business Jet-Modell, das auf der Boeing 777 basiert und das ohne Zwischenstopp die halbe Welt und mehr umfliegen kann. Der Preis dafür? 450 Millionen Dollar für ein „grünes“ Flugzeug – und nein, das bedeutet nicht, dass von ihm keine CO2-Emissionen ausgehen. Es bedeutet schlicht, dass das Flugzeug ohne Innenausstattung geliefert wird. Die Innenausstattung wird den Kundenwünschen entsprechend später für weitere 25 bis 50 Millionen Dollar eingebaut. Im kommerziellen Betrieb bietet dieses Flugzeug 365 Passagieren Platz. Die Privatversion befördert um die 35 Passagiere.24 Vom Preis einmal ganz abgesehen, ist der Besitz solch eines überdimensionalen, nur wenige Menschen befördernden Flugzeugs ein sicherer Weg, einen ganz individuellen, gut sichtbaren Beitrag zur Erderwärmung zu leisten. Wenn es aber nur um die Verschwendung von Geld und Ressourcen geht, ist eine Luxusyacht tatsächlich nicht zu übertreffen. 2017 bemerkte der Business Insider: „Es ist für die reichsten Menschen der Welt selbstverständlich geworden, Millionen, ja sogar Milliarden für verschwenderische Superyachten auszugeben.“ Milliardäre wetteifern darum, die Besitzer der Yacht aller Yachten zu sein – ein Titel, den derzeit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir von Abu Dhabi und Besitzer der Azzam, innehat. Mit einer Länge von 180 Metern hat die Azzam die bisher größte Yacht Eclipse des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch geschlagen. Sie soll Schätzungen zufolge 400 Millionen Dollar gekostet haben und bietet Platz für 36 Gäste. Superyachten dieser Art sind sehr umweltschädlich, sie verbrauchen immense Mengen an Diesel. Die Tanks der Azzam z. B. fassen eine Million Liter – das ist das 20.000-fache eines typischen Kleinwagens und mehr als das Fünffache eines Verkehrsflugzeugs.25
Als ich an der ersten Auflage dieses Buches saß, fand ich in einer Sonntagsausgabe der New York Times eine Sonderbeilage – ein 68 Seiten starkes Hochglanzmagazin, das nur aus Anzeigen für Rolex, Patek Philippe, Breitling und andere Luxusmarken bestand. Es wurden keine Preise angegeben, aber eine Lobeshymne über die Wiederbelebung des mechanischen Chronometers gab immerhin einen Hinweis auf die Uhren am unteren Ende der Preisskala. Der Artikel räumte gleich zu Beginn ein, dass preiswerte Quarzuhren extrem genau und sehr praktisch seien, dass aber „die mechanische Bewegung etwas besonders Faszinierendes“ habe. Mag sein, aber was kostet es nun, dieses Faszinosum am Handgelenk zu tragen? „Du magst glauben, der Wechsel zu einer mechanischen Uhr sei ein teures Unterfangen, aber es gibt bereits im Preissegment von 500 bis 5.000 Dollar eine große Auswahl“. Zugegeben, „diese Einstiegsmodelle sind ziemlich schlicht: Sie haben ein einfaches Uhrwerk, eine einfache Zeitanzeige, ein einfaches Dekor und so weiter.“ Woraus wir schließen können, dass der Großteil der angebotenen Uhren mehr als 5.000 Dollar kostet – hundert Mal mehr als das, was man für eine zuverlässige, sehr präzise Quarzuhr ausgeben müsste. Dass es einen Markt für solche Produkte gibt – einen, für den sich ein derart kostspieliges Werbemagazin in The New York Times rentiert –, ist ein weiterer Indikator für den Wohlstand unserer Gesellschaft.26
Falls du jetzt den Kopf schüttelst über die Exzesse der Superreichen: Sei nicht voreilig. Denk einmal kurz darüber nach, wofür viele Amerikaner mit durchschnittlichem Einkommen ihr Geld ausgeben. Fast überall in den USA kosten die empfohlenen acht Gläser Wasser pro Tag weniger als ein Cent – aus dem Wasserhahn. Dennoch entscheiden sich Millionen von Menschen regelmäßig für gekauftes Wasser, wobei eine typische Flasche Wasser etwa 1,50 Dollar kostet. Wasser von Marken wie Fiji, das von den Fidschi-Inseln importiert wird, sogar 2,25 Dollar. Trotz der Umweltbedenken ob der unglaublichen Energieverschwendung, die die Herstellung und der Transport von abgefülltem Wasser bedeuten, kaufen die Amerikaner immer mehr davon. 2017 stieg die Gesamtmenge gekauften Wassers auf 51,9 Milliarden Liter27