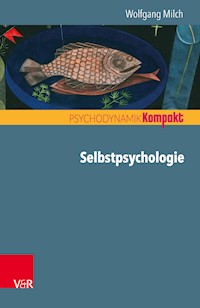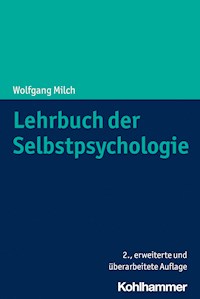
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Lehrbuch ist eine gut verständliche Einführung in die psychoanalytische Selbstpsychologie und die Intersubjektive Psychoanalyse. Es stellt umfassend die grundlegenden Konzepte der ursprünglich von Heinz Kohut (1913-1981) begründeten Selbstpsychologie dar und wendet sie auf wesentliche Krankheitsbilder an. Der Leser erhält einen Einblick in die unterschiedlichen Linien, die sich seit den 1980ern entwickelt haben, und in die wichtigsten Kontroversen und Forschungsthemen. Das Buch eignet sich gleichermaßen für Lehre und Praxis, da es die Erkenntnisse der modernen Säuglings- und Kleinkindforschung sowie der Neuroforschung im Hinblick auf den therapeutischen Prozess detailliert erörtert. In der 2. umfassend überarbeiteten Auflage wurden neue Vorstellungen zur Selbstpsychologie integriert. Dazu gehören u. a. weiterentwickelte intersubjektive und kontextuelle Vorstellungen, wie die gegenseitige Entwicklung im therapeutischen Prozess, die pathologische Anpassung und entwicklungsorientierte Deutungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 769
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort
Danksagung
Einführung und Benutzerhinweise
Teil I Allgemeine psychoanalytische Selbstpsychologie
1 Heinz Kohut
1.1 Das Leben von Heinz Kohut
1.2 Die klassische Fundierung der Gedanken Kohuts
1.2.1 Die dynamische Perspektive
1.2.2 Die topographische Perspektive
1.2.3 Die psychoökonomische Perspektive
1.2.4 Die genetische Perspektive
1.2.5 Die strukturelle Perspektive
1.3 Empfohlene Literatur
2 Die bedeutendsten Werke von Heinz Kohut
2.1 Introspektion, Empathie und Psychoanalyse. Zur Beziehung zwischen Beobachtungsmethode und Theorie
2.2 Formen und Umformungen des Narzissmus
2.3 Die psychoanalytische Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen
2.4 Narzissmus (Analyse des Selbst)
2.4.1 Das grandiose Selbst und die idealisierte Elternimago
2.4.2 Idealisierende Übertragung
2.4.3 Die Spiegelübertragung
2.4.4 Die Spiegelübertragung unter genetisch-dynamischen Gesichtspunkten
2.5 Die Heilung des Selbst
2.5.1 Selbstpsychologie versus klassische Theorie
2.5.2 Das bipolare Selbst
2.5.3 Die Klassifikation der Selbststörungen
2.5.4 Der Ödipuskomplex und Selbstpsychologie
2.5.5 Angstentwicklung und Aggression
2.5.6 Reaktionen auf »Die Heilung des Selbst«
2.6 Wie heilt die Psychoanalyse?
2.6.1 Die Analysierbarkeit von Selbststörungen
2.6.2 Das Problem der wissenschaftlichen Objektivität und die Theorie der psychoanalytischen Behandlung
2.6.3 Die Natur der psychoanalytischen Heilung
2.7 Kohuts Seminare und Vorlesungen
2.8 Empfohlene Literatur
3 Weiterentwicklungen bei Schülern und Nachfolgern Kohuts
3.1 Die traditionelle Selbstpsychologie
3.2 Intersubjektivität
3.3 Das Selbst und die motivationalen Systeme
3.4 Relationale Selbstpsychologie
3.5 Empfohlene Literatur
4 Grundlegende Konzepte der Selbstpsychologie
4.1 Einfühlung, Empathie, Introspektion
4.1.1 Ideengeschichtlicher Hintergrund
4.1.2 Der klassische Gebrauch der Begriffe Einfühlung und Empathie
4.1.3 Die Bedeutung der Empathie in der psychoanalytischen Selbstpsychologie
4.1.4 Exkurs: Die Entwicklung der Empathie im Kindesalter
4.2 Das Selbst und seine Objekte
4.2.1 Das Selbst
4.2.2 Die Entwicklung des Selbst in verschiedenen Lebensaltern
4.2.3 Pathologische Selbstzustände
4.2.4 Das Selbstobjekt
4.2.5 Das sich verändernde Konzept des Selbstobjekts
4.2.6 Selbstobjektübertragungen
4.2.7 Fantasie-Selbstobjekte
4.2.8 Gibt es »negative« Selbstobjekte?
4.2.9 Pathologische Anpassung
4.3 Kohärenz und Fragmentierung
4.4 Intersubjektivität
4.5 Motivationssysteme
4.6 Empfohlene Literatur
5 Behandlungsziele und kurative Faktoren
5.1 Das Menschenbild in der psychoanalytischen Selbstpsychologie
5.2 Behandlungsziele
5.2.1 Die Stärkung des Selbst
5.2.2 Wiederaufnahme eines gestörten Entwicklungsprozesses
5.2.3 Neue Entwicklungen
5.2.4 Die Förderung eigenanalytischer Fähigkeiten
5.2.5 Kurative Faktoren
5.3 Empfohlene Literatur
6 Selbststörungen
6.1 Definition: Selbststörungen – Selbstobjektstörungen
6.2 Ätiologie
6.3 Einteilung der Selbststörungen
6.4 Pathologische Selbstzustände
6.4.1 Pathologische Selbstzustände im engeren Sinne
6.4.2 Pathologische Verhaltensmuster
6.4.3 Sexualisierung
6.4.4 Aggressivierung
6.4.5 Narzisstische Wut
6.4.6 Acting out
6.5 Horizontale und vertikale Spaltung
6.6 Defensive und kompensatorische Strukturen
6.7 Empfohlene Literatur
7 Therapeutischer Prozess
7.1 Prinzipien und Setting
7.2 Selbstobjektübertragungen
7.2.1 Alter-Ego-Übertragung
7.2.2 Idealisierende Übertragung
7.2.3 Spiegelübertragung
7.2.4 Verschmelzungsübertragung
7.2.5 Kreative Übertragung
7.2.6 Adversative Übertragung
7.3 Aversive Übertragungsformen
7.3.1 Widerstand und Abwehr
7.3.2 Angst vor Wiederholungen und der Unterbrechungs-Wiederherstellungsprozess
7.4 Gegenübertragung
7.5 Selbstobjektgegenübertragung
7.6 Neue Beziehungserfahrungen
7.7 Regression im therapeutischen Prozess
7.8 Die Beendigung der Therapie
7.9 Empfohlene Literatur
Teil II Krankheitsbilder und spezielle Anwendungen
8 Neurosen
8.1 Definition und Symptomatik
8.2 Psychodynamische Neueinschätzung der ödipalen Pathologie
8.3 Therapie
8.4 Fallbeispiel: Psychotherapie einer Patientin mit Hysterie (nach Basch 1988/1992)
8.5 Empfohlene Literatur
9 Narzisstische Persönlichkeitsstörungen und narzisstische Verhaltensstörungen
9.1 Definition und Symptomatik
9.2 Überlegungen zur Psychogenese
9.3 Die Behandlung von narzisstischen Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen
9.4 Fallbeispiel
9.5 Exkurs: Ein weiteres Beispiel für die Behandlung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung: Die beiden Analysen des Herrn Z.
9.5.1 Gedanken zur Theorie
9.5.2 Die zwei Analysen des Herrn Z. und Kohuts Selbstanalyse
9.6 Empfohlene Literatur
10 Borderline-Persönlichkeitsstörungen
10.1 Definition und Symptomatik
10.2 Die Borderline-Diagnose
10.3 Überlegungen zur Psychogenese
10.4 Psychodynamische Überlegungen
10.5 Störungen der Mutualität bei Borderline-Patienten
10.6 Das Bindungssystem
10.7 Borderline und Spaltung
10.8 Borderline und Aggression
10.9 Therapie
10.10 Fallbeispiel
10.11 Empfohlene Literatur
11 Depressionen
11.1 Diagnostik
11.2 Psychodynamik: Die adaptive Funktion des depressiven Erlebens für das Ich bzw. Selbst
11.3 Krisen und Fragmentierungen des Selbst als ein Bezugspunkt für das Verständnis depressiver Erkrankungen
11.4 Das Zusammenwirken aktueller Erkrankungsbedingungen und vorausgegangener Selbstobjekterfahrungen depressiver Patienten im Verlauf psychoanalytischer Behandlung
11.5 Veränderungen in der psychoanalytischen Behandlungssituation durch das Verständnis für Selbst und Selbstzustand
11.6 Fallbeispiel
11.7 Empfohlene Literatur
12 Psychosomatische Störungen
12.1 Definition und Symptomatik
12.2 Psychobiologische Regulationen und Affekte
12.3 Psychobiologische Regulationen und Bindung
12.4 Störungen der Mutualität
12.5 Therapie
12.6 Fallbeispiel
12.7 Empfohlene Literatur
13 Psychotische Störungen
13.1 Definition und Symptomatik
13.2 Überlegungen zur Psychogenese
13.3 Psychose als Desintegration des Selbst
13.4 Die wechselseitige (mutuelle) Regulation der Affekte
13.5 Die Bindung
13.6 Therapeutische Überlegungen
13.7 Fallbeispiel
13.8 Empfohlene Literatur
14 Suizid und Suizidversuch
14.1 Klassische psychoanalytische Theorien
14.2 Überlegungen zur Psychogenese
14.3 Suizid als Störung des Selbst
14.4 Narzisstische Wut und Selbsthass
14.4.1 Entwicklung des explorativ-assertiven Motivationssystems
14.4.2 Entwicklung des aversiven Motivationssystems
14.5 Kurative Fantasien
14.6 Therapeutische Überlegungen
14.7 Fallbeispiel
14.8 Empfohlene Literatur
15 Perversion
15.1 Definition und Symptomatik
15.2 Überlegungen zur Psychogenese und Psychodynamik
15.3 Therapeutische Überlegungen
15.4 Fallbeispiel
15.5 Empfohlene Literatur
Teil III Kinderanalyse und Einflüsse anderer Wissenschaften
16 Kinderanalyse – selbstpsychologische Aspekte
16.1 Kinderanalyse und die Entwicklung der Selbstpsychologie
16.2 Kinderanalyse und Erwachsenenanalyse
16.3 Kinderanalyse und die Basiskonzepte der Selbstpsychologie
16.4 Der therapeutische Prozess in der selbstpsychologisch informierten Kinderanalyse
16.5 Kinderanalyse und Bezugspersonen der Patienten
16.6 Das Spiel in der Kinderanalyse
16.7 Klinische Illustrationen
16.8 Zu Selbstobjektübertragungen
16.9 Zum Unterbrechungs-Wiederherstellungs-Prozess
16.10 Empfohlene Literatur
17 Einflüsse anderer Wissenschaften auf die psychoanalytische Selbstpsychologie
17.1 Philosophie
17.2 Säuglings- und Kleinkindforschung
17.3 Neurowissenschaften
17.4 Empfohlene Literatur
Teil IV Anhang
Glossar
Organisationen und Informationen
Literatur
Personenregister
Sachregsiter
Der Autor
Prof. Dr. med. Wolfgang Milch ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker (DPV, IPA), Gründungsmitglied des International Council der IAPSP, und in eigener psychoanalytischer und psychotherapeutischer Praxis bei Gießen tätig.
Wolfgang Milch
Lehrbuch der Selbstpsychologie
Unter Mitarbeit von Hans-Peter Hartmann, Siegbert Kratzsch und Klaus Seiler
2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., erweiterte und überarbeitete Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-038704-1
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-038705-8epub: ISBN 978-3-17-038706-5
Geleitwort
Ernest S. Wolf
Es ist mir eine große Freude, den Leser in Wolfgang Milchs Lehrbuch der Psychoanalytischen Selbstpsychologie einzuführen. Die Selbstpsychologie entwickelte sich zunächst in der Zeit zwischen 1960 und 1970 aus der klassischen Psychoanalyse. Die ihr zu Grunde liegenden Ideen entstanden aus Heinz Kohuts kreativem Geist. Sein herausragender Mut erlaubte es ihm, seine Gedanken zur freudianischen Metapsychologie zur Diskussion zu stellen, darüber zu diskutieren, zu schreiben und diese zu lehren. Kohut war ein hoch geschätzter Lehrer am Chicagoer Psychoanalytischen Institut ebenso wie ein höchst angesehener Kollege unter den führenden Mitgliedern der amerikanischen psychoanalytischen Vereinigung in einer Zeit, als die Worte des Gründungsgenies Sigmund Freud den Anfang, die Mitte und den Endpunkt jeglicher psychoanalytischen Theorie bildeten. Kohut respektierte und liebte die Psychoanalyse, und ich habe nie wieder einen Psychoanalytiker getroffen, der so gründlich und tiefgreifend mit dem psychoanalytischen Denken vertraut war. Gerade weil er die gedanklichen Schlussfolgerungen der Psychoanalyse sehr schätzte, d. h. die Strukturen, die seine klinische Arbeit bestimmten, fühlte er sich auch ständig inspiriert, diese zu verbessern und zu vertiefen. Die Frucht seiner Bemühungen, das Feld der Psychoanalyse auszudehnen, ohne die Grundlagen der Freudianischen Strukturen zu beschädigen, war die Psychoanalytische Selbstpsychologie. Selbstverständlich hat sich die Selbstpsychologie auch nach Kohut erheblich weiterentwickelt und viele heutige Psychoanalytiker haben immer wieder wichtige neue Denkanstöße gegeben; so auch Wolfgang Milch, der zu dieser Weiterentwicklung wesentlich beitrug.
In dem vorliegenden Buch bringt Wolfgang Milch dem Leser diese neuen theoretischen Überlegungen Kohuts und seiner Nachfolger in umfassender Weise nahe. Wolfgang Milch verfügt über ein fundiertes Verständnis der Theorien Kohuts und ist ebenso in der Lage, die Entwicklungen der neueren, auf Kohuts Theorien gründenden Ideen, die sich mit dem Narzissmus und dem Selbst beschäftigen, anschaulich darzustellen. Wolfgang Milch weiß, dass sich die psychologische Welt keineswegs geändert hat, wir aber durch Kohut eine andere »Weltanschauung« gewonnen haben. Er sieht, dass wir mit Kohut nicht Freuds biologische Basis, den sogenannten mentalen Apparat, verlassen haben, sondern dass diese Vorstellung der Psyche nun in einem neuen Kontext verstanden wird, dessen Fokus auf der Beziehung liegt. Mit dieser Veränderung des Schwerpunkts entsteht mehr Freiheit, d. h. das klinische Postulat nach einem zu rigiden, erfahrungsfernen Standpunkt bewegt sich hin zu einer erfahrungsnäheren, empathischen Datensammlung. Wolfgang Milch beschreibt das Wesen dieses vertieften psychoanalytischen Denkens, das für die Transformationen charakteristisch ist, die Kohut und seine Nachfolger vollzogen haben.
Dieses Buch bietet allen an der Selbstpsychologie interessierten Kollegen, seien es Studenten oder erfahrene Kliniker, erstmals eine umfassende Einführung in die Entstehung, Entwicklung und Struktur der psychoanalytischen Selbstpsychologie und stellt somit eine einzigartige und wertvolle Orientierungshilfe in diesem Zweig der psychoanalytischen Theoriebildung dar.
Danksagung
Meinen Dank möchte ich zunächst meinen Patienten aussprechen, deren Behandlung für mich zu einer Quelle stets neuer Erkenntnis wurde. Ihre geduldige Beharrlichkeit – jenseits aller Widerstandsphänomene – ihre innere Wahrheit mit der Gültigkeit emotionaler Gewissheit, immer wieder zum Thema der gemeinsamen Arbeit zu machen, half mir so manches Mal, mich neuen Erfahrungen zu öffnen. Das nun vorliegende Buch ist mir auch Anlass, mich bei meinen analytischen Lehrern zu bedanken, allen voran Christel Schöttler, Ernest Wolf, Anna und Paul Ornstein, Joe Lichtenberg, Lotte Köhler und Hans Müller-Braunschweig. Die Diskussionen mit meinen analytischen Kollegen aus der »Maschsee-Gruppe«, Supervisanden und Freunden führten mich immer weiter in die komplexen Theorien und Konzepte der psychoanalytischen Selbstpsychologie und halfen mir zur Klärung offener Fragen. Besonders möchte ich mich bei meiner Frau, Silvia Konetzny-Milch, für ihre ständige Unterstützung, Ermutigung und fachliche Diskussion bedanken. Dem W. Kohlhammer Verlag und dessen Lektorat möchte ich für die kompetenten Anregungen und die Unterstützung bei der Erstellung des Buches danken.
Einführung und Benutzerhinweise
Dieses Buch soll dem Leser einen kurzgefassten, systematischen Zugang zur psychoanalytischen Selbstpsychologie ermöglichen. Die Selbstpsychologie entstand aus Heinz Kohuts Konzepten des Narzissmus und des Selbst und entwickelte sich in den letzten drei Dekaden zu einer der großen zeitgenössischen psychoanalytischen Schulen. Das zentrale Anliegen der Selbstpsychologie sind die Schicksale des Selbst in der Matrix seiner Objektbeziehungen und der damit verbundenen subjektiven, bewussten und unbewussten Kindheitserfahrungen. Danach ist die strukturierende Kraft, die der menschlichen Psyche innewohnt, das Bedürfnis, sich in einer kohäsiven Konfiguration, dem Selbst, zu organisieren und Beziehungen mit der Umgebung herzustellen, die die Kohärenz, Vitalität und Harmonie des Selbst fördern und die als Objekte des Selbst, also Selbstobjekte, verstanden werden. Als psychoanalytische Denkrichtung ist die Selbstpsychologie zwischen den Konzepten der Strukturtheorie und den Objektbeziehungstheorien anzusiedeln, da sie einerseits Konzepte der Selbststruktur benutzt, andererseits für sie das psychoanalytische Verständnis der Beziehung zentral ist.
Als ein Leitfaden führt dieses Buch in die Geschichte der Selbstpsychologie ein, die sich aus der psychoanalytischen Trieb-, Ich- und Objektbeziehungspsychologie entwickelt hat. Ihre Entstehung ist eng mit dem Werk ihres Begründers, Heinz Kohut, verbunden, wie in den ersten beiden Kapiteln beschrieben wird. Die spätere Entwicklung führte zu unterschiedlichen theoretischen und behandlungspraktischen Strömungen, die in dem folgenden Kapitel charakterisiert werden, allerdings wie in einer Momentaufnahme, da sie sich ständig weiterentwickeln und differenzieren und sich deshalb immer wieder dem Anliegen dieses Buches entziehen, den augenblicklichen Wissensstand festzuhalten. Das siebte Kapitel eröffnet dem Leser einen Überblick über gesicherte und weitgehend von allen selbstpsychologischen Strömungen übereinstimmend akzeptierte Konzepte zur Entstehung, Symptomatik, Psychodynamik und Behandlung der Selbststörungen.
Im zweiten Teil des Buches erfolgt die Darstellung einzelner Krankheitsbilder, der selbstpsychologischen Vorgehensweise in der Kinderanalyse sowie ein abschließendes Kapitel über die Einflüsse anderer Wissenschaften auf die Entwicklung und Theoriebildung in der psychoanalytischen Selbstpsychologie. Ein Glossar wichtiger Selbstpsychologischer Begriffe und Informationen über Organisationen und Veranstaltungen sollen vor allem denjenigen Lesern helfen, die erst mit der psychoanalytischen Selbstpsychologie in Berührung kommen wollen.
Nach längerem Abwägen aller Vor- und Nachteile habe ich mich in der Darstellung zu folgenden Besonderheiten entschlossen: Wenn von Patienten oder Therapeuten die Rede ist, benutze ich stets die männliche Form, nicht, weil sie der meinen entspricht, sondern ausschließlich wegen der Lesbarkeit: Ein inhaltlich am besten zu begründendes Abwechseln von weiblicher und männlicher Form wollte ich vermeiden. Wenn also nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, sind beide Geschlechter gemeint.
Ein weiteres Problem der Begriffswahl ergab sich für mich, wann ich Therapeut und wann Analytiker benutzen sollte. Einerseits handelt es sich um die psychoanalytische Selbstpsychologie, andererseits wird sie nicht nur von Analytikern, sondern auch von vielen analytisch orientierten Psychotherapeuten angewandt. Ich spreche deshalb im Allgemeinen von »Psychotherapeuten« und benutze »Analytiker« nur, wenn es sich speziell um einen solchen handelt.
Ein drittes Problem in der Wahl des Ausdrucks stellte sich mir bei dem Begriff Mutter, den ich im allgemeinen Sinne für eine primäre Bezugsperson benutze, wobei es sich auch um den Vater oder eine andere das Kind pflegende Person handeln kann. Eine Ausnahme besteht dann, wenn es sich um die konkrete Mutter eines bestimmten Patienten handelt.
Zuletzt möchte ich noch auf die spezielle Zitierung der Jahreszahlen hinweisen: Wenn ein Buch zuerst in einer Fremdsprache erschien und erst später in einer deutschen Übersetzung, so bezieht sich die erste Jahreszahl auf die ursprüngliche Publikation in der jeweiligen Landessprache und die zweite auf die deutsche Übersetzung.
Teil I Allgemeine psychoanalytische Selbstpsychologie
1 Heinz Kohut
1.1 Das Leben von Heinz Kohut
Heinz Kohut, der Begründer der Psychoanalytischen Selbstpsychologie, verstand den Lebenslauf eines Menschen als eine Kurve, auf der sich die Selbstwerdung in einem ganzheitlichen Lebenszyklus entfaltet (Kohut 1978a). Kohut wollte damit zu verstehen geben, dass der Lebenslauf nicht lediglich auf Kindheitskonflikte zurückgeführt werden kann, wie Freud annahm, sondern Ausdruck für ein sich entwickelndes und wechselhaftes Selbsterleben ist.
Die Lebenskurve von Heinz Kohut begann in Wien am 3. März 1913 und endete in Chicago am 8. Oktober 1981. In Kohuts Geburtsjahr verfasste Freud seine Arbeit über »Die Einführung des Narzissmus« (erschienen 1914) und Hitler verließ Österreich. Für den jungen Kohut bot Wien das emotionale und intellektuelle Klima, auf dem seine spätere kreative und wissenschaftliche Arbeit aufbaute. Das Wien vor dem 1.Weltkrieg war eine Stadt mit einer gewachsenen Kultur, ein Zentrum der Musik und der Literatur. Gleichzeitig beunruhigten den Vielvölkerstaat die Vorboten einer schweren Krise. Und gerade in Österreich nahmen die antisemitischen Kräfte zu.
Kohut stammte aus einer nicht besonders religiösen jüdischen Familie. Sein Vater war Teilhaber an einer Papier-Großhandlung und hatte eine musikalische Ausbildung als Pianist. Seine Mutter war ebenso musikalisch, so dass die Beschäftigung mit Musik ein wichtiger Teil in Kohuts Leben wurde. Seine erste psychoanalytische Arbeit befasste sich mit dem Genuss, Musik zu hören, die er gemeinsam mit seinem Jugendfreund und Musikwissenschaftler Sigmund Levarie verfasste (Kohut und Levarie 1950). Kohuts Familie gehörte der oberen Mittelklasse an. Im ersten Weltkrieg wurde der Vater zum Militärdienst eingezogen, so dass Heinz als Einzelkind in den nächsten fünf Jahren mit der Mutter die Härten des Krieges teilen musste. Gerade diese Periode scheint Kohuts Charakter geformt zu haben, und verlieh ihm die kreative Kraft, Wesentliches zum psychoanalytischen Gedankengut beizutragen. Kohut wurde von Privatlehrern unterrichtet, was es ihm manchmal in späteren Jahren schwer machte, in großen Gruppen aufzutreten.
Nach dem Kriege waren die Eltern sehr durch den Aufbau des Geschäftes in Anspruch genommen. Obwohl Kohut seiner Mutter nahe stand, lassen einige seiner Bemerkungen darauf schließen, dass sie eine distanzierte Frau war, die in ihrem sozialen Leben aufging und ihren Sohn in der Obhut von Angestellten und Hauslehrern ließ. Es ist anzunehmen, dass seine Eltern soziale Anstrengungen unternahmen, um sich im oberen Bürgertum und deren Kultur zu assimilieren. Diese soziale und emotionale Umwelt lässt natürlich Spekulationen über traumatische Erfahrungen und basale psychologische Mängel zu. Zu diesen möglichen Traumata kam in der späteren Adoleszenz und Studienzeit hinzu, dass er plötzlich aus dem Kreis nicht-jüdischer Freunde hinausgeworfen wurde als Folge der zunehmenden Nazifizierung. Diese Schwierigkeiten führten in seinen Studienjahren zu einer ersten kurzen Analyse bei Walter Marseilles und später bei August Aichhorn.
Häufig wurde Heinz Kohut in die Schweiz und nach Frankreich geschickt, um dort Ferienschulen zu besuchen. Das verstärkte seine Isolation, die er hinsichtlich seiner Eltern empfand. Selbst wenn die Familie zusammen war, schien die Distanz zwischen den Eltern und dem Sohn groß zu sein. Viel später, zwei Tage nach seinem 67. Geburtstag und in großen Schwierigkeiten wegen der feindseligen Haltung des Chicagoer Institutes, weil er orthodoxe psychoanalytische Vorstellungen herausgefordert hatte, äußerte er sich über die Leere bei seinen Geburtstagsfesten als Kind. An anderer Stelle schilderte er die hochherrschaftliche Atmosphäre im Elternhaus, die aber nicht das Gefühl einer essenziellen tiefen Einsamkeit wettmachen konnte. (Cocks 1994, S. 7). Eine Folge war die hohe Idealisierung seiner Tutoren und Lehrer, zu denen er auch nach der Emigration Kontakt behielt.
Nach der Reifeprüfung 1932 studierte er Medizin an der Universität in Wien. In dieser Zeit begann, wie bei vielen Wiener Intellektuellen, sein Interesse für die Psychoanalyse. Sein medizinisches Abschlussexamen legte er im November 1938 ab (nachdem bereits im März 1938 die Annektierung Österreichs erfolgt war). Der Tod des Vaters an Leukämie 1937 war für Heinz Kohut niederschmetternd.
In der »Reichsprogromnacht« musste sich Kohut mit seiner Mutter verstecken. Bisher hatte er die zunehmenden antisemitischen Ausschreitungen nicht ernst genommen, jetzt aber war es für ihn wie ein Erdbeben. Am Bahnsteig verfolgte er mit anderen die Abreise Freuds nach England. Über familiäre Verbindungen konnte er dann im Februar 1939 selbst nach England auswandern und arbeitete dort zunächst in einer Notfallambulanz. Ende Februar 1940 ging seine Reise per Schiff nach Amerika weiter. Er ließ sich in Chicago nieder, arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern und absolvierte zunächst eine neurologische, dann eine psychiatrische Facharztausbildung. Von 1947 bis 1950 war er Assistenz-Professor für Psychiatrie an der Universität von Chicago. Seine wegen der Emigration abgebrochene Lehranalyse bei Aichhorn setzte er bei Ruth Eissler fort. In den 50er Jahren wurde er relativ rasch einer der wichtigen Lehrer am Chicagoer Psychoanalytischen Institut und unterhielt Beziehungen zu anderen ehemaligen Wiener Psychoanalytikern wie Anna Freud, Kurt Eissler, Heinz Hartmann und Marianne Kris. Er wurde Mitherausgeber des Journal of the American Psychoanalytic Association (1965). Das Wichtigste in diesen Jahren war allerdings, dass Kohut zunehmend kritischer über die traditionelle psychoanalytische Theorie und Praxis nachdachte. Wie in dieser Zeit für jüngere Analytiker typisch, hatte er sich der psychoanalytischen Ich-Psychologie angeschlossen, die die Ich-Autonomie betonte, ebenso wie die Mittlerrolle des Ich zwischen inneren Trieben und Anforderungen der äußeren Umgebung. Skeptisch stimmte ihn die freudianische Mischung von Biologie und Psychologie. Diese Bedenken fanden allmählich ihren Ausdruck in der Psychologie des Selbst mit ihrem Verständnis der Psychoanalyse als einer Psychologie, deren Ziel es ist, die menschliche Erfahrung mittels Einfühlung zu studieren. Anlässlich der25-Jahr-Feier des Chicagoer Instituts im November 1957 betonte Kohut erstmals, wie wesentlich Empathie für das auf Erleben basierende psychoanalytische Wissen ist. Kohut vertrat die Auffassung, dass das innere Leben von Menschen nur durch Introspektion in unsere Innenwelt und durch Empathie gegenüber anderen beobachtet werden kann. Diese Ideen zur Empathie fasste er in einem Aufsatz von 1959 zusammen, der als die Basis seiner tiefsinnigen und konsequenten Kritik der psychoanalytischen Theorie und Praxis betrachtet werden kann (Kohut 1959/1977).
In den nächsten fünf Jahren beteiligte er sich zunehmend an nationalen und internationalen psychoanalytischen Gremien. 1963 und 1964 war er Vorsitzender der Chicagoer Psychoanalytischen Gesellschaft und von 1964 bis 1965 Präsident der Amerikanischen Psychoanalytischen Vereinigung. Er setzte sich besonders für einen gebührenden Platz der Kinderanalyse und die Aufnahme der nicht-ärztlichen Analytiker in die Amerikanische Psychoanalytische Vereinigung ein. Die in den folgenden Jahren verfassten Beiträge über Narzissmus, narzisstische Wut und narzisstische Persönlichkeitsstörungen (1966 – 1972) riefen aber zunehmend die Widerstände seiner psychoanalytischen Kollegen wach.
Auf der Höhe seines Erfolges erkrankte Kohut 1971 an lymphatischer Leukämie. Infolge der Krankheit intensivierte er seine Schreibtätigkeiten, zog sich sozial allerdings zunehmend zurück. Mit seinen Ideen war er zum Außenseiter in der Psychoanalyse geworden. Obwohl viele Kollegen seine besondere Bedeutung für die Entwicklung des Narzissmus-Konzeptes akzeptierten, hielten sie diese für eher randständig innerhalb des psychoanalytischen Theoriegebäudes. Während viele ehemalige Freunde und Kollegen sich von ihm distanzierten, entwickelte sich auf der anderen Seite ein fester Kreis von Analytikern um ihn, wie Ernest Wolf, Arnold Goldberg, Michael Basch, Marian und Paul Tolpin und Anna und Paul Ornstein, zu dem ursprünglich auch John Gedo gehörte. 1978 fand die erste Jahrestagung der Selbstpsychologie in Chicago statt. Kurz nach der vierten Tagung in Berkeley, Kalifornien, bei der er über seine wesentlichste Erkenntnis, die Bedeutung der Empathie für die Psychoanalyse, referierte, starb Kohut an den Folgen der Leukämie. Ein von ihm vorbereitetes Manuskript zum 50. Jahrestag des Psychoanalytischen Instituts in Chicago über Introspektion, Empathie und den Semi-Zirkel psychischer Gesundheit wurde von seinem Sohn Thomas Kohut gelesen. Die Aufnahme von Kohuts Ideen war in den deutschsprachigen Ländern zunächst enthusiastisch, machte dann aber einer Kritik Platz, die wenig Gutes an seinen neuen Ideen ließ. Erst später wurden seine Vorstellungen – besonders über Empathie, Selbstobjekt und Selbstobjektübertragungen in den »Mainstream« der psychoanalytischen Bewegungen aufgenommen (Milch, 2016).
1.2 Die klassische Fundierung der Gedanken Kohuts
Kohut wurde im Chicagoer Psychoanalytischen Institut ausgebildet und gehörte zeitlebens zu dessen Lehrkörper. Als Student hatte er die klassische freudianische Psychoanalyse vermittelt bekommen und gab sie als Lehrer so weiter, wie er die Ich-psychologisch geprägte Theorie aufgenommen hatte und allmählich erweiterte. Da Patienten nach einer ersten, »erfolgreichen« Analyse wegen noch bestehender Symptome in seine Behandlung zurückkehrten, entschloss sich Kohut, seine Behandlungstechnik zu verändern und weniger das Ich und seine Funktionen als das Erleben und die sich bei narzisstischen Störungen spontan entfaltende Übertragung in den Vordergrund der Behandlung zu stellen. Später verstand Kohut die psychoanalytische Selbstpsychologie als Weiterentwicklung der Ich-Psychologie (Kohut 1978 a, Search for the Self, S. 261), die ohne Bruch aus der psychoanalytischen Vergangenheit hervorging (S. 327). Als Kohut beide Theorierichtungen miteinander verglich, beschrieb er die Selbst-Psychologie als eine Psychologie, die sich für den »tragischen Menschen« interessiert, wohingegen die Ich-Psychologie den »schuldigen Menschen« in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stellt. Das bedeutet, dass die Ich-Psychologie die psychische Pathologie auf das Vorhandensein eines intrapsychischen Konflikts bezieht, dessen Lokalisierung und Ausmaß von einer mehr oder weniger misslungenen Anpassung an die Umwelt abhängig ist. Für das Auftreten psychischer Störungen sieht die Selbst-Psychologie neben ätiologisch bedeutsamer Konflikte auch Entwicklungsarretierungen durch Defizite als pathogenetisch relevant an, im Sinne nicht ermöglichter Erfahrungen, die die Entwicklungslinie des Narzissmus beeinträchtigen, so dass der Mensch tragisch am Sinn seines Lebens scheitert. Der schuldige Mensch lebt entsprechend seines Lustprinzips, indem er seine Triebe zu befriedigen sucht, was ihm allerdings nicht gelingt, weil dem die Umwelt und ihre Gebote sowie die daraus resultierenden inneren Kräfte entgegenstehen. Der tragische Mensch ist der moderne Mensch, der seine angeborenen und erworbenen Muster des Kernselbsts zu verwirklichen sucht, um ein kreatives und erfülltes Leben zu führen. Die Unfähigkeit dazu überschattet jedoch häufig die Erfolge, so dass er tragisch scheitert, weil seine inneren Potenziale ungelebt bleiben.
Nach Kohuts Auffassung ist es Freuds Genialität zu verdanken, dass er ein Konzept der inneren Welt beschrieb. Das Wesen psychologischer Dynamik ist danach dem bewussten Denken unzugänglich und wurde von Freud als das »Unbewusste« bezeichnet. Die Inhalte des Unbewussten werden vom Menschen als treibende Kräfte erlebt, deshalb bezog sich Freud bei psychischen Inhalten auf Triebe, die ihre notwendige Energie aus biologischen Quellen der Motivation beziehen. Da diese Kräfte im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Anforderungen stehen, sind Konflikte als Ursprung psychischen Leidens unausweichlich.
In seinen Bemühungen um eine Neudefinition der Psychoanalyse und ihrer Methode unterscheidet Kohut aber genau zwischen psychoanalytischen Konzepten und solchen, die von der Biologie oder der Sozialpsychologie ausgehen (1978a, S. 24). Die intrinsische Beziehung von der Methode zur Theorie bedeutet, dass die Art der Untersuchungsmethode auch die qualitativen Dimensionen der gefundenen Ergebnisse mitbestimmt, welche wiederum die weiteren theoretischen Postulate beeinflussen. Das Vermischen von Theorien, die mit Hilfe methodisch verschiedener Erkenntnisprozesse formuliert wurden, ist deshalb unzulässig und hat für Kohut eine »Biologisierung der Psychologie« oder »Psychologisierung der Biologie« zur Folge. Am Beispiel der »Abhängigkeit« erklärt Kohut den Unterschied zwischen dem biologischen Konzept und dem psychologischen Konzept als »einer Angst vor oder einem Wunsch nach Abhängigkeit«. Diese Kritik macht auch vor Freuds Vermischung von biologischen und psychologischen Konzepten nicht Halt, die in der Vorstellung von Lebens- und Todestrieb zum Ausdruck kommt. Für Kohut ist dies keine akademische Frage, sondern er bezieht seine Kritik klassischer Paradigmen immer wieder auf die konkrete analytische Situation mit seinen Patienten. Sowohl Lebens- als auch Todestriebe sind als Triebe »biologische Konzepte« und können weder introspektiv erspürt noch empathisch mitempfunden werden, beides eine notwendige Voraussetzung für eine psychologische Theorie.
Als ordnende Prinzipien, um psychische Daten zu verstehen, bezieht sich Kohut auf Freud und unterscheidet fünf verschiedene Perspektiven, wobei er von dem Prinzip der Hierarchie psychischer Funktionen mit unterschiedlichen psychischen Funktionsebenen ausgeht (Siegel 1996/2000).1
Psychische Funktionsebenen nach Kohut
Dynamische Perspektive
Topographische Perspektive
Ökonomische Perspektive
Genetische Perspektive
Strukturelle Perspektive
1.2.1 Die dynamische Perspektive
Da Kohut immer wieder an der Ausweitung der Grenzen psychoanalytischer Behandlungsmöglichkeiten interessiert war, versuchte er auch klinisch das Spektrum der bis dahin analytisch behandelbaren Krankheitsbilder zu erweitern. In einer Arbeit über Borderline-Störungen (1951) überschritt er die Limitierungen bisheriger Konfliktmodelle: Übertragung als Wiederholung alter Dynamik mit neuen Objekten ist zwar sowohl für neurotische als auch für Borderline-Patienten typisch. Während aber bei Psychoneurosen das Wesentliche darin besteht, dass der unterdrückte Trieb nach Befriedigung verlangt, gilt für Borderline-Störungen, dass ein verletzliches, »narzisstisches Ich« Bestätigung sucht. Bei diesen Patienten können Triebe für vorrangig narzisstische Ziele eingesetzt werden, wie z. B. übermäßige genitale Aktivitäten oder orale Befriedigungen, die der eigenen Beruhigung dienen, so dass für Patienten mit Borderline-Störungen gilt: »Das Ziel aller psychischer Manöver liegt in der Wiederherstellung oder in dem Aufrechterhalten einer kritischen Balance des Selbstwertgefühls« (Kohut in P. H. Ornstein 1978a, S. 22).
1.2.2 Die topographische Perspektive
Mit dem topographischen Modell fasste Freud die drei psychischen Systeme des Bewussten, des Vorbewussten und des Unbewussten zusammen. Mit dieser Perspektive können Konflikte, die innerhalb eines Systems oder zwischen den Systemen auftreten, verstanden werden. Die aus dem Unbewussten auftauchenden Wünsche bezieht Freud auf sexuelle oder aggressive Inhalte, die die Ausgangspunkte für Konflikte darstellen. Da nach dieser Vorstellung jede Aktivität mit einem Ausdruck des Sexualtriebes verbunden ist, müssen sie von ihrer Verbindung zu den konfliktinduzierenden sexuellen Wünschen befreit werden, um eine normale Funktion ohne neurotische Hemmungen erlangen zu können. Der Sekundärprozess des Vorbewussten hat die Aufgabe, diese Aktivitäten zu desexualisieren.
Für Kohut besteht der Vorteil dieses Modells in der dynamischen Qualität und der Erklärung der intersystemischen Wechselwirkungen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes »Übertragung«, mit der Freud zunächst die Übertragung unbewussten Materials in das Vorbewusste meinte. Der spätere Gebrauch von Übertragungsphänomenen, um Aspekte der Beziehung von Patienten zu Therapeuten zu kennzeichnen, nennt Kohut demgegenüber »technische Übertragung«. Diese Unterscheidung ermöglicht Kohut, zwischen Situationen zu unterscheiden, in denen die Beziehung zu dem Therapeuten eine Übertragung darstellt, und solchen, in denen diese Beziehung andere Qualitäten ausdrückt. Der Analytiker bietet sich als Übertragungsfigur an, da er keine »reale« Bedeutung im Leben seines Patienten hat. Kohut nimmt an, dass der Analytiker wie ein Tagesrest für den Patienten fungiert und stellt fest: »Wenn er zum Unterstützer, Helfer, Freund, Belohner des Patienten würde, dann könnte er nicht genauso gut als Übertragungsobjekt gebraucht werden« (Kohut und Seitz 1963 in P. H. Ornstein 1978, S. 334 – 374).
Nach Kohut besteht Freuds Konzept der emotionalen Reifung bei dem heranwachsenden Kind darin, die Fähigkeit zu entwickeln, zwischen halluzinierten Wünschen und realen Befriedigungen zu unterscheiden. Kohut versteht Freud so, dass eine Art »optimaler Frustration« notwendig ist, um diese Fähigkeit herauszubilden. Eine optimale Frustration besteht in der Zeitverzögerung, die ein Kind erlebt, bis sein spezifischer Wunsch befriedigt wird. Durch diese Verzögerung erkennt das Kind, dass es aktive Schritte unternehmen muss, damit sein Wunsch erfüllt wird. Hinderlich sind Frustrationen, die entweder so stark sind, dass sie traumatisch wirken, oder Frustrationen, die minimal und damit zu unbedeutend für die Entwicklung dieser psychischen Fähigkeit sind (Siegel 1996/2000, S. 34).
Eine »optimale Frustration« verhilft zu einer maximalen Differenzierung von Unbewusstem und Vorbewusstem, von Primärprozess und Sekundärprozess. Zu starke oder zu geringe Frustrationen führen danach zu einer Fixierung auf dem Niveau unbewusster omnipotenter, vom Lustprinzip geprägter Vorstellungen und einem von infantiler Sexualität und Primärprozess bestimmten psychischen Funktionieren (Kohut und Seitz 1963 in P. H. Ornstein 1978, S. 334 – 374).
Die von Freud als »Realitätsprinzip« bezeichnete Fähigkeit ist eine Qualität des sekundärprozesshaften Denkens. Sie arbeitet im System »Vorbewusst« und unterscheidet sich vom Primärprozess, dem Lustprinzip und dem Unbewussten. Kohuts Verständnis der optimalen Frustration zeigt bereits in dieser Zeit seine Sensibilität für das Thema des Narzissmus. Ein verwöhntes (und unter-optimal frustriertes) Kind behält einen ungewöhnlich hohen Anteil von Narzissmus (oder Omnipotenz). Da es gleichzeitig nicht die benötigten Fähigkeiten aufweist, in der Realität zurechtzukommen, fühlt sich dieses Kind minderwertig. Kohut versteht narzisstische Omnipotenz als Folge eines Entwicklungsdefizits. Damit entfernt er sich von der psychoanalytischen Lehrmeinung in den 50er und 60er Jahren, die narzisstische Omnipotenz als Abwehr versteht. Später entwickelt Kohut aus diesen Ideen seine Entwicklungslinie des Narzissmus.
1.2.3 Die psychoökonomische Perspektive
Kohut hält die psychoökonomische Theorie für ein wesentliches psychoanalytisches Konzept, wobei er sich nicht der Metapher von »psychischer Energie« bedient, sondern von Zu- und Abnahme innerer Spannung spricht. Für ihn zielt die psychoökonomische Perspektive auf den Umgang mit Affekten und der Spannungsregulation. Ereignisse der frühen Lebensjahre wie z. B. reale Traumata oder Unterversorgung versteht er als Störung der Affekt- und Spannungsregulation, er muss also nicht auf adultomorphe Erklärungen oder psychologische Postulate kindlicher Fantasien zurückgreifen.
Die Kapazität der Psyche, intensive Affekte zu erleben, ist individuell unterschiedlich; die Psyche kann unter Gefühlsstürmen intakt bleiben, sie mag aber auch dem Ansturm nicht gewachsen sein und fragmentieren. Kohut ist sich bewusst, dass es sich um relative Fähigkeiten handelt, die von unterschiedlichen Faktoren abhängig sind: der Charakteristik des traumatischen Affekts, dem Zeitablauf und dem Zeitpunkt des Auftretens in Bezug auf das Entwicklungsstadium, der relativen Stärke der Psyche und den Milieufaktoren. Ein Trauma tritt dann auf, wenn ein subjektiv extremes Ereignis einen Affekt auslöst, der die psychische Fähigkeit überfordert, die innere Balance wieder herzustellen. Die Auswirkungen des Traumas sind von der Stabilität und Verletzlichkeit neuer Strukturen zum Zeitpunkt des Ereignisses abhängig. Dies gilt für die Kindheit, aber auch für den Verlauf einer Analyse (Siegel 1996/2000).
Bei einem Trauma handelt es sich darüber hinaus nicht um ein »objektiv« zu definierendes Ereignis, das ab einem bestimmten Grad und in einer bestimmten Qualität traumatisch wirkt. Die traumatischen Auswirkungen sind vielmehr auch davon abhängig, in welchem Maß das traumatische Ereignis einem anderen Menschen mitgeteilt werden kann und dieser seinerseits versteht, wie es dazu kam, indem er sich empathisch in den traumatischen Zustand einfühlt. Empathie ist für Kohut das wesentlichste psychoanalytische Mittel, um ein Trauma zu verstehen.
1.2.4 Die genetische Perspektive
Die genetische Sichtweise eröffnet ein Verständnis für die psychische Entwicklung eines Menschen und die Entstehung, Aufrechterhaltung oder Umgestaltung psychischer Symptome, sowie dafür, wie der psychohistorische Kontext die psychischen Inhalte geprägt hat. Kohut ist nicht wie Freud der Meinung, dass die Triebe und die Triebschicksale sowie die daraus entstehenden Fantasiebildungen die einzigen Determinanten menschlicher Pathologie darstellen. Aufgrund seiner klinischen Erfahrung räumt Kohut dem Einfluss der prägenden Umgebung auf die Entwicklung des Kindes wesentliche Bedeutung ein. Für diese Ansicht wurde er allerdings heftig kritisiert, weil er nicht entsprechend der damaligen Lehrmeinung sich ausschließlich auf innere psychische Inhalte bezog. Die Kritiker hatten Kohut insofern missverstanden, als dieser nicht die Umgebung in einem konkretistischen Sinne meinte, sondern wie die Umwelt von dem Kind erlebt wurde und wie die Auswirkungen waren, die sie auf die sich entwickelnde psychische Struktur hatte (Siegel 1996/2000).
1.2.5 Die strukturelle Perspektive
Die von Freud 1923 eingeführte Strukturtheorie unterscheidet drei psychische Strukturen, das Ich, das Über-Ich und das Es, wobei das Ich und das Es durch eine Verdrängungsschranke voneinander getrennt sind. Kohuts Überlegungen knüpften an seine Beobachtung an, dass es Bereiche gibt, in denen Ich und Es nicht von dieser Verdrängungsschranke getrennt sind und nannte diesen Bereich »Neutralisationsbereich ohne Übertragung« (»non-transference area of neutralization«). In diesem Bereich dringt kein unbewusstes Material durch die Verdrängungsschranke in das Vorbewusste ein. Die Erweiterung des Freud'schen Modells um einen übertragungsfreien Sektor an der Grenze zwischen Ich und Es wurde zu einem wesentlichen Ausgangspunkt für die Theorieentwicklung von Kohut. Es ist der Sektor innerhalb der Psyche, in dem »optimale Frustration« möglich wird und in dem nicht-konflikthafte und nicht-sexuelle Strukturen und Fertigkeiten zur Entfaltung kommen. Durch einfühlsame Reaktionen der Umgebung, z. B. auf die kindliche Lust, mit Faeces zu spielen, kann das Kind seine Triebwünsche desexualisieren und diese durch andere Formen des Verhaltens ersetzen. Traumatische Frustration dagegen verstärkt die Verdrängung, indem die Triebe hinter die Verdrängungsschranke zurückgedrängt werden, wo sie den Ausgangspunkt für eine Symptomentstehung bilden können. Neutralisierung als die Fähigkeit, Triebe unter die Herrschaft des Ichs zu stellen, entsteht durch die Identifikation des Kindes mit dem liebevollen Umgang der Eltern mit den kindlichen Aggressionen. Mittels Identifikation nimmt das Kind auf, wie es mit der eigenen Wut auf die gleiche, feste und liebevolle Weise umgehen kann. Wenn die Eltern auf die Wut des Kindes aber selbst mit Wut reagieren, identifiziert sich das Kind auch damit und bekommt einen harten, sadistischen Zug sich selbst gegenüber.
Das Über-Ich als Zensor gegenüber dem Ich und dem Es entsteht nach Freud durch die Introjektion moralischer Anforderungen wichtiger Bezugspersonen, häufig als Folge frustrierender Erlebnisse mit diesen. Für Kohut projiziert das Kind zunächst die eigene Omnipotenz auf die Eltern, so dass das Kind an diesen idealisierten Eltern selbst Anteil nimmt. Das Kind kommt in dieses Stadium, sobald es die eigene Schwäche nicht mehr verleugnen kann. Aber auch der auf die Eltern projizierte Narzissmus muss in den folgenden Entwicklungsperioden wegen der zunehmenden Konfrontation mit der Realität aufgegeben werden. Der Wunsch nach omnipotenten und allwissenden Eltern wird enttäuscht, aber das Bild der perfekten Eltern wird wieder introjiziert und stellt den Teil des Über-Ichs dar, der Ich-Ideal genannt wird. Das Ich-Ideal entsteht als Reaktion auf eine Frustration, um die Vorstellung von den allmächtigen Eltern nicht zu verlieren. Seine positive emotionale Qualität erlangt das Ich-Ideal durch die Projektion des ursprünglichen Narzissmus des Kindes auf seine Eltern (Kohut und Seitz 1963). Damit kann die Entstehung des Ich-Ideals als eine spezielle Modifikation des eigenen Narzissmus verstanden werden, die, vermittelt durch die Eltern, introjiziert wurde. Die Modifikation entsteht wie in dem Freud'schen Konzept durch Introjektion als Folge eines Verlustes und ist Kohuts Ausgangspunkt für seine Überlegungen zur »umwandelnden Verinnerlichung«.
Aus seiner praktischen Arbeit mit Patienten lernte Kohut zunehmend, sich von seinen ichpsychologischen Theorien kritisch zu distanzieren und vor allem auf das zu achten, was konkret von den Patienten über ihre inneren Zustände beschrieben wurde. Er war ständig und zeitlebens bemüht, von seinen Patienten zu lernen, wie in einem Interview mit Susan Quinn deutlich wurde (Peters 2014).
In vielen Bereichen hatten Kohuts neue Ideen einen großen Einfluss auf die Theorieentwicklung in der Psychoanalyse (Milch 2016b), wie z. B. die Bedeutung der Affekte und die intersubjektive Bedeutung der therapeutischen Beziehung.
Nach Kilian (1999, 2013) ließ sich das wachsende Interesse an Kohuts Ideen psychohistorisch erklären: Die Entwicklung seiner Ideen war eine notwendige Reaktion auf die durch den historischen Wandel hervorgerufene Strukturkrise der Psychoanalyse, die den wachsenden zeitlichen und kulturellen Rückstand der traditionellen Psychoanalyse zu einer veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit überbrücken kann. In der Phase einer expandierenden postindustriellen Gesellschaft ist das Selbst als persönliches Weltmodell jedes Einzelnen durch Massenzivilisation, Auflösung traditioneller Geschlechterrollen, soziale Mobilität und Schichtdurchlässigkeit immer wieder in Frage gestellt. Vernetzung durch Internet sowie soziale Medien und Bedingungen durch Pandemien können hier noch angefügt werden. Kompensatorische Versuche, Selbstkohärenz und Sinn zu finden, bekommen zunehmend mehr Bedeutung, auch in der analytischen Situation. Im Unterschied zur klassischen Strukturtheorie, die zum Verständnis der Übertragung die Frage stellte »Was macht der Patient jetzt mit mir?«, versucht die Selbstpsychologie über einen empathischen Zugang die Frage »Was bedeute ich dem Patienten?« mit diesem zu klären. Die Aufgabe dieser gemeinsamen Arbeit besteht darin, die Beeinträchtigungen des Selbst und seine bisher nicht realisierten Möglichkeiten zu verstehen und zu verändern.
1.3 Empfohlene Literatur
Butzer RJ (1997) Heinz Kohut zur Einführung.
Cocks G (1994) The curve of life: Correspondence of Heinz Kohut: 1923 – 1981.
Hermanns LM, Schröter M (2016) Heinz Kohut – Biographie und Rezeption. Luzifer-Amor 57.
Milch W (2016) Heinz Kohut (2013 – 2081) – Der empathische Psychologe des Selbst. In: M Conci, W Mertens (Hrsg) Psychoanalyse im 20. Jahrhundert. Freuds Nachfolger und ihr Beitrag zu modernen Psychoanalyse.
Peters UW (2014) Heinz Kohut. Über das Selbst und sich selbst.
Ornstein PH (1978) The Evolution of Heinz Kohut's Psychoanalytic Psychology of the Self. In: The Search for the Self, Bd. 1.
Siegel AM (2000) Einführung in die Selbstpsychologie. Das psychoanalytische Konzept von Heinz Kohut.
2 Die bedeutendsten Werke von Heinz Kohut
2.1 Introspektion, Empathie und Psychoanalyse.Zur Beziehung zwischen Beobachtungsmethode und Theorie2
In seiner Rezeption des Freud›schen Gedankengutes hatte Kohut bereits verschiedene weiterführende Einsichten gewonnen und einzelne Kritikpunkte geäußert, die er erstmals in dem Artikel über Introspektion und Empathie (1959) in zusammenhängender Form darstellte. Der Aufsatz beginnt mit der grundlegenden Frage nach der Beobachtungsmethode in den verschiedenen Wissenschaften und deren Auswirkung auf die Theoriebildung. Nach seinen Überlegungen lässt sich die äußere Welt mit unseren Sinnesorganen untersuchen, die innere Welt dagegen nicht: »Wir sprechen von physikalischen Erscheinungen, wenn die Werkzeuge unserer Beobachtung hauptsächlich unsere Sinne sind; wir sprechen von psychischen Erscheinungen, wenn unsere Beobachtungen hauptsächlich mittels Introspektion und Empathie zustande kommen« ... »Unsere Gedanken, Wünsche, Gefühle und Fantasien können nicht gesehen, gerochen, gehört oder ertastet werden. Sie haben im physikalischen Raum keine Existenz, und doch sind sie real und können in der Zeitmodalität beobachtet werden: durch Introspektion in uns selbst und durch Empathie, d. h. durch Sich-Einfühlen in die Introspektion anderer« (Kohut 1977b, S. 9). Das Vorgehen mittels Empathie und Introspektion kennzeichnet Kohut als die spezifische Untersuchungsmethode der Psychoanalyse und bezieht sich dabei auf Freud, der bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Lebens- und Todestrieb) nur das in seine Theoriebildung aufnahm, was auch mit der introspektiv-empathischen Beobachtungsmethode erfassbar war. Als Beispiel führt Kohut den Begriff »Trieb« an, der zwar an der Grenze zur biologischen Grundlage steht, aber dennoch aufgrund introspektiver Erfahrungen innerer Erlebnisweisen gewonnen wurde und eine Abstraktion von vielfältigen inneren Wahrnehmungen darstellt, die durch die gleiche psychische Qualität des Getriebenseins (des Wünschens, Wollens, Strebens usw.) charakterisiert sind.
Mit diesen einfachen Feststellungen legt Kohut den wissenschaftlichen Rahmen der Psychoanalyse als einer introspektiven Psychologie fest. Das erlaubt ihm, die psychoanalytische Beobachtungsmethode zu ihren Theorien in Beziehung zu setzen und die Inhalte und Grenzen der Methode zu beschreiben.
Definition psychologischer Phänomene: »Wir bezeichnen Phänomene als psychisch oder psychologisch, wenn unsere Beobachtung im Wesentlichen mit Hilfe von Introspektion und Empathie zu Stande kommt« (Kohut 1977b, S. 12).
Ein Phänomen ist somatisch, behavioristisch oder sozial, wenn die Beobachtungsmethode nicht vorrangig Empathie und Introspektion einsetzt.
Hierzu ein einfaches Beispiel: »Wir sehen einen ungewöhnlich großen Mann. Es ist nicht zu bestreiten, dass seine Größe für unsere psychologische Bewertung bedeutsam ist – ohne Introspektion und Empathie aber bleibt sie nur eine physikalische Eigenschaft. Erst wenn wir uns in ihn hineindenken, erst wenn wir durch Einfühlung seine ungewöhnliche Größe empfinden, als ob sie die unsere wäre, und innere Erlebnisse wiedererwecken, in welchen wir selbst uns verlegen als anders oder auffällig gefühlt haben, beginnen wir, die Bedeutung dieser ungewöhnlichen Körperlänge für den Betreffenden einzuschätzen, d. h. nun erst haben wir eine psychische Tatsache beobachtet« (Kohut 1977b, S. 11).
Als weiteres Beispiel führt Kohut das psychoanalytische Sexualitätskonzept an. Das Erleben des Sexuellen ist weder durch deren objektiven Inhalt noch durch die beteiligten Körperzonen ausreichend definiert. Das psychologische Konzept der Sexualität kann auch nicht durch Sexualhormone erklärt werden, die den Sexualapparat aktivieren. Der ausschlaggebende psychologische Nachweis der tatsächlichen Existenz sexueller Wünsche kann nur durch Introspektion und Empathie erbracht werden. Dafür sind auch, ungeachtet ihres hohen methodischen Wertes, die freie Assoziation und die Widerstandsanalyse nicht als Erkenntnisquellen per se, sondern als Hilfsmittel und Unterstützung für die empathische Beobachtungsmethode aufzufassen, da sie als solche keine psychischen Inhalte aufdecken können. Es lassen sich aber durchaus Widerstände gegenüber Introspektion und Empathie beobachten. Gründe für diese Widerstände können unerträgliche unbewusste Inhalte oder die Furcht sein, durch Spannungszuwachs hilflos gemacht zu werden. Bei Spannungsabfuhr durch Aktivität übernehmen das Denken und auch die Introspektion häufig die Rolle des Probehandelns als ein Zwischenglied zur Handlung. Wenn unerträgliche Ängste jegliche Spannungsabfuhr in Handlungen verbieten, kann eine übermäßige introspektive Selbstbeschäftigung als eine passive Hingabe an Fantasien, eine Flucht vor der Realität bedeuten.
Die empathisch-introspektive Methode muss wie andere Beobachtungsmodi sachkundig gehandhabt werden und hat Grenzen. So nimmt die Zuverlässigkeit der Empathie ab, je mehr sich der Beobachter vom Objekt seiner Beobachtung unterscheidet. Zum Beispiel verschließen sich gerade die Frühstadien der Entwicklung unserer Empathie, ähnlich wie archaische tiefe Schichten der Psyche. Wenn frühe Entwicklungsphasen erörtert werden, sollte deshalb auf die Verwendung von Termini verzichtet werden, die sich auf spätere Erlebnisweisen beziehen.
In der psychoanalytischen Situation sollte Introspektion dem aktiven und forschenden Geist dienen, der unsere Kenntnisse und Einsichten erweitert und vertieft. So gesehen hilft die empathisch-introspektive Methode, das psychoanalytische Vorgehen zu charakterisieren und von anderen therapeutischen Verfahren abzugrenzen. Als Beispiel nimmt Kohut die häufig geäußerte Kritik gegenüber der Psychoanalyse auf, dass diese nicht genügend zwischenmenschlich orientiert sei und einen Einpersonen-Bezugsrahmen gegenüber der Zwei- und Mehrpersonenpsychologie des sozialpsychologischen Feldes bevorzuge. Bei genauerer Definition des Begriffs »zwischenmenschlich« handelt es sich psychologisch gesehen um das Erleben der Beziehung verschiedener Personen zueinander, das nur der Introspektion oder empathischer Beobachtung zugänglich ist und sich dadurch von Vorstellungen wie interpersoneller Beziehung, Interaktion, Transaktion unterscheidet. Damit ist die Psychoanalyse eine Theorie, die die Mehrpersonenebene aus der introspektiven Sicht betrachtet und sich damit von der Beschreibung des äußeren Verhaltens und der sozialen Interaktion löst.
2.2 Formen und Umformungen des Narzissmus
Der »Analyse des Selbst« (Kohut 1971/1976) gingen zwei publizierte Vorträge voraus, welche die in dem Buch entwickelten Ideen vorbereiteten. In Formen und Umformungen des Narzissmus (Kohut 1966/1975) formulierte Kohut eine eigenständige, von der Triebentwicklung unabhängige Entwicklungslinie des Narzissmus mit speziellen Konfigurationen und Entwicklungszielen. (▶ Abb. 2.1). Dies bedeutete eine Abkehr des bislang von der Psychoanalyse vertretenen Konzepts, das von nur einer Entwicklungslinie, der der Triebe, ausging und auch Freuds Konzept der Objektliebe als Ziel des Reifungsprozesses und der Aufgabe des Narzissmus zugunsten der reifen Beziehung zu den Objekten verwarf. Narzissmus in der Definition einer libidinösen Besetzung des Selbst ist für Kohut weder krankhaft noch schädlich. Erst bei Störungen der narzisstischen Entwicklungslinie entstehen Symptome, so dass die pathologischen Strukturen neu geordnet und in die Persönlichkeit integriert werden müssen. Kohut hält allerdings Beeinträchtigungen der Entwicklung des Narzissmus in der Kindheit für unvermeidlich. Das Kind versucht die eigene Vollkommenheit wieder herzustellen, indem es zwei Systeme narzisstischer Allmacht erlebt: ein »narzisstisches Selbst« (später grandioses Selbst genannt) und eine »idealisierte Elternimago«. Beide Formen des Narzissmus haben ihre eigene Entwicklungslinie. Kohut nahm damals noch an, dass diese Formen des Narzissmus aus der Aufgabe des primären Narzissmus entstehen und durch einen Prozess internalisiert werden, der mit Erfahrungen des Objektverlustes verbunden ist (ähnlich wie Freud in Trauer und Melancholie, 1917).
Die Idealisierung der Eltern findet in der idealisierten Elternimago ihren Niederschlag und entsteht durch die kindliche Projektion eines Teils der eigenen ursprünglichen Vollkommenheit, Macht und Perfektion auf die Eltern. Die Idealisierung stellt keinen Endpunkt dar, sondern muss schließlich in eine Internalisierung der Ideale münden. Die zweite Möglichkeit, den ursprünglichen Zustand der Vollkommenheit wieder herzustellen, besteht in dem grandiosen Selbst. Die narzisstische Besetzung wird hier nicht in eine andere Person investiert, sondern für das eigene Selbst zurückgehalten. Während die idealisierte Elternimago der ungestörte Glanz der Idealisierung umgibt, sucht das grandiose Selbst Bewunderung, in Kohuts Worten, durch den »Glanz im Auge der Mutter« (1966 S. 252).
Abb. 2.1:Die Entwicklungslinie des Narzissmus.
2.3 Die psychoanalytische Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen
In dieser Arbeit erläutert Kohut (1968/1969) die therapeutischen Implikationen seines neuen Verständnisses des Narzissmus. Bei Erfahrungen von schweren Traumata können weder das grandiose Selbst noch die idealisierte Elternimago in die Persönlichkeit integriert werden. Daraus resultieren archaische Bedürfnisse des grandiosen Selbst und eine Suche nach idealisierbaren, spannungsregulierenden Objekten. Es handelt sich um narzisstische Konfigurationen, die als Folge des Traumas entstanden sind und die relativ stabil bleiben. In der therapeutischen Beziehung können sie als besondere Übertragungen wiederbelebt werden. Kohut bezeichnet diese Aktualisierungen der narzisstischen Konfigurationen als »narzisstische Übertragungen« und führt den Begriff »Spiegelübertragung« für die Mobilisierung des grandiosen Selbst und den Begriff der »idealisierenden Übertragung« für diejenige der idealisierten Elternimago ein.
2.4 Narzissmus (Analyse des Selbst)
Das Buch Narzissmus gehört inzwischen zu den »Klassikern« in der Psychoanalyse, das einen Wendepunkt markierte (Jessee 1995). Es wurde auch in den deutschsprachigen Ländern zunächst begeistert aufgenommen (Milch 2016).
Kohut versteht die psychoanalytische Theorie als einen sich kontinuierlich entwickelnden Prozess, so dass er ständig darauf bedacht bleibt, seine neuen Ideen im Kontext und in der Sprache der schon bestehenden psychoanalytischen Theorie, vor allem der Ich-Psychologie, zu erklären. So übernimmt er Heinz Hartmanns Definition des Narzissmus als »Besetzung des Selbst« und teilt dessen Annahme, dass sich das Selbst vom Ich unterscheidet und dass das Selbst nicht als eine Instanz der Psyche verstanden werden kann wie das Ich, das Es oder das Überich. Statt dessen hält er das Selbst für eine Struktur innerhalb der Psyche, ähnlich wie die Objektrepräsentanzen, mit unterschiedlichen, ja sogar widersprüchlichen Qualitäten, die sich allerdings unabhängig entwickelt.
Die Vorstellung von der unabhängigen Entwicklungslinie des Narzissmus entstand bei Kohut auf dem Hintergrund der Erfahrung über die psychoanalytische Behandlung von Patienten, die an einer Störung des Selbst leiden. Patienten mit einer Selbststörung gehen Selbstobjektbeziehungen ein im Unterschied zur Bezogenheit »wirklichen« Objekten gegenüber (»True Objects«). Der narzisstische Patient kann seine Objekte nicht als von sich getrennt erleben, aber er hat die Fähigkeit, einen stabilen narzisstischen Bezug zu diesen herzustellen, die ihm in der analytischen Behandlung erlaubt, dauerhafte Übertragungen einzugehen.
2.4.1 Das grandiose Selbst und die idealisierte Elternimago
Der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit den beiden wesentlichen Ausformungen des Narzissmus, die Kohut aus der nicht vermeidbaren Unvollkommenheit der mütterlichen Pflege in der frühsten Kindheit ableitet. Das Kind ersetzt die frühere Vollkommenheit der Dualunion zwischen Mutter und Kind durch die Aufrichtung eines grandiosen und exhibitionistischen Bildes seines Selbst und durch die Zuweisung der früheren Vollkommenheit an ein bewundertes, allmächtiges, aber nicht dauerhaftes Selbstobjekt. Auf diese Weise leitet Kohut zwei neue Begriffe ab, die er in die Metapsychologie des Narzissmus einführt: das grandiose Selbst und die idealisierte Elternimago. Unter günstigen Entwicklungsbedingungen werden Exhibitionismus und Größenfantasien des archaischen grandiosen Selbst phasenspezifisch adäquat in die erwachsene Persönlichkeit integriert und fördern die ichsyntonen Ambitionen, die Freude an der eigenen Aktivität und das Selbstgefühl. Unter ähnlich günstigen Bedingungen wird auch die idealisierte Elternimago in die Gesamtpersönlichkeit integriert. Als idealisiertes Überich introjiziert wird sie zu einem wichtigen Bestandteil der psychischen Organisation. Sie sorgt dafür, dass eigene Ideale ausgebildet werden und eigenen Idealen gefolgt werden kann (Morgenthaler 1973). Differenzialdiagnostisch grenzt Kohut die narzisstischen Störungen von Psychosen und Borderline-Störungen einerseits und von Neurosen andererseits ab. Patienten mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen können zwar regressiv einbrechen und dann Symptome aufweisen, die denjenigen von Psychosen und Borderline-Störungen ähneln. Aber sie haben stabile, jedoch in der Entwicklung zum Stillstand gekommene innere Konfigurationen, die ein Ausdruck für ein weitgehend kohäsives, wenn auch zeitweise störanfälliges Selbst sind. Die Stabilität der fixierten inneren Repräsentanzen lässt stabile, spezifische narzisstische Übertragungen ohne schwere Fragmentierungen zu. Gerade das spontane Auftreten einer narzisstischen Übertragung gilt als ein verlässliches diagnostisches Kriterium für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, im Unterschied zu Psychosen oder Borderline-Störungen. Im Vergleich zu narzisstischen Persönlichkeitsstörungen können Patienten mit klassischen Übertragungsneurosen sich und ihre Objekte differenziert wahrnehmen, und die Pathologie spielt sich nicht in dem relativ kohäsiven Selbst ab, sondern in den Objektbeziehungen. Ihre Pathologie lässt sich häufig in Begriffen von Konflikten mit inzestuösem Begehren zu Kindheitsobjekten beschreiben. Die auftretende Angst bezieht sich auf die drohende Strafe der Kastration oder des Objektverlustes. Im Vergleich dazu tritt die Angst eines Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung im Zusammenhang mit dem Bewusstwerden der eigenen Verletzlichkeit und seiner relativen Anfälligkeit für Fragmentierungen auf. Die zentrale Pathologie besteht in Fixierungen von narzisstischen Konfigurationen, die das Selbst seiner verlässlichen Quellen für die Kohäsion beraubt und eine Unfähigkeit erzeugt, das Selbstgefühl stabil aufrechtzuerhalten und zu regulieren. Eine unbewusste Konfiguration versteht Kohut als ein Muster von Bedürfnissen, Wünschen, Gefühlen, Fantasien und Erinnerungen innerhalb des Unbewussten. Die ödipale Entwicklung ist z. B. eine solche Konfiguration. Für Kohut lässt sich auch das grandiose Selbst und die idealisierte Elternimago als eine eben solche Konfiguration verstehen, die den Kern des narzisstischen Sektors der Persönlichkeit ausmachen3. Innerhalb des Unbewussten beeinflussen die Konfigurationen die Regulation des Verhaltens, das Selbstgefühl, die Ambitionen und auch die Vorstellung von einem idealen Anderen, mit dem eine Einheit gesucht wird.
Grandioses Selbst: Ich bin allmächtig.Idealisierte Elternimago: Du bist allmächtig, aber ich bin ein Teil von dir.
Die Abb. 2.2 und 2.3 (▶ Abb. 2.2 und ▶ Abb. 2.3) zeigen die schematisierte Darstellung eines Traumas jeweils für die Entwicklung des grandiosen Selbst und die idealisierte Elternimago.
Sowohl das grandiose Selbst als auch die idealisierte Elternimago können während einer Analyse wiederbelebt werden.
Abb. 2.2:Trauma in der Entwicklung des Größenselbst.
Abb. 2.3:Trauma in der Entwicklung der idealisierten Elternimago.
2.4.2 Idealisierende Übertragung
Bei dieser Form der Übertragung wird die idealisierte Elternimago mobilisiert. Idealisierung als Ausdruck einer Übertragung bei narzisstischen Störungen unterscheidet Kohut von anderen Formen der Idealisierung wie z. B. bei einem ödipalen Objekt oder bei der sogenannten »positiven Übertragung« von Neurosen.
Entsprechend der zeitlichen Einordnung der Ursachen einer Störung lassen sich verschiedene Unterformen der idealisierenden Übertragung unterscheiden. Patienten mit frühem Trauma leiden an einer allgemeinen, diffusen narzisstischen Verletzlichkeit, so dass sie Schwierigkeiten haben, ihr Selbstgefühl nach Kränkungen wieder herzustellen. Sie benötigen einen idealisierbaren Analytiker, um die erforderliche beruhigende und spannungsregulierende Funktion aufzubringen. Diese Form der idealisierenden Übertragung resultiert aus einem Defizit in der Beziehung zu den frühen Bezugspersonen: Das Kind wurde nicht vor Über- oder Unterstimulierung geschützt, es konnte nicht beruhigt werden, und seine Spannung erfuhr keine regulierende Unterstützung. Eine idealisierende Übertragung, die auf ein späteres Trauma zurückgeht, ist häufig der Beobachtung zugänglicher und leichter festzustellen (▶ Abb. 2.4). Sie entsteht durch massive, plötzliche Entidealisierungen der vorher noch idealisierten Objekte, wie diese z. B. bei sozialer Diskriminierung eines Elternteils auftreten kann. Das Verlangen nach Bindung an omnipotente Objekte als Ausdruck der idealisierten Elternimago existiert im Verborgenen weiter und ist entweder als horizontale Spaltung abgewehrt oder wird als vertikale Spaltung in Form eines abgespaltenen Persönlichkeitsanteils verleugnet (s. unten). Die notwendige schrittweise Entidealisierung des Objektes wird verhindert, eine umwandelnde Verinnerlichung ist nicht möglich und das Überich wird seiner notwendigen Ideale beraubt.
Der wesentliche Durcharbeitungsprozess unterstützt den langsamen Abzug der narzisstischen Libido von den narzisstisch besetzten archaischen Objekten. Dieser Prozess führt zu neuen psychischen Strukturen und Funktionen, da die Repräsentanzen eines Objekts und seiner Aktivitäten neu besetzt werden, was zum Aufbau des psychischen Apparats und seiner Funktionen hinführt (Kohut 1971/1976, Siegel 1996/2000). Zu dem Durcharbeitungsprozess gehören immer wieder Einschnitte in die Behandlungsbeziehung, die Kohut als Unterbrechung (»disruption«) bezeichnet und die im günstigen Fall in der therapeutischen Beziehung aufgefangen werden können. Häufig werden dadurch zunächst narzisstische Besetzungen zurückgenommen, sie regen aber dann die Bildung psychischer Strukturen durch umwandelnde Verinnerlichungen an.
Kohut warnt vor möglichen Gegenübertragungsreaktionen auf idealisierende Übertragungen, die beim Analytiker unbewusste grandiose Fantasien stimulieren, aber auch Gefühle von Verwirrung, Befangenheit und Scham auslösen können. Der Analytiker kann defensiv auf die Idealisierung des Patienten reagieren, was dazu führen kann, dass er die Übertragung zu früh anspricht, die Bedeutung idealisierter Personen aus der Vergangenheit überzieht oder die Idealisierung als Abwehr von Feindseligkeit auffasst und vorzeitig deutet. Eine solche defensive Reaktion des Therapeuten kann weit reichende Konsequenzen für die Behandlung haben, wenn die Mobilisierung der idealisierten Elternimago abgebrochen und damit der sich entwickelnde analytische Prozess der Behandlung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung empfindlich gestört wird.
2.4.3 Die Spiegelübertragung
Allmacht, Grandiosität und exhibitionistischer Narzissmus charakterisieren das grandiose Selbst, das neben der idealisierten Elternimago die andere unbewusste Struktur ist, die in der Behandlung narzisstischer Störungen reaktiviert wird (▶ Abb. 2.5).
In der Übertragung wird das grandiose Selbst als Spiegelübertragung mobilisiert, die Kohut nochmals in drei Formen unterteilte:
Spiegelübertragungen:
Verschmelzungsübertragung
Alter-Ego- und Zwillingsübertragung
Spiegelübertragung im engeren Sinne.
Abb. 2.4:Folgen von Traumata in der kindlichen Entwicklung.
Abb. 2.5:Übertragungsformen.
Bei der Verschmelzungsübertragung trat das Trauma früh in der Lebensgeschichte auf. Entsprechend muss der Therapeut auf basale Bedürfnisse und Erwartungen des Patienten eingehen. In der klinischen Situation existiert der Therapeut nur als Zubringer und Echo der Grandiosität und des Exhibitionismus des Patienten. Mit anderen Worten, er fungiert als Erweiterung des grandiosen Selbst des Patienten. Aus seinem Erleben heraus geht der Patient wie selbstverständlich davon aus, den Therapeuten kontrollieren und beherrschen zu können. Da sich der Therapeut seinerseits nur als Teil des Patienten wahrgenommen und benutzt fühlt, also in seiner eigenen Persönlichkeit übergangen, erlebt er in seiner Gegenübertragung die Beziehung als tyrannisch und aggressiv.
Die Alter-Ego- oder Zwillingsübertragung ist entwicklungsgeschichtlich reifer, so dass das grandiose Selbst schon einen gewissen Grad von Abgegrenztheit gegenüber dem Objekt erreicht hat. Klinisch erlebt der Patient den Therapeuten ähnlich wie das Bild, das er von seinem grandiosen Selbst hat und nimmt an, dass zwischen ihm und dem Therapeuten große Ähnlichkeiten bestehen4.
Die Spiegelübertragung im engeren Sinne ist die reifste Form dieser Gruppe von Übertragungen. Der Patient erlebt den Therapeuten als abgegrenzte Person, die allerdings für die vom grandiosen Selbst reaktivierten Bedürfnisse Bedeutung erlangt, im Sinne von Beantwortung und Bestätigung.
In allen Spiegelübertragungen wird der Analytiker zu einer Figur, von der Konstanz im narzisstischen Sektor ausgeht. Die Präsenz des Analytikers mit seinem geduldigen Zuhören und empathischen Interventionen, die dem Patienten seinen Selbstzustand spiegeln, verstärkt die psychischen Kräfte, die zur Kohäsion des Selbst des Patienten beitragen. Unterbrechungen oder andere Störungen der Spiegelübertragung können zu einer Fragmentierung führen, die sich psychisch als Dissoziation oder auf körperlich-psychosomatischer Ebene äußern kann. Werden diese Unterbrechungen therapeutisch fokussiert, können sie als eine Möglichkeit genutzt werden, um im Rahmen des Durcharbeitens die grandiosen Fantasien im therapeutischen Prozess wieder aufnehmen zu können.
2.4.4 Die Spiegelübertragung unter genetisch-dynamischen Gesichtspunkten
Unter genetisch-dynamischen Gesichtspunkten nimmt Kohut eine weitere Klassifizierung der Spiegelübertragungen vor. Die erste Form nennt er die primäre Spiegelübertragung, die dann auftritt, wenn das grandiose Selbst in der Behandlung mobilisiert wird und auf Spiegelung drängt.
Die zweite Form besteht in der reaktiven Mobilisierung des grandiosen Selbst, die aus einer Unterbrechung einer idealisierenden Übertragung entsteht. Da auch die Einfühlungsfähigkeit eines Therapeuten immer wieder an Grenzen stößt, lassen sich solche Unterbrechungen nicht vermeiden, sondern können nach Kohut als eine Gelegenheit genutzt werden, das grandiose Selbst zu fokussieren und therapeutisch zu bearbeiten. Dabei ist es therapeutisch nicht vorrangig, den akuten Regressionszustand zu explorieren, sondern die Bedeutung des der Unterbrechung vorausgehenden Ereignisses herauszuarbeiten, so dass die therapeutische Beziehung wiederhergestellt wird.
Die dritte Form der Spiegelübertragung ist die sekundäre Spiegelübertragung, die dann auftritt, wenn sich bereits eine idealisierende Übertragung etabliert hatte. Die Idealisierung ist ein Ausdruck für einen ersten Schritt in der Übertragung, der nützlich ist, um die Lebensgeschichte des Analysanden zu verstehen. Im weiteren Fortgang der Behandlung tritt hinter der Idealisierung der frühere Entwicklungsstillstand des grandiosen Selbst hervor, der sich als Spiegelübertragung manifestiert. Es handelt sich hier nicht um eine Reaktion auf eine Unterbrechung wie bei der reaktiven Mobilisierung des grandiosen Selbst, sondern um das sequenzielle Auftreten zweier Übertragungen, die sich auf frühere Traumata beziehen.
2.5 Die Heilung des Selbst
2.5.1 Selbstpsychologie versus klassische Theorie
Erst in diesem 1977a/1979 erschienenen Buch bricht Kohut mit der klassischen analytischen Theorie, die er als eine »Psychologie des psychischen Apparates« bezeichnet und die nach seiner klinischen Erfahrung einer Erweiterung bedarf, entsprechend seinem Entwurf der empathisch-introspektiven Methode. Diese neue Theorie bezeichnet er als erfahrungsnah, da sie vom Erleben der Patienten abgeleitet wird, im Gegensatz zu erfahrungsfernen Theorien, die aus abstrakten theoretischen Überlegungen und nicht aufgrund von klinischen Beobachtungen entstanden sind und bei denen die Gefahr besteht, dass sich viele zufällige Behauptungen einschleichen, die in einer wissenschaftlichen psychologischen Theorie keinen Platz haben sollten. Diese Überlegungen führten Kohut zu seiner Kritik an dem Freudianischen Theoriegebäude, das durch einfließende biologische Prinzipien und westliche Moral geprägt wird. Weil Freud die neue Wissenschaft legitimieren musste, war er darum bemüht, die Psychoanalyse mit der angesehenen Darwin'schen Biologie zu verbinden, indem er eine auf Trieben basierende Psychologie als Kernstück seiner neuen Psychologie annahm. Für Freud waren die Triebe die primären Motivatoren im menschlichen Handeln und Erleben. In den Grundannahmen beruhte seine Theorie mehr auf den zeitgenössischen biologischen Überlegungen und Spekulationen als auf wirklichen Beobachtungen in dem psychologischen Feld, das durch Empathie und Introspektion definiert ist.
Die Zeichen des Einflusses westlicher Moral zeigen sich in den Zielen der klassischen Psychoanalyse, die die angestrebte psychische Gesundheit als eine Sublimierung und Kanalisierung primitiver Triebenergien versteht. Ein weiterer Aspekt der Kritik ist das Ideal des Altruismus und der Selbstlosigkeit in der westlichen Grundhaltung, das sich in der psychoanalytischen Vorstellung wiederfindet, dass normale Entwicklung von der narzisstischen Position zur Objektliebe fortschreiten müsste. Man kann diese Perspektive so verstehen, dass psychische Gesundheit verlange, das Selbstinteresse aufzugeben und sich der Selbstlosigkeit zu verschreiben. Als Folge sahen viele Analytiker den Narzissmus als etwas Primitives und Minderwertiges an.
Zu den erwähnten westlichen Werten gehört auch Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit, die sich in der theoretischen Position in der Form niederschlagen, dass die langfristige Entwicklungsaufgabe des Menschen in der Loslösung von seinen Objekten besteht und dass die Ziele einer geglückten Behandlung in Trennung, Autonomie und Unabhängigkeit liegen. Nach Kohut verdichten sich diese nicht zufälligen Vorstellungen in dem klassischen Konzept des Ödipuskomplexes, der als Kernkomplex und als zentrale motivierende Kraft im menschlichen Leben angesehen wird.
Trotz seiner ärztlichen Grundhaltung war Freud weniger daran interessiert zu heilen als die Wahrheit zu erkennen und der Realität mutig ins Auge zu sehen. Die Umsetzung der Psychoanalyse im Behandlungsprozess führte ihn zu einer Betonung der Kognition und der Erweiterung des Wissens mit dem hauptsächlichen Ziel, das Unbewusste bewusst zu machen. Damit nimmt der Einfluss des realitätsbezogenen Ichs gegenüber den Kräften unbewusster Triebe zu. Kohut hält Freud für einen Vertreter der »wissenschaftlichen Objektivität«, der den Beobachter als völlig von dem Beobachteten getrennt sieht, also den Einfluss des Beobachters nicht anerkennt, so dass der Einfluss der Anwesenheit und der Handlungen des Analytikers unberücksichtigt bleiben. Kohut schätzt die klassische Theorie als zu eingeschränkt und simplifizierend ein, wenn sie Phänomene wie »Oralität« oder »Analität« als ein defensives Zurückweichen vor der ödipalen Position auffasst, die regressive Fixierungen auf einem Kontinuum der psychosexuellen Entwicklung darstellen. Für Kohut deckt diese Theorie nur einen kleinen Sektor der Persönlichkeit ab, verliert den Überblick über das komplexe Ganze und lässt wesentliche reale Auswirkungen des Kindheitsmilieus auf die Entwicklung eines Menschen unbeachtet.
2.5.2 Das bipolare Selbst
Aus der klinischen Erfahrung mit erwachsenen Analysanden formulierte Kohut seine Theorie über die Entwicklung des Selbst und seiner Objekte. Die Entwicklungskurve des Selbst führt von einem Kernselbst mit isolierten Fragmenten zu einem kohäsiven Ganzen unter dem Einfluss von einfühlsamen Reaktionen der auf spezifischen Entwicklungsbedürfnisse bezogenen Selbstobjekte. Diese Bedürfnisse sind um zwei psychologische Konfigurationen zentriert: Die eine Konfiguration, das grandiose Selbst, entsteht aus dem Bedürfnis nach Spiegelung, das von dem frühen Selbstobjekt erfüllt wird und durch dessen Reaktion der Exhibitionismus des Kindes akzeptiert und bestätigt wird. Die andere Konfiguration, die idealisierte Elternimago, drückt das Bedürfnis nach Verschmelzung mit einem idealisierten Selbstobjekt aus, das dem Selbst ein Gefühl von Vollkommenheit, Sicherheit und Ganzheit vermittelt. Diese beiden Konfigurationen werden zu den Komponenten einer übergeordneten Konfiguration, dem »bipolaren Selbst«. Das bipolare Selbst enthält damit zwei Pole, den der Ambitionen und den der Ideale. Der Pol der Ambitionen wird durch den gesunden, expansiven, exhibitionistischen Narzissmus konstituiert, der in der späteren Entwicklung in Form von Ambitionen erlebt werden kann. Der Pol der Ideale entsteht aus dem Verlangen, mit einem stabilisierenden, spannungsregulierenden, idealisierten Selbstobjekt zu verschmelzen. Dieser Pol entwickelt sich später zu den leitenden Idealen. Das Gefühl für eine Selbstkontinuität und Selbstkonstanz ist von der Eigenart der beiden Pole und deren Beziehung zueinander abhängig. Als dritten Anteil dieses Modells nimmt Kohut einen Spannungsbogen zwischen den beiden Polen an, als Ausdruck für die Fertigkeiten und Talente.
2.5.3 Die Klassifikation der Selbststörungen
Kohut unterscheidet primäre und sekundäre Störungen des bipolaren Selbst. Sein Hauptinteresse gilt den primären Störungen, weil sie auf einen Entwicklungsstillstand in der Bildung des Selbst zurückgehen, wohingegen die sekundären Störungen akute oder chronische Reaktionen auf schwerwiegende Belastungen und Versagungen der Selbstobjekte in späteren Entwicklungsphasen sind.