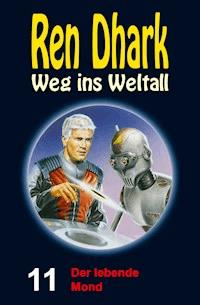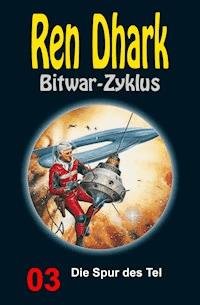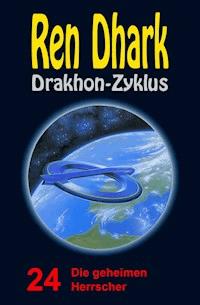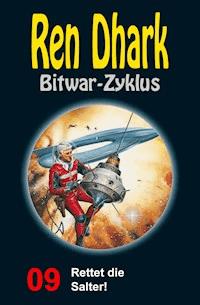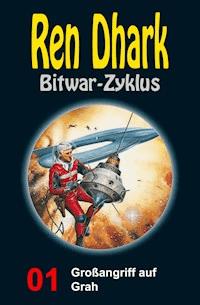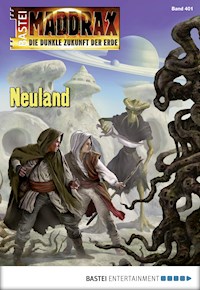Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
von Jo Zybell Der Umfang dieses Buchs entspricht 108 Taschenbuchseiten. Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen. In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf … Tim Lennox und Fanlur werden in die Traumzeit gezogen; ein Zustand, der nichts und alles bedeuten kann. Jeder erlebt diese Phase anders, verbunden mit Erinnerungen, Wissen, Hoffen, Wünschen und Ängsten. Tim und Fanlur müssen sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Doch wer hat die Macht dazu?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo Zybell
Inhaltsverzeichnis
Lennox und das Duell: Das Zeitalter des Kometen #39
Copyright
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Lennox und das Duell: Das Zeitalter des Kometen #39
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 108 Taschenbuchseiten.
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Tim Lennox und Fanlur werden in die Traumzeit gezogen; ein Zustand, der nichts und alles bedeuten kann. Jeder erlebt diese Phase anders, verbunden mit Erinnerungen, Wissen, Hoffen, Wünschen und Ängsten. Tim und Fanlur müssen sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Doch wer hat die Macht dazu?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Prolog
Die Morgensonne war eine fahle Scheibe hinter Rauchschwaden. Dichte Schleier schwebten auch über dem brennenden Dorf hundertfünfzig Meter unter ihnen. Wie Glutschlacke unter Asche sahen die Brandherde von hier oben aus. Yandataan hustete, bis ihm die Tränen über die Wangen liefen. »Der Rauch, Grao! Sag ihm, er soll endlich aus dem Rauch fliegen!« Der Junge hustete und spuckte.
Endlich lichtete sich der Qualm, und der Lesh‘iye stieß aus den Schwaden in die klare Morgenluft. Er flog über brennende Bäume und brennende Hütten. »Sieh doch, Grao!« Yandataan deutete hinunter: Zwischen den Brandherden rannte eine dicke Frau wie kopflos umher. Sie presste ein kleines Bündel an ihre Brust – einen Säugling.
Andere Gestalten wurden sichtbar. Sie sprangen aus Erdlöchern und stürzten aus Hütten, auf die das Feuer gerade übergriff. Sieben oder acht Männer und Frauen beobachtete Yandataan. Sie schlossen sich der hünenhaften, fettleibigen Frau mit dem Säugling an, liefen hinter ihr her wie zahme Hunde. Und wenn die Frau vor den Flammen zurückwich und die Rettung an einer anderen Stelle suchte, wichen auch die anderen zurück und rannten einfach mit ihr. Eine panische, aussichtslose Flucht war das, weiter nichts.
Thgáan, der letzte der Lesh‘iye, sank ein Stück dem Boden entgegen, um unter einer dunklen Rauchdecke wegzutauchen, die sich neunzig Meter über den Flammen gesammelt hatte. Behäbig und kraftvoll waren die Bewegungen seiner gewaltigen Rochenschwingen.
Zwischen ihnen, auf seinem Rücken, lag Yandataan. Rechts daneben saß Grao‘sil‘aana, der Yandamaare. Seine linke Seite sah aus wie geschmolzen: Von den Schenkeln aufwärts bis zur Schulter hatte sein Körpergewebe sich lappenartig ausgestülpt und deckte den frierenden Jungen zu wie ein wärmendes Fell.
So tief über dem von den Flammen umzingelten Platz rauschte der Todesrochen nun hinweg, dass Yandataan die Gesichter der eingeschlossenen Menschen erkennen konnte. Seine Ahnung wurde zur Gewissheit. »Sie ist es«, flüsterte er.
Die wilde Mähne, der riesige Schädel, die muskulösen Glieder, die säulenartigen Schenkel, das große goldene Kreuz auf ihrer Brust über dem weißen Schleier und natürlich das Baby an ihrem gewaltigen Busen – das war die Frau, die sie zu ihm geschleppt hatten, als er gefesselt im Haus auf dem Hügel lag; sie musste es sein.
( Sie nennt sich Blackdawn, ihr zentrales Nervensystem ist schwer gestört.) Die Gedanken des Yandamaaren krochen durch Yandataans Hirnwindungen. Er fragte nicht, woher Grao‘sil‘aana diese Dinge wusste. ( Allerdings verfügt sie über die Fähigkeit, mentale Aktivitäten anzupeilen und zu entschlüsseln.)
»Ich weiß.« Schaudernd dachte Yandataan an die Augenblicke zurück, als diese Wahnsinnige vor ihn getreten war und seine Gedanken ausspioniert hatte.
»Die Reddoas verehren sie.«
Reddoas – so nannte sich das Volk, dessen Siedlung in den Flammen unter ihnen verbrannte. Ein Feuer, das sie selbst entzündet hatten, als sie Ihn und Grao‘sil‘aana einfangen wollten. In letzter Sekunde waren sie von der Spitze eines brennenden Baumes geflohen – dank Thgáan.
Der Todesrochen kreiste ein letztes Mal über der Frau und dem Kind und den sieben oder acht vom Feuer eingeschlossenen Menschen dort. Die Schlinge der Flammen zog sich unerbittlich um sie zusammen. Sie waren verloren, alle.
Thgáan stieg in die Höhe, um die Rauchwolken zu überfliegen, die sich vor ihnen auftürmten. Yandataan blickte zurück: Die Frau stürzte sich in die Flammen.
Vermutlich, um in ihrer Verzweiflung das Äußerste zu wagen, um den Weg zurück ins Leben durch die Flammenwand hindurch zu suchen.
Yandataan sah noch, wie sie stürzte, dann verhüllte dunkler Rauch Flammen und Menschen.
Thgáan stieg höher und höher; Qualmwolken, Flammen und Tod blieben zurück. Die Morgensonne stand rötlich und groß über dem Horizont. Sie schwiegen lange Zeit.
»Wohin fliegen wir?«, rief Yandataan irgendwann.
»Fliegen wir zu meiner Mutter?« Plötzlich stand sie lebensgroß und lächelnd vor seinem inneren Auge.
Marrela nannte sie sich – eine schöne, eine starke Frau.
Dem Jungen wurde warm ums Herz. Doch sofort verhärtete sich seine Miene. »Und zu dem Mann, von dem es heißt, er sei mein Vater?«
Verschwommen nur sah er das Bild des Blonden, den Grao‘sil‘aana Tinn‘jox nannte. Kannte er ihn überhaupt anders als aus den mentalen Bildern der Yandamaaren?
Tinn‘jox – in Gedanken sprach Yandataan den Namen aus – und sofort spürte er den Hass in seiner Brust brennen!
1
Manchmal, wenn Timothy Lennox sich später an diese Tage zurückerinnerte, erschien ihm der Weg ins Innere des Uluru wie ein letzter flüchtiger Angsttraum vor dem unwiderruflichen Absturz in die Hölle.
Seite an Seite gingen sie da noch, er und Fanlur, der Albino aus Salisbury. Zwei Dutzend schwer bewaffnete Männer umringten sie, schwarz und klein und sehnig und rot-weiß tätowiert: Anangu. Daagson, der Totschläger, ging voran. Bronzehäutig war er, der Erste Wächter des Uluru, und einen Kopf größer als seine schwarzen Krieger. Durch dürres Gras und Geröll stapfte er der torhohen Spalte entgegen, die zweihundert Schritte entfernt in der roten Felswand klaffte.
Daagson musste sich nicht umdrehen, er wusste auch so, dass sie ihm folgten. Und wären sie lebensmüde genug gewesen, um an einen Kampf gegen mehr als zwanzig Krieger und an Flucht zu denken – er hätte es erfahren, noch bevor sie zu ihren Schwertern gegriffen hätten. Wie fast alle, die zu dieser Zeit in der Umgebung des Uluru lebten, konnte Daagson Gedanken erlauschen.
Er konnte es sogar besser als alle anderen Telepathen, die sich hier versammelt hatten.
Fetzen von Nebelschleiern schwebten über dösenden Mammutwaranen. Die Schafstitanen weideten im dürren hohen Gras und in halbtrockenen Sträuchern und sahen aus wie graue Felsrücken. Achtzig oder neunzig Telepathen hatten sich am Rande ihres Lagers versammelt und gafften. Zwischen ihren Hütten und Zelten stiegen hie und da dünne Rauchsäulen auf.
Tim Lennox hob den Blick. Hunderte von Metern über ihnen glühte der Kamm des Uluru im Licht der aufgehenden Sonne, und ein haarfeiner Streifen zwischen Morgenhimmel und Fels schien bereits zu brennen. Er musste an Marrela denken. Hatte man ihm nicht erzählt, sie sei vom anderen Ende der Welt hierher gewandert, weil die Vision eines brennenden Felsens sie antrieb?
Tim sah zur Seite: Fanlurs Miene war wie aus weißem Marmor gemeißelt. Der Mann aus der Vergangenheit glaubte dennoch zu wissen, an was er dachte: an Marrela.
Das ganze Lager hatten sie nach ihr abgesucht, die gesamte Umgebung des Uluru, Fanlur sogar zweimal –Marrela hatten sie nicht gefunden. Wäre sie hier am roten Felsen angekommen, hätte irgendjemand sie gesehen, so viel war klar. Sorgen quälten Timothy: War ihr etwas zugestoßen auf dem langen Weg nach Zentralaustralien?
Vorbei am widerwärtigen Daagson spähte er zur Felsspalte. Noch hundertfünfzig Schritte. Nein, der Mann aus der Vergangenheit dachte nicht an Flucht und Kampf; jetzt noch nicht. Er hätte auch nicht an Flucht und Kampf gedacht, wenn nur zwei oder drei schwarze Krieger sie bewachen und belauern würden. Zu brennend war die Sehnsucht nach Marrela, zu verlockend die Möglichkeit, im Inneren des Felsens, jenseits dieser Spalte, etwas über das Schicksal der geliebten Kriegerin zu erfahren.
Tim war sich ziemlich sicher, dass Fanlur genauso dachte.
Er kniff die Augen zusammen. Bewegte sich nicht etwas dort in der dunklen Felsspalte? Tatsächlich – drei kleine Gestalten lösten sich aus Ihr und traten ins Freie, zwei schwarze und eine hellhäutige. Sie kamen ihnen entgegen.
»Cahai«, murmelte Fanlur. »Sie bringen ihn zurück.«
Jetzt erkannte auch Timothy Lennox den jungen, schnurrbärtigen Asiaten. Nun schoss ihm doch der Gedanke an Kampf durch den Kopf, und unwillkürlich fuhr seine Rechte an seine linke Hüfte, wo ein kurzes Schwert im Gürtel steckte. Im Handgemenge während Voglers und Clarices Fluchtversuch – er wusste immer noch nicht, ob er gescheitert oder vorerst gelungen war – hatte er es einem Anangu abgenommen und nicht wieder hergegeben. Führten sie Cahai zu seiner Hinrichtung?
Tim Lennox war entschlossen, dem jungen Burschen beizustehen, wenn es nötig war, genauso wie er dem Marsianerpaar geholfen hatte.
Dass Fanlur allerdings ebenfalls für Cahai zur Waffe greifen würde, war zweifelhaft: Der schnurrbärtige Säbelmann hatte ihm vor Monaten übel mitgespielt.
Daagson drehte sich um und sah ihn an. Der Erste Wächter des Uluru grinste böse. »Wenn wir ihn töten wollten, würden wir dich nicht um Erlaubnis fragen, Tinnox. Aber es gibt keinen Grund, ihn zu töten.«
Auf halbem Weg zum Felstor begegneten sie Cahai und seinen Begleitern. Wie ein freier Mann ging er vor ihnen, sogar seinen Säbel hatten sie ihm gelassen. Seine Mundpartie war blau angelaufen und geschwollen, an seinen Lippen klebten Blutkrusten, und eine große Zahnlücke klaffte in seinem Oberkiefer. In schreiendem Kontrast dazu standen seine Gesichtszüge: Sie wirkten seltsam weich, fast kindlich. Das war nicht mehr der zornige, trotzige und zu jedem Widerstand entschlossene Kämpfer, den Tim kennengelernt hatte.
»Freut euch, Männer«, sagte Cahai im Vorübergehen.
»Freut euch auf die Begegnung mit dem HERRN!« Er lächelte wie in Trance. »Vergesst auch diese Frau, diese Marrela! Überhaupt: Vergesst alle Weiber! Glaubt mir, es gibt nichts Schöneres als die Vereinigung mit IHM!« Und schon war er vorbei.
Fanlur und Tim blickten einander an. Keiner von ihnen sagte ein Wort, doch jeder las in den Augen des anderen, was dieser dachte: Bevor ich mir das Hirn mit dieser Seligkeit vergiften lasse, kämpfe ich.
»Wir sind keine Telepathen«, raunte Tim dem Gefährten zu. »Uns können sie mental nicht derart hörig machen.«
»Möge Wudan dein Vertrauen belohnen«, sagte Fanlur sarkastisch.
»Du hast doch Vogler und Clarice gesehen«, flüsterte Tim. »Die waren völlig normal, beide hatten einen ungebrochenen Willen. Dabei besitzt auch Vogler mentale Kräfte, die der Telepathie ähneln.«
Wieder kamen drei Gestalten aus der Felsspalte, zwei Anangu und der hünenhafte Victorius. Sein blauer Frack war blutbefleckt, verkrustete Blutrinnsale zogen sich von Stirn und Schläfen aus bis zu seinen Ohren und seinem Kinn. Auch der Ansatz seiner rosafarbenen Perücke war blutverschmiert.
»Was ist dir geschehen, mein Freund?«, rief Fanlur ihm entgegen. »Hast du dich verletzt? Bist du geschlagen worden?«
»Mais non, mon ami! Wo denkst du hin?« Das Grinsen eines Idioten lag auf seinem breiten Gesicht. »ER hat mich berührt! Un grand moment, das schwöre ich dir!«
Er schaukelte an ihnen vorbei, als hätte er ein dringendes Ziel. »Auch ihr geht zu IHM? Quel bonheur! Ich beglückwünsche euch, mes amis!«
»Wer ist ER?«, rief Fanlur dem schwarzen Prinzen im Vorübergehen zu. »Und was hat ER zu dir gesagt?«
»ER ist groß! ER ist der HERR!« Victorius entfernte sich allmählich. »Mein Luftschiff gefällt IHM, die PARIS! Darum darf ich mein Leben für IHN geben, auch wenn ER mich für keinen großen Kämpfer hält!«
»Er spricht wie ein kleiner Junge«, sagte Tim.
»Und er bewegt sich wie ein kleiner Junge.«
Sorgenfalten türmten sich auf Fanlurs Stirn. »Dabei hatte sein Verhalten immer etwas Aristokratisches.«
»Gefällt mir nicht.« Tim schüttelte den Kopf. »Gefällt mir alles nicht …« Sie erreichten die Felsspalte. Von Fackelschein dürftig erleuchtetes Halbdunkel umfing sie.
Sie stiegen eine schmale, in den Fels gehauene Treppe hinauf.
2
Fanlur trat vor Tim durch den Spalt in die kreisrunde Höhle. Sie durchmaß ungefähr zehn Schritte. Ein eigenartiges Licht erfüllte sie, ein goldener Schimmer, der nicht nur allein von dem Feuer ausgehen konnte.
Hinter Fanlur schob sich nun auch Tim Lennox durch den schmalen Eingang in die Höhle und stellte sich neben ihn. Nur drei der Anangu, die sie in den Fels und hier hinaufgeführt hatten, schlüpften mit in die Grotte hinein. Sie blieben vor der Spalte stehen, als wollten sie den beiden Männern den Fluchtweg abschneiden. Aus den Augenwinkeln erkannte Fanlur den großen Mann mit der bronzefarbenen Haut, den Tinnox als Mörder bezeichnet hatte.
Drei greise Anangu hockten um das Feuer. Sie hatten knochige, von weißen Locken gerahmte Gesichter, und ihre ausgemergelten Körper waren voller Tätowierungen in Rot und Weiß. Auf einem Stein in der Feuersglut stand ein Topf. Ein Sud brodelte darin, und Dampf stieg aus ihm auf und mischte sich mit dem Rauch des Feuers.
Fanlur sah ein paar Becher aus Steingut neben dem Feuer. Es roch streng, eine Mischung aus süßem Harz und erdig herbem Tierkot. Der intensive Duft stieg ihm in die Nase.
Die uralten Männer musterten ihn und Tinnox aus hellwachen Augen. Drei, vier Atemzüge lang geschah gar nichts – er und Tim betrachteten die drei alten Wächter des Uluru, und die drei alten Wächter des Uluru betrachteten Tim und ihn. Dann schlossen zwei von ihnen die Augen, bewegten stumm die Lippen und begannen ihre dürren Oberkörper hin und her zu wiegen. Bis ins Hirn stieg Fanlur der schwere, süße Duft nach Harz.
Der dritte Anangu fuhr fort, sie zu mustern.
Unentwegt tastete sein Blick sie ab, lauernd und prüfend.
In seinen dunklen Augen brannte etwas, das Fanlur misstrauisch machte. War der Greis verrückt? War er berauscht? Oder in einer Art Ekstase?
»Ich bin Gauko‘on.« Der alte Anangu bewegte die Lippen, jedenfalls kam es Fanlur so vor. »Ich bin der, den die Wolken tragen, wohin er will. Gedankenmeister seid ihr nicht, und dennoch hat der Ahne entschieden, euch zu erkennen.«
Hallte seine Stimme von den Höhlenwänden wider, oder tönte sie auf unerklärliche Weise direkt in seinem Kopf? Fanlur vermochte es nicht zu entscheiden. Er blickte zur Seite, um Tims Gesicht zu sehen. Die Miene des Gefährten war angespannt, seine Augen schmal – auch er schien die Stimme zu hören. Der süßlich-herbe Duft kroch Fanlur in die Fingerspitzen und bis in die Hirnwindungen hinein. Seltsam schwer wurden seine Glieder.
»ER wartet auf euch«, sagte der Greis, der sich mit Gauko‘on vorgestellt hatte. Fanlur konnte nicht sehen, ob er die Lippen bewegte oder nicht, denn er hatte sich abgewandt und griff nach einem Stück Leder, das irgendwo neben ihm im Halbdunkeln lag. Fanlur hörte das Brodeln aus dem Topf neben der Glut, und plötzlich entdeckte er die zweite Spalte in der Höhlenwand. Sie lag der, durch die sie in die Höhle gelangt waren, gegenüber.
Ein feiner goldener Schimmer ging von dieser Öffnung im Fels aus, kaum sichtbar und wie hingehaucht.
Plötzlich war Fanlur überzeugt davon, dass irgendjemand sich dort in der Spalte verbarg.