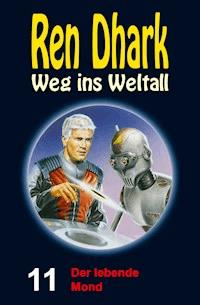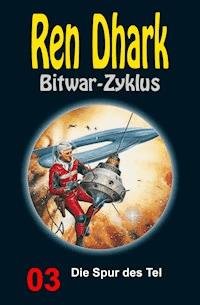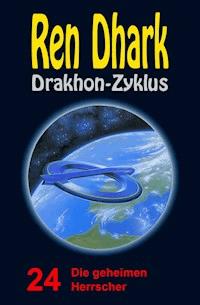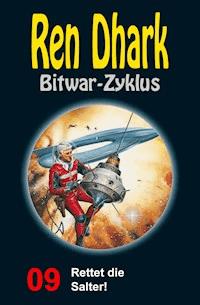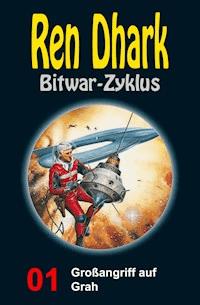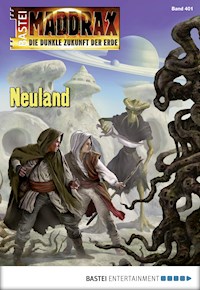Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
von Jo Zybell Der Umfang dieses Buchs entspricht 132 Taschenbuchseiten. Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen. In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf … Waashton wird von den Leuten der Rev‘rends förmlich überrannt. Nun folgt eine Zeit der öffentlichen Sündenbenennung und Buße. Aber nicht alle Menschen sind bereit, den neuen Glauben anzunehmen und sich den strengen Regeln zu unterwerfen. Mr. Darker, General Crow, die Running Men und einige andere stellen sich offen gegen die Lehre, es kommt zum Aufstand in der Stadt Gottes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo Zybell
Inhaltsverzeichnis
Lennox und die Stadt Gottes: Das Zeitalter des Kometen #37
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lennox und die Stadt Gottes: Das Zeitalter des Kometen #37
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 132 Taschenbuchseiten.
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Waashton wird von den Leuten der Rev‘rends förmlich überrannt. Nun folgt eine Zeit der öffentlichen Sündenbenennung und Buße. Aber nicht alle Menschen sind bereit, den neuen Glauben anzunehmen und sich den strengen Regeln zu unterwerfen. Mr. Darker, General Crow, die Running Men und einige andere stellen sich offen gegen die Lehre, es kommt zum Aufstand in der Stadt Gottes.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Nur dreizehn Männer zählte Sabreena, aber die gebärdeten sich wie die Sieger schlechthin. Sie drohten mit den Fäusten, brüllten, schossen in die Luft und veranstalteten einen Höllenlärm. Zwei ritten auf Horsays, einer gar auf einem Rhiffalo, und zehn lenkten Wagen mit eisenbeschlagenen Rädern und Gespannen von je sechs Zugtieren.
Darauf transportierten sie Motorräder, Kanonen und Kisten.
Auf zweien stampften Dampf speiende Maschinen, mit denen sie bei jeder neuen Runde um die Stadt Fanfaren erschallen ließen, so laut und gellend, dass Sabreena und den Verteidigern auf der Mauer beinahe die Ohren zufielen. Auch jetzt dröhnte das abscheuliche Getöse wieder vom Ufer des Potomac her über die Ruinenstadt, und dann donnerten erneut die Waffen der Dreizehn los. Pulverdampf stieg auf.
»Köpfe runter!«, schrie Sabreena. Sie und ihre Leute warfen sich bäuchlings auf die Wehrgänge. Auch rechts und links von ihnen tauchten Hunderte Männer, Frauen und Kinder hinter der Mauerbrüstung ab. Geschosse heulten über sie hinweg, Kanonenkugeln schlugen hinter ihnen in Fassaden und Dächer ein, Fensterglas splitterte, Explosionslärm donnerte, Dachgebälk stürzte ein, und das nervtötende Ratatata ihrer Maschinenkanonen vermischte sich mit dem Einschlaglärm der Geschosse im Mauergestein und mit dem Geschrei verängstigter und verwundeter Menschen.
Der Schusslärm verebbte, einmal noch heulten die Dampffanfaren auf, bevor sie verklangen, und nach und nach wagten die Leute von Waashton sich wieder aus der Deckung der Mauerbrüstung.
»Sie machen Ernst, diese schwarzen Burschen!«, zischte Sabreena. »Möchte wissen, welcher Teufel denen ins Hirn geschissen hat.« Seit dem Sonnenaufgang marschierten die Dreizehn um Waashton, seit geschlagenen sechs Stunden.
Die Augen von Sabreenas Leuten waren starr und groß, ihre Gesichtshaut aschfahl.
»Wir haben ihnen nichts entgegenzusetzen«, flüsterte Taulara, ihre Edelhure.
Yanna, ihre Chefdiebin, murmelte: »Das sind Rev‘rends, die geben niemals auf.«
»Ullah Ullalah!«, schrien ein paar Männer zweihundert Meter rechts von ihnen. »Ullah Ullalah! Stellt euch dem Schwertkampf!« Sie schwangen dreizackige Spieße, langstielige Äxte und vor allem Schwerter. »Wenn ihr ein bisschen Ehre im Leib habt, legt eure Feuerwaffen weg, kommt zur Mauer und stellt euch dem Schwertkampf Mann gegen Mann, ihr Ungläubigen!«
Jamal selbst hatte das Wort ergriffen, der Führer jener frömmelnden Mörderbande, die nun schon seit fast fünfzehn Monaten die Ruinen von Waashton zu Schlachthäusern und die Straßen der Stadt zu Wegen in die Hölle machte. »Ullah Ullalah!«, brüllte er, und seine immer berauschten Männer wiederholten den Kriegsruf.
Die Männer und Frauen zweier Gruppen, die sich auf der Stadtmauer vor dem Westtor versammelt hatten, beschimpften und verspotteten die Angreifer. Andere, wie Sabreenas Leute, beobachteten einfach nur verängstigt und schweigend, wie drei schwarze Reiter sich der Stadtmauer näherten. Sabreena zog sich die Kapuze ihres dunkelblauen Mantels über den Kopf. Sie fröstelte – die Luft war kalt und feucht.
Die Angehörigen einer Horde, die sich ganz in ihrer Nähe auf der Mauer drängte, streckten die Arme in die Luft, sangen und lachten.
Eine ihrer Frauen rief: »Willkommen, ihr Gesandten des HERRN! Endlich kommt ihr, um der abgrundtiefen Bosheit ein Ende zu machen, die sich in Waashton eingenistet hat!«
Diese gläubige Horde hatte sich vor Jahren um einen Mann namens William Boothcase geschart, der einem Rev‘rend begegnet war, irgendwo tief im Nordwesten.
Boothcase hatte sich »bekehren lassen«, wie er das nannte, und nach seiner Rückkehr die Glaubenshorde gegründet.
»Hört mich an, Bewohner der sündigen Stadt!«, röhrte plötzlich eine Stimme. Das Fluchen, Schreien, Spotten und Palavern auf der Mauer verstummte jäh. »Dies sind die Worte des HERRN an Waashton, die verdorbenste der Städte an der Küste des Sonnenaufgangs!«
Fast alle duckten sich unter dem donnernden Bass und spähten über die Mauerkante. Keine dreihundert Schritte entfernt hatten die drei schwarzen Reiter ihre Tiere gestoppt. Der mittlere von ihnen, der auf dem schwarzen Rhiffalo, brüllte in einen blechernen Trichter.
»Hört den Spruch des HERRN, ihr Sünder!«
Sein Rhiffalo war höher als die Horsays der beiden Reiter an seiner Seite. Das Tier hatte langes schwarzes Zottelfell und einen wuchtigen Schädel mit gewaltigem Gehörn. Sein Reiter war groß und dürr und trug einen anthrazitfarbenen Ledermantel mit einem grellroten Kreuz über dem Herzen. Ein grauer Stahlhelm – ebenfalls mit rotem Kreuz – bedeckte sein ergrautes Langhaar. Der dicke Lauf einer Waffe ragte hinter seiner Schulter hervor. »Hört den Spruch des HERRN oder fahrt zur Gluthölle Satans!«, brüllte er in seinen Blechtrichter.
Der Reiter rechts von ihm war jünger und nicht ganz so groß, dafür kräftig gebaut, bärtig und mit schwarzem, langen Haar. Ein breitkrempiger Hut bedeckte seinen Kopf. Er trug einen offenen Mantel aus schwarzem Pelz, dazu Hosen und Stiefel aus schwarzem Leder. In seine Hüfte stemmte er eine Feuerwaffe und aus den Klingenscheiden auf seinem Rücken ragten zwei Schwerter. Sein schwarzes Horsay tänzelte unruhig. Das Nasenhorn des Tieres und seine Stirn waren mit Blech armiert.
Ein grauer Harnisch aus tellergroßen Eisenplatten schützte seine Brust, seine Flanken und sein Hinterteil.
Der Reiter links des Rhiffalo-Manns hatte dunkle Haut, einen kahlen Schädel – so weit Sabreena das auf die Entfernung erkennen konnte –, und auf seinem schwarzen Zylinder, genau wie auf seinem schwarzen Lederponcho und dem Brustharnisch seines Horsays, prangten weiße Kreuze.
»Der Spruch des HERRN ergeht an Waashton, die Verdorbene, durch den Mund des geringsten Dieners des HERRN, dem der Racheengel des HERRN den Namen Rev‘rend Blood verlieh, und so lautet der Spruch des HERRN: Tu Buße, Waashton! Tut alle Buße, ihr Bürger der Verdorbenen!«
Die anderen Gottesmänner hatten ihre Wagen angehalten und standen vielleicht vierhundert Schritte entfernt in einem Halbkreis unweit des Potomacufers.
Wolken aus Pulverdampf schwebten über ihnen. Manche sah Sabreena sich bekreuzigen, manche flehend die Hände gegen den asphaltfarbenen Himmel richten und einige die gefalteten Hände vor die Stirn des gesenkten Hauptes pressen.
»Sie beten«, flüsterte ein Junge namens Ozzie. Er drückte sich nahe an die furchtlose Frau mit der Augenklappe. »Ich glaube, die Spinner auf den Wagen beten alle.«
»Schon möglich.« Sabreena spuckte verächtlich über die Mauer.
»Eure Sünden sind vor den HERRN gekommen und klagen euch an!«, brüllte der Rhiffalo-Reiter namens Blood in seinen Blechtrichter. »Einer treibt Unzucht mit des anderen Weib! Einer lauert dem anderen an den Ecken der Gassen und den finsteren Toreingängen auf! Ihr sauft euch voll mit schwerem Alk, ihr raubt, was euch nicht gehört, ihr lügt einander ins Gesicht und betrügt von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang und die ganze Nacht hindurch!«
»Verpisst euch!«, schrie einer der Männer auf der Mauer.
»Ullah ist Gott, und nur er!«, brüllte Jamal. »Ullah Ullalah!«, echoten seine besoffenen Schlächter.
»Komm endlich zum Punkt, Rev‘rend!«, rief Sabreena.
Sie fröstelte. Eisiger Wind blies vom Atlantik her über den Potomac in die Stadt hinein. Der Himmel sah verdächtig nach Schnee aus.
»Eure Sünden klagen euch an!«, brüllte der graue Dürre auf dem Rhiffalo wieder. »Habt ihr nicht gehört von den Strafen des HERRN? Habt ihr nicht gehört, wie er Feuer und Schwefel regnen ließ fern im Osten? Habt ihr nicht gehört, dass rund um den Globus jeder Stromfluss versiegte, kein elektrisches Licht mehr aufflammte und sich keine Hitze mehr den Energieleitungen von Waffen, Heizungen oder Motoren entrang bis auf den heutigen Tag?«
Viele Leute auf der Mauer sahen einander betreten an.
Jamal schüttelte stumm die Fäuste, Sabreena winkte ab, und ein paar Frauen der Glaubenshorde riefen: »Ja, wir haben von der Strafe des HERRN gehört! Schreckliche Strafe! Die uns regierten und Ordnung und Gesetze verschafften, traf sie mit besonderer Härte! Kommt endlich in unsere Stadt und richtet wieder Frieden und Glauben und Gottesfurcht auf!«
Ein Pfeilhagel sirrte von rechts über Sabreenas Frauen und Männer; abermals zogen sie die Köpfe ein. Die Pfeile fuhren unter die Sektenmitglieder. Schmerzensschreie erhoben sich, ein paar der Gläubigen sackten getroffen auf die Planken des Wehrgangs.
»Mörderbrut!«, brüllte Rev‘rend Blood. »Das Blut, das du vergießt, wird über dich kommen!« Er schüttelte die Faust. »Hört den Spruch des HERRN! Hört das Ultimatum seiner Diener! In zwei Stunden öffnet ihr das Tor, oder die dreizehn Diener des HERRN werden unter euch fahren wie ein Wirbelsturm! In zwei Stunden ziehen wir durch das offene Tor in die verdorbene Stadt ein – oder durch die Lücke, die der HERR selbst in die Mauer reißen wird! Doch dann wird Tod und Verderben jeden dahinraffen, der die Buße verweigert! Waashton soll eine Stadt des HERRN werden oder ein brennender Trümmerhaufen voller Wehklagen und Todesgeschrei!«
»Sie meinen es ernst!«, zischte Sabreena. Sie ging hinter der Mauerkrone auf dem Wehrgang in die Knie und winkte Peewee und Ozzie zu sich. Auch die anderen Frauen und Männer ihrer Gruppe drängten sich um sie.
»Er meint jedes Wort genau so, wie er es sagt!« Sabreena legte ihre Hände auf Ozzies und Peewees Schultern.
»Lauft los! Geht zu Trashcan Kid und erzählt ihm, was sich hier abspielt! Ich wette mein Glasauge, dass er und die anderen hier an der Mauer bald dringender gebraucht werden als bei den jämmerlichen Idioten dort unten im Bunker!«
2
»Ein Himmel wie Leichenhaut, was?« Miss Honeybutt Hardy lehnte an der Tür zum Ruderhaus und starrte hinauf in die schmutzig-blaue Tristesse über dem endlosen Meer. Sie hatte sich in Felle und zwei Decken gehüllt. Wie ein altes Leintuch spannte sich der von Wolken schwere Himmel von Horizont zu Horizont. Von Norden her wurde er von Stunde zu Stunde grauer und dunkler. »War vorauszusehen«, sagte der Mann am Kartentisch. Er hieß Sigur Bosh und stammte aus Britana.
»Die Temperaturen sinken seit zwei Wochen, der Wind hat auf Nordost gedreht.« Auch er hatte seinen drahtigen, fast dürren Körper in Decken gewickelt. »Wir fahren in den Winter hinein.«
»Ich hasse den Winter, ich hasse die kalten Winternächte.« Honeybutt sah den blonden Britanier von der Seite an. »Aber in diesem Jahr fürchte ich sie nicht.«
Ein Lächeln flog über ihr schwarzes Gesicht, und sie flüsterte: »Ich habe ja dich.«
Der Blonde zog die Brauen hoch und sah zu der schwarzen Frau an der Tür des Ruderhauses. Einen Atemzug lang hielten sich ihre Blicke fest. Er lächelte und wusste sonst nichts zu erwidern. Diese Frau überraschte ihn jeden Tag aufs Neue. Und sie machte ihn dankbar.
Ohne sie wäre er jetzt kein freier Mann.
»Wie lange noch, was schätzt du, Großer?« Diesmal wandte Honeybutt Hardy sich an den Steuermann. Er hieß Ben-Bakr, trug einen roten Turban auf dem spitzen Schädel und einen wilden grauen Bart im Gesicht.
»Wenn der Wind anhält, sind wir in zwei Tagen am Ziel.« Ben-Bakr stammte aus einem Land, dessen Küste weit, weit weg im Südosten lag. Dorthin sehnte er sich, nicht nach dem Land, aus dem die schwarze Frau stammte, das sie Meeraka nannte und das er jetzt ansteuerte.
Miss Honeybutt Hardy fuhr seit knapp sechs Monaten auf der „Eusebia“, Sigur Bosh seit zwei Jahren, Ben-Bakr sogar seit fünf. Rudersklaven waren sie gewesen, unter der Knute erbarmungsloser Piraten. Eines Tages, in St. Petersburg, war ihr Kapitän an Land gegangen und nie wieder aufgetaucht. Eines Nachts dann war die schwarze Frau aus Meeraka an Bord gekommen, zweimal, dreimal, und irgendwann war sie geblieben. Aber das war eine andere Geschichte.
Honeybutt blickte zum Bug des Schiffs. An Steuerbord holte ein gewisser Hagenau aus Doyzland das Senkblei ein, um es sofort backbords wieder im Meer zu versenken. Völliger Blödsinn natürlich – der Atlantik war hier etwas mehr als tausend Meter tief. Das war seit Tagen, ja, seit Wochen so, und das würde sich in den nächsten dreißig Stunden auch nicht ändern.
Die Wahrheit war: Hagenau hatte sich auf Crows Seite geschlagen und beobachtete in seinem Auftrag das Schiff.
Vor allem die hintere Hälfte des Dreimasters. Dort nämlich, von den Luken des Laderaums bis zum Heck, erstreckte sich Mr. Darkers Hoheitsgebiet. Die Schiffshälfte von den Treppenabgängen in die Laderäume bis zum Bug war Arthur Crows Reich. Er und sein Sergeant, ein relativ harmloser Mensch namens Peterson, hatten das so gewollt.
Außer Hagenau gab es noch einen zweiten Mann, der es mit Arthur Crow hielt: Horstie von Kotter, ehemaliger Rudersklave wie Hagenau, wie Sigur Bosh und Ben-Bakr und die meisten Männer an Bord der Eusebia. Von Kotter hatte sieben Jahre lang angekettet auf der Ruderbank im Unterdeck gelebt, auch er war Doyzländer. Honeybutt fragte sich manchmal, was für ein Mensch sieben Jahre in Ketten auf einer Ruderbank überleben konnte. Sie hatte eine Menge erlebt, aber diese Frage konnte sie dennoch nicht beantworten.
Wenn man den Gerüchten an Bord glauben wollte, hatte Crow von Kotter den Posten des Weltrat-Militärchefs im Rang eines Colonels versprochen.
»Militärchef« und »Colonel« – das klang natürlich nicht schlecht, auch wenn von Kotter ganz gewiss nie zuvor etwas von einem Weltrat gehört hatte. Ob es etwas, das diesen Namen verdiente, überhaupt noch gab?
Honeybutt Hardy hegte da starke Zweifel.
Hagenau hatte angeblich Chancen, Crows neuer Adjutant zu werden. Hardy fragte sich, wie der treue Sergeant Peterson wohl mit dieser Aussicht zurechtkommen würde.
Aus der Luke zum Laderaum streckte Mr. Hacker seinen kahlen schwarzen Schädel. Er winkte Honeybutt zu sich. Sie stieß sich von der Wand des Ruderhauses ab.
»Die Pflicht ruft«, seufzte sie.
Hinter Mr. Hacker her stieg sie ins Unterdeck hinab.
Auch dort und sogar ein Stockwerk tiefer, in den Laderäumen, galt die Zweiteilung der Eusebia: Die Bughälfte für die Crow-Partei, die Heckhälfte für Mr. Darker, Mr. Hacker, Honeybutt Hardy und ihre Anhänger.
Der Rest der befreiten Rudersklaven, sieben Männer insgesamt, verhielt sich weitgehend neutral.
Hacker und Hardy betraten Mr. Darkers Quartier, die luxuriöse Kapitänskajüte. Darker lag auf seiner Koje, seine beiden Gefährten nahmen am Kartentisch Platz. »Wie lange noch bis Waashton, Miss Hardy?«, fragte Darker.
»Wenn das Wetter sich hält und der Wind so günstig bleibt, noch etwa zwei Tage«, sagte Honeybutt.
»Gut«, knurrte Darker. »Wie Sie wissen, hatte ich vor zwei Wochen eine Unterredung mit General Arthur Crow.« Er schnitt eine verächtlich Miene und fügte spöttisch hinzu: »Mit dem Präsidenten.« Das letzte Wort dehnte er und kostete jede Silbe.
Die Einladung zu diesem Gespräch hatte Crow durch Sergeant Peterson überbracht, gleich nachdem sie den finnischen Meerbusen verlassen hatten. Das war über ein halbes Jahr her. Zwischenzeitlich hatten Schiff und Besatzung nervtötende Monate in völliger Windstille auf dem Atlantik zugebracht und auf einer Insel der Azorengruppe ums Überleben gekämpft. Doch auch das war eine andere Geschichte. (die noch nicht erzählt wurde)
»Von was genau Mr. Crow noch Präsident ist, werden wir erst erfahren, wenn wir in Waashton an Land gegangen sind«, sagte Darker, und er klang besorgt. »Mit anderen Worten: Wir wissen nicht, welche Situation wir in Waashton antreffen werden, und genau darauf sollten wir vorbereitet sein. Am Schluss unseres Gesprächs hat Crow mich um ein offizielles Treffen gebeten. Ich schlage vor, wir kommen ihm entgegen. Schließlich brauchen wir ein konkretes Konzept für unsere künftige Zusammenarbeit, sonst läuft gar nichts.«
»Ein Konzept, wie wir uns künftig gegenseitig das Leben schwermachen?« Mr. Hacker grinste. »Klingt gut, ehrlich, Mann!«
»Mir ist nicht nach Witzen zumute, Mr. Hacker«, knurrte Darker.
»Was haben Sie und Crow denn besprochen in Ihrem Gespräch unter Männern?«, erkundigte Miss Hardy sich vorsichtig. »Wenn man fragen darf, Mr. Darker.«
»Man darf, Miss Hardy.« Mr. Darker schwang sich aus der Koje, ging zum Kartentisch und ließ sich dahinter in einem knarrenden Armlehnensessel nieder. »Er hat sich nicht direkt entschuldigt, aber war immer noch ziemlich zerknirscht wegen seiner Tochter.« Darker faltete seine Hände vor sich auf dem Tisch und starrte sie an. »Ich bin nicht sicher, ob er nur geschockt ist, weil Lynne ihm erfolgreich vorgelogen hat, dass Mr. Heller und ich sie damals vergewaltigt hätten, oder ob er wirklich bereut, mich wegen dieser Lüge jahrelang verfolgt und bekämpft und Heller ermordet zu haben.«
»Vorsichtig, Mr. Darker.« Hacker hob warnend den Zeigefinger. »Eher krieg ich schneeweiße Haut, als dass Crow etwas bereut.«
Darker hob die Brauen und sah fragend zu Miss Hardy.
Die zuckte mit den Schultern. »Ich traue jedem grundsätzlich alles zu«, sagte sie. »Auch, dass er sich ändert.«
»Sogar Crow?« Hacker tat überrascht.
»Sogar Crow.«
Mr. Darker brummte missmutig. »In den Krisen, die seit der Flucht aus St. Petersburg hinter uns liegen, konnten wir jedenfalls ganz gut mit ihm und Peterson zusammenarbeiten. Und je nachdem, welche Zustände wir in Waashton antreffen, werden wir wieder auf eine vernünftige Zusammenarbeit mit dem Fuchs angewiesen sein.«
»Und der Fuchs auf eine vernünftige Zusammenarbeit mit uns«, warf Mr. Hacker ein.
»Richtig«, bestätigte Mr. Darker. Er wandte sich wieder an Honeybutt Hardy. »Gehen Sie also zu ihm hinüber, Miss Hardy. Grüßen Sie ihn von mir, und laden Sie ihn und seine Leute für morgen, zwölf Uhr Bordzeit, zu einem Arbeitsessen in meine Kajüte ein. Sagen Sie ihm, es gehe um eine Koalition für die künftige Zusammenarbeit in Waashton.«
3
Woher kennst du den Burschen?