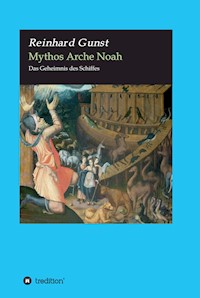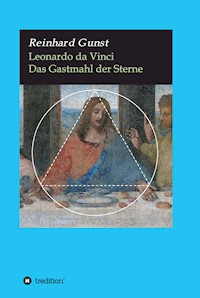
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblische Mythen
- Sprache: Deutsch
Leonardo da Vincis Werk `Das Abendmahl´ ist ein Werk, das einen neuen Blick auf Jesus und seine Jünger ermöglicht. In einer Epoche, in der die Astronomie noch mit der Astrologie verbunden war, schuf da Vinci ein Werk, das vor dem Hintergrund der letzten Zusammenkunft von Jesus und seinen Jüngern etwas über die ewigen Zyklen des Kosmos erzählt. Damit erinnert er aber auch an die Gedanken des römischen Dichters und Philosophen Lukrez
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
(Sokrates)
Leonardo Da Vinci's Werk `Das Abendmahl´ steckt voller Rätsel. In dem Bild, das er im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand malte, zeigt er den Augenblick des Verrates während der letzten Zusammenkunft der Apostel mit Jesus. Ihre ausdrucksvollen Gesten vermitteln dem Betrachter eine scheinbar authentische Atmosphäre des Geschehens. Doch hinter der malerischen Erzählung verbirgt sich eine Komposition, die nicht nur die Bedeutung der Zahlen mit ihrer Symbolik, sondern auch die Philosophie des 15. Jahrhunderts widerspiegelt. Bis zum Besuch des Kloster vor 500 das Kloster Santa Maria delle Grazie in Mailand kannte ich da Vinic`s Werk nur aus Büchern. Überwältigt vom Eindruck des Bildes wurde mir klar, wie wenig ich darüber wusste, und ich begann, mich mit den vielen Beschreibungen und Interpretationen des Werkes zu beschäftigen. Die weitere Suche nach der geheimnisvollen Botschaft des Bildes, die bislang auf unterschiedliche Weise gedeutet wurden, führten mich schließlich zu einer neuen Erkenntnis.
Mit dem Wissen wächst der Zweifel
(Johann Wolfgang von Goethe)
Danksagung
Die Recherchen erforderten eine Menge an Recherchen, Überlegungen und Diskussionen. Für das geduldige Zuhören und die notwendigen Korrekturen, wie auch für den unermüdlichen Gedankenaustausch zu den kunst- und kulturhistorischen Aspekten des Werkes von da Vinci bin ich deshalb meiner Frau sehr dankbar. Was wären all die Recherchen ohne das ausreichende Quellenmaterial? Deshalb bedanke ich mich auch bei unser-er Tochter Rebecca für ihre unermüdliche Geduld und Zielstrebigkeit bei ihrer Suche nach geeigneter Literatur und Bildern.
Reinhard Gunst
Leonardo da VinciDas Gastmahl der Sterne
© 2019 / Reinhard Gunst
Umschlag, Illustration: Reinhard Gunst
Lektorat, Korrektorat: Sabine Lutzeier
Weitere Mitwirkende: Rebecca Lutzeier
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-3528-0
Hardcover
978-3-7497-3529-7
e-Book
978-3-7497-3530-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Leonard da Vinci - Gastmahl der Sterne
Vorwort
01 - Leonardo da Vinci
02 - Der Geist des 15. Jahrhunderts
03 - Die Vorbilder
04 - Das Schaufenster
05 - Der Raum der Laien
06 - Der Triumphbogen der Auferstehung
07 - Die Dualität des Zentrums
08 - Die Symbolik des Mundes
09 - Stern von Bethlehem
10 - Der Zyklus der Sterne
11 - Das Zeitalter der Fische
12 - Die Frühlingsgruppe der Apostel
13 - Die Sommergruppe der Apostel
14 - Judas, der Verräter
15 - Jesus und die Sonnensymbolik
16 - Die Symbolik von Brot und Fischen
17 - Das Winkelmaß
18 - Die Herbstgruppe der Apostel
19 - Die Wintergruppe der Apostel
20 - Der Mythos der Zahl 12
21 - Vier Evangelisten und der Tierkreis
22 - Astralmythen
23 - Der Jesusmythos
24 - Henochs Vermächtnis
25 - Lukrez und die Welt ohne Götter
Literaturverzeichnis und Bildnachweis
Vorwort
Santa Maria delle Grazie - Foto Marcin Białek
Pro Stunde werden nur noch 100 Besucher in das Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand zugelassen, um eines der bedeutendsten Kunstwerke da Vinci's betrachten zu können. `Das Abendmahl´ zeigt hier auf höchst eindrucksvolle Weise jenen Augenblick des Verrates. Nach der erfolgten Fußwaschung der Jünger und der sich daran anschließenden Rede von Jesus, schildert der Evangelist Johannes mit den folgenden Worten die Ankündigung des kommenden Verrates:
`Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb….´ (Johannes 13,21-30).
Mit einer theatralischen Mimik und ebensolchen Gesten setzte da Vinci diesen Augenblick in Szene. Er wirkt so lebensecht, als hätte er ihn selbst miterlebt. Doch zwischen der Entstehung des Kunstwerkes und dem vermeidlichen Ereignis liegen knapp 15 Jahrhunderte einer wechselvollen Geschichte des Glaubens. Somit berührt die Darstellung auch einen Aspekt der Kunst, mit dem sich Philosophen seit dem 5. Jhd. v. Chr. auseinandergesetzt hatten, die Nachahmung. In seinem Dialog Politeia sah der griechische Philosoph Platon die Künste nur an der sinnlichen Erscheinung orientiert, aber nicht fähig, an einer Darstellung der ewigen Ideen. Im 4. Jhd. bewertete Aristoteles die Kunst der Nachahmung neu. Er war der Ansicht, dass der Mensch nicht das Geringste lernen würde, wenn er nicht die Fähigkeit zur Nachahmung besäße. In ihr sah er die Möglichkeit Dinge zum Ausdruck zu bringen, die alle Menschen bewegen.
Auch Im 20. Jhd. blieb für den Philosophen und Soziologen Theodor Adorno das Element der Nachahmung ein zentraler Teil seiner kunsttheoretischen Betrachtung. So schrieb er in seiner 1970 posthum erschienenen 'Ästhetischen Theorie', dass ein Kunstwerk aus `Mimesis und Konstruktion´ bestehe. Nach Adorno's Überzeugung beziehen Kunstwerke ihren Stoff aus der Wirklichkeit und setzen diese gelungener, doch andersartig zusammen. Auch sorge der Künstler nach Adorno noch für eine Botschaft, die das sprechen lasse, was die Ideologie verberge.
Die im Wandbild gezeigte Erregung über den kommenden Verrat scheint bereits eine Vorahnung auf den kommenden Glaubensstreit. zu sein. Der begann nur 20 Jahre nach der Fertigstellung des Bildes mit Martin Luther`s Thesenanschlag in Wittenberg im Jahr 1517.
Seit diesem Zeitpunkt herrscht in beiden Konfessionen Uneinigkeit über das Wesen der Abendmahlsfeier. So gilt in der Katholischen Kirche die Eucha-ristie als das zweite Hauptsakrament unter den sieben Sakramenten. Sie wird während der Messe gefeiert und erinnert an das Opfer Christi am Kreuz. Dagegen kennt die Evangelischen Kirche nur die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl. Grundsätzliche Unterschiede ergeben sich aber in der Auffassung, wie Jesus während dieser Feier präsent ist, in der an das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gedacht wird. Katholiken glauben an eine Verwandlung von Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut während der Feier, die damit eine reale Präsens von Jesus vermitteln. Dagegen sehen evangelische Christen im Brot und dem Wein nur ein Zeichen der Erinnerung.
Die einstige Bedeutung von beiden, die zu den Marksteinen der neolithischen Revolution zählen, rückte in diesem Glaubensstreit längst in den Hintergrund. Doch vor rund 7.000 Jahren vollzog sich der Übergang von einer Gesellschaft der Nomaden zur städtischen Kultur und damit auch zu einem veränderten Götterbild. Die Bedeutung der beiden Lebensmittel ist daher vielschichtig: Nicht nur kulturell, sondern auch materiell geben sie einen Eindruck vom Wandel mittels der Verarbeitung von Früchten in wertvolle Speisen. Wohl auch aus dem Grund wurden sie zu Sinnbildern des neuen Glaubens.
Obwohl am Beginn dieses neuem Glaubens ein Verbot von Bildern stand, entstanden im Laufe der Geschichte zahlreiche Darstellungen biblischer Ereignisse, doch nur wenige stellen den Betrachter so vor ein Rätsel, wie da Vinci's `Abendmahl´. So soll diese Betrachtung zeigen, dass seine Interpretation des besonderen Augenblicks über das reine Abbild hinausgeht und dem eigentlichen Bild, wie 2.000 Jahre zuvor von Platon gefordert, doch eine ewige Idee zu Grunde liegt.
01 - Leonardo da Vinci
Jede kleine Ehrlichkeit ist besser als eine große Lüge.
(Leonardo da Vinci)
Sogenanntes Selbstbildnis Leonardo da Vinci's(Rötelzeichnung, Biblioteca Reale, Turin, um 1512)
Leonado da Vinci wurde am 15. April 1452 in dem kleinen Dorf Anchiano geboren, das in der Nähe der Gemeinde Vinci liegt. Das Dorf mit dem heute nicht mehr eindeutig identifizierbaren Geburtshaus da Vinci's liegt in einer Landschaft, die sich im Verlaufe der Jahrhunderte kaum verändert hat. Dort kam da Vinci als Sohn des damals 25-jährigen Notars Piero da Vinci und dessen 22-jähriger Magd Caterina zur Welt, die als getaufte arabische Sklavin vorübergehend bei dem Notar gearbeitet haben soll. Zusammen mit der Familie seines Vaters zog da Vinci 1457 nach Florenz, wo er sich bereits früh für das Zeichnen, Modellieren und auch für die Musik interessierte. Als erfolgreicher Anwalt pflegte sein Vater Geschäftskontakte zu Familien wie den Medicis und anderen Patriziern, welche zum regierenden Rat der Stadt zählten. Durch seine Vermittlung erhielt da Vinci 1469 eine Lehrstelle in der Werkstatt des Künstlers Verocchio, der zu dieser Zeit als der bedeutendste florentinische Bildhauer galt.
Über dessen eigenen Werdegang gibt es nur wenig Erkenntnisse: Er scheint jedoch eine Lehre als Goldschmied und später als Bildhauer durchlaufen zu haben, wo Piero de’ Medici und sein Sohn Lorenzo 'il Magnifico' auf ihn aufmerksam wurden. Sie erkannten frühzeitig sein Talent und förderten ihn tatkräftig. Um ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Blick zu schulen, machten sie ihn zum Kurator ihrer Antikensammlung. Dort hatte Verocchio die Gelegenheit, antike Statuen eingehend zu studieren und seine Fertigkeiten zu erweitern.
In Verocchio's Werkstatt spielten Zeichnungen und plastische Modelle für die Herstellung neuer Arbeiten eine große Rolle. Durch dieses Vorgehen gewann auch da Vinci Erkenntnisse für den Entwurf eigener Werke. Sieben Jahre verbrachte er im Atelier des Künstler-Lehrers, in dem er die erste, ihm heute zugewiesene Zeichnung einer Landschaft des Arno-Tales fertigte. Als ältestes eigenhändiges malerisches Werk gilt die zusammen mit Verocchio entstandene 'Taufe Christi´. Dort führte da Vinci zwei kniende Engel aus, die sich in Gestik und Details deutlich von den beiden Hauptfiguren aus der Hand seines Meisters unterscheiden. Das zwischen 1470 und 1478 entstandene Bild für das Kloster San Salvi in Florenz gilt heute als eines der Hauptwerke Verocchio's, über das auch der Kunsthistoriker, Architekt und Maler Vasari in seinen 'Vite' über die berühmtesten Maler seiner Zeit berichtet. Nach Beendigung des Werkes soll Verocchio von da Vinci's Leistung so beeindruckt gewesen sein, dass - wie Vasari schreibt - er fortan keinen Pinsel mehr anrührte, weil er der Auffassung war, dass sein Schüler ihn mit seiner Kunstfertigkeit übertroffen habe.
Um 1472 wird da Vinci erstmals in einer Aufstellung der Malerzunft genannt, wobei er zu diesem Zeitpunkt weiter als Geselle in Verocchio's Werkstatt tätig war. Erst drei Jahre später entstehen die ersten eigenständigen Bilder, wie das Bildnis der `Ginevra de Benci´. Da der Vatikan den Künstler damals bei Aufträgen übergangen hatte, zog da Vinci 10 Jahre später nach Mailand, wo er sich in die Dienste des Mailänder Herrschers Ludovico Sforza begab. Begleitet wurde er dabei von seinem Gehilfen und lebenslangem Freund Tommaso Masini. Masini war wie er vielseitig interessiert und arbeitete als Alchemist, Erfinder und Farbenmischer: Wohl aus diesem Grund bezeichnete ihn da Vinci in seinen Notizbüchern als 'Maestro Tommaso'. Der oft kolportierte Name Zoroastro, in Anlehnung an den persischen Priester und Philosophen Zoroaster, wurde ihm aber erst viel später auf Grund des schlechten Rufs seiner Beschäftigung mit der Alchemie verliehen.
In Mailand erlebte da Vinci jedoch auch seine erste schmerzliche Niederlage, als Ludovico 'il Moro' ihm den Auftrag erteilt hatte, ein Reiterstandbild zu entwerfen. Dieses sollte den 1466 verstorbenen Fürsten Francesco Forza auf dem Pferd sitzend darstellen. Nach den Plänen da Vinci's sollte es das größte jemals errichtete Reiterstandbild werden, mit dem Fürsten auf einem sich aufbäumenden Pferd. Doch die Planungen scheiterten - einmal an der gewagten Statik des Projektes und dann an der viel zu großen Menge Bronze, welche für die Ausführung benötigt worden wäre. Dieses Scheitern steht für ein Leben, in dem sich große innere Zerrissenheit widerspiegelte. Zahlreiche Wissenschaftler, wie der 1901 verstorbene deutsche Kunsthistoriker Herman Grimm, widmeten sich diesem Phänomen. Dessen Studie über eine Rötelzeichnung, die da Vinci drei Jahre vor seinem Tod darstellt, beschreibt das Leben des Genie's zwischen Licht und Schattens. Grimm meinte in da Vinci`s Gesicht den Ausdruck finsterer Kräfte, Bitterkeit, ja Verschlossenheit erkennen zu können, doch zugleich auch eine Überlegenheit, die nur einem Magier gleichkäme. Ganz anders schildert dagegen Vasari den noch jungen da Vinci, der voller Liebenswürdigkeit durch die Straßen von Florenz ging, wo er im Überschwang seiner Jugend den Vogelhändlern Geld gab, damit sie die gefangenen Tiere wieder frei ließen.
Von der Zerrissenheit seines Wesens zeugt aber auch da Vinci's eigene Einschätzung. Wie Schriftstücke belegen, diente er sich dem Mailänder Hof nicht in erster Linie als Maler an, sondern hauptsächlich als Militärkonstrukteur.
Obwohl er den Krieg als `völlig bestialischen Wahnsinn´ bezeichnet hatte, erfand er im Rahmen seiner Tätigkeit neben der Verbesserung traditioneller Waffen noch zahlreiche andere raffinierte Kriegsgeräte, wie Mörser, Schnell- feuergeschütze, eine mit Dampf betriebene Kanone, aber auch einen kegel-förmigen Panzer, der mit 8 Kanonen bestückt war. All diese Erfind ungen, von denen aber scheinbar keine einzige gebaut wurde, belegen, dass er seinem Mäzen effiziente Tötungsmaschinen zur Verfügung stellen wollte.
Die Vielfalt von da Vinci's Schaffen offenbart aber auch immer seine Intention: Sie war geprägt von der Suche nach höchster Erkenntnis auf unterschiedlichsten Ebenen, und seine schöpferischen Fähigkeiten halfen ihm, diesen Weg zu beschreiten. So verließ er Mailand nach der französischen Besetzung im Jahr 1499 und verdingte sich bei Cesare Borgia als Militäringenieur, hier nahm er am Feldzug in der Romagna teil.
02 - Der Geist des 15. Jahrhunderts
`Ein großes Wunder ist der Mensch´
(Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen)
Giovanni Pico della Mirandola. Ölgemälde eines unbekannten Malers in den Uffizien
Als 1453 der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England endete, brach für Europa eine Zeit kultureller Blüte an. Die Wirtschaft erstarkte wieder, was zu einem Wachstum der Städte führte. Zugleich erschlossen zahlreiche Entdecker den Menschen eine bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Welt. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen waren also geradezu ideal für das Entstehen einer neuen Geistesströmung. Doch dieses wieder aufblühende Europa wurde gleich- zeitig vom Schock des besiegten byzantinischen Reiches erfasst.
Dessen langsamer Niedergang hatte sich bereits nach dem 4. Kreuzzug im Jahr 1204 angekündigt, der mit der Plünderung Konstantinopels endete. Mit der Aufteilung des byzantinischen Reiches an die Siegermächte und dem Verbleib eines Rumpfgebietes bei Kontstantinopel war auch dessen Vormachtstellung zu Ende. Dies veranlasste in der Folgezeit zahlreiche Gelehrte. Maler, Handwerker und Baumeister zur Auswanderung nach Italien, wo sie das Wissen der Antike bekannt machten. Dort hatten Protagonisten einer neuen Geisteshaltung, wie der im 14. Jhd. lebende Italienische Dichter Francesco Petrarca, durch eine ausgiebige Beschäftigung mit antiken Schriftstellern und den Glauben an den Wert humanistische Bildung gefördert. Sie lösten damit eine einzigartige kulturgeschichtliche Entwicklung aus, die später unter dem Namen Renaissance in die Geschichte einging. Mit dieser Neuorientierung der Bildung, die erst Mitte des 19.
Jahrhunderts die eigentliche Bezeichnung humanistisch erhielt, wurde das Studium der Sprachen, der Literatur, der Geschichte, Philosophie und der Künste nach antiken Vorbilder gefördert. Anfänglich war die neue Bewegung noch weitgehend literarisch ausgerichtet und beschäftigte sich mit den Schriften der griechischen Sprache.
Sie vermittelten gleichzeitig die antike Ideale, unabhängig von den gängigen religiösen Vorstellungen die antike Ideale, wie Menschlichkeit, Toleranz, Ausgleich, Maß und Reinheit, fortan als erstrebenswert galten. Gleichzeitig wurden auch zahlreiche Bauwerke und Skulpturen wieder entdeckt und sorgten mit ihrem Aussehen für eine Neuausrichtung der Bildenden Künste. Eines der edelsten Vermächtnisse der Renaissance entstand nach der Auffassung des Schweizer Kulturhistorikers Jacob Burckhard knapp ein Jahr-hundert nach Petrarca. Unter dem Titel `Über die Würde des Menschen´ verfasste der Philosoph Pico de Mirandola eine Reihe von Gedanken in denen er ein völlig neues Bild des Menschen entwarf.
n ihm sah er das einzige Wesen, dem der Schöpfer die Eigenschaft verlieh, nicht festgelegt zu sein und deshalb ein Werk von unbestimmter Gestalt ist´. Nach Mirandolas Überzeugung sind alle Geschöpfe von Natur aus mit Eigenschaften ausgestattet, die ihr mögliches Verhalten auf einen be-stimmten Verhaltensrahmen und Aktionsradius begrenzen. Im Gegensatz zu diesen festgelegten Geschöpfen der Natur sah er den Mensch als ein freies, unabhängiges Wesen an, das in die Mitte der Welt gestellt wurde, `um sich dort umschauen, alles Vorhandene erkunden und dann seine Wahl treffen kann´.
Diese Freiheit ermöglicht ihn auch zum eigenen Gestalter seines Lebens zu werden. Dies betrachtete Mirandola als ein Wunder und schloss daraus, dass der Mensch einem Abbild Gottes gleichkam. Mit ihm kann sich der Mensch nach Mirandolas Vorstellung in einer `abge-schiedenen Finsternis´ vereinigen. Dies erfolgt nach seinem Gedanken-modell dann in einem dreistufigen Prozess der (purgatio), der Erleuchtung (illuminatio) und endet mit der Vollendung (perfectio). Zu dieser Voll-endung findet er dann ausschließlich mit Hilfe der Theologie, da nur sie die Erkenntnis des Göttlichen ermöglicht.
Im Gegensatz zu dieser revolutionären Sicht Mirandolas, gewährte das Menschenbild des Mittelalters dem Einzeln kaum eine Wahl sein Leben zu gestalten. Gemäß den Erzählungen der biblischen Heilsgeschichte verlief es vorbestimmt, geradlinig und war auf die Endzeit ausgerichtet. Sie wurde zeitnah erwartet, da nach allgemeiner Überzeugung mit der Geburt von Jesus das letzte Zeitalter der Menschen angebrochen war. Obwohl der Mensch in biblischen Texten auch als Ebenbild Gottes beschreiben wird, hatte er deshalb keinesfalls die von Mirandola postulierte Freiheit. Die von Adam und Eva begangene Erbsünde lastete auf ihm, genauso wie die von der Kirche angeprangerten Laster sein Seelenheil ständig bedrohten. Das von der Kirche gepriesene Heil war ihm nur gewiss, wenn er regelmäßig Almosen spendete gab und Bittgebete absolvierte.
Diese Unsicherheit vermittelte ein zwiespältiges Lebensgefühl. Es schwankte zwischen ständiger Angst nach dem Tod einer ewigen Strafe ausgesetzt zu sein und der Hoffnung auf Erlösung durch ein kommendes Reich Gottes. Die neue Sicht der Freiheit des Menschen und der ihm zugestandenen Selbst-bestimmung musste folgerichtig den Kampf der Humanisten gegen die wachsende Begeisterung für die Astrologie herausfordern.
Neu übersetzte Texte arabischer Astronomen, die das Wissen der Antike gerettet hatten, sorgten für ein wachsendes Interesse an der Sternenkunde. Doch ihre Gegner sahen in der von den Gestirnen bestimmten Determinierung des Schicksal einen einen gravierenden Widerspruch zu der von ihnen postulierten Willensfreiheit des Menschen. Auch Mirandol war ein entschiedener Gegner der Vorbestimmtheit und schrieb dazu in einem Verdikt gegen die Astrologie: `Wie versteht es die Astrologie, die Hoffnung aufzustacheln! ´
Mit welcher Dreistigkeit gesellt sie sich dem Kreise der Wissenschaften zu! Sie ist die Verderberin der Philosophie, beschmutzt die Medizin und legt die Axt an den Stamm der Religion. Dem Menschen raubt sie die Ruhe und erfüllt ihn mit ängstigenden Bildern. Den Freien macht sie zum Sklaven. Sie lähmt seine Tatkraft und wirft ihn auf das Meer des Unglücks hinaus.´ Die Schärfe seiner Verurteilung der Jahrtausende alten Wissenschaft der Astrologie war kaum zu überbieten.
03 - Die Vorbilder
Wie viel Schönheit empfängt das Herz durch die Augen.
(Leonardo da Vinci)