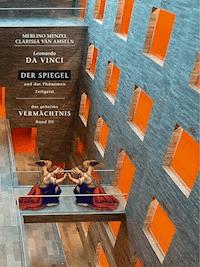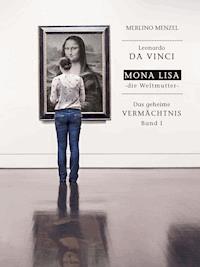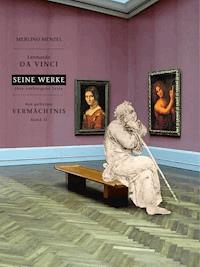
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum nach 500 Jahren das Rätsel um Leonardo da Vinci nicht gelöst ist, versteht niemand der ein Buch über ihn schreibt. Viele haben sich herangeschlichen. Viele haben sich daran versucht sein Tun zu ergründen. Einige haben sich auf seine linksläufige Schrift spezialisiert und uns eine Übersetzung von seinen mannigfaltigen Skizzenbüchern hinterlassen. Aber was ist mit seinen Gemälden? Wie erkennt man überhaupt einen echten ‚Lionardo‘? Welche Schablone kann man ansetzen für den Magier? Kann man Musik durch Farbtöne sichtbar machen? Oben ist unten und rechts ist links, jedenfalls sieht das Auge das so und so poliert uns der Meister seinen zeitlosen Spiegel auf Hochglanz. Stimmen wir uns ein mit Proportion und Harmonie, um dorthin zu gelangen wo das Genie zu Hause ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Cecilia Galerani
Ginevra de Benci
Lucretia Crivelli
Madonna - Benois
Madonna mit der Nelke
Verkündigung an Maria
Madonna in der Felsengrotte
Anbetung der heiligen drei Könige
Burlington-House Karton
Die Hl. Anna Selbdritt
Der Heilige Hieronymus
Johannes der Täufer
La ultima cena - Das letzte Abendmahl
Schlusswort
Literatur und Quellennachweis
Verzeichnis der Abbildungen:
Impressum
Einleitung
„Die Malerei ist der Spiegel des Universums.“ [1]
„Eine Form um hundertachtzig Grad drehen ergibt eine Spiegelung. Es lassen sich dabei entweder eine oder mehrere Symmetrieachsen ausfindig machen, um die herum sich die „Figur“ spiegelt, zunächst in zwei- sodann auch in dreidimensionaler Hinsicht“.[2]
„Bei der Auswahl der vorzüglichsten Teile für seine Malerei soll der Maler verfahren wie der Spiegel, der sich in so viele Farben verwandelt, als man vor ihm hinstellt. Und wenn er es so tut, wird er sein, wie eine zweite Natur. Ein Spiegelbild wird stets der Farbe des spiegelnden Körpers teihaftig“.[3]
(Roger Bacon): „ ... für Leonardo war spätestens 1492 klar, dass das menschliche Auge lediglich über eine rezeptive Sehkraft verfügt, das heißt, die aktiven Lichtstrahlen gehen vom Objekt aus bzw. die von der Sonne oder einer anderen Lichtquelle aufgenommenen Lichtstrahlen werden vom Objekt reflektiert und an das Auge weiter abgestrahlt. Über die Art und Weise der Abstrahlung hatte Leonardo gleichzeitig eine klare Vorstellung gewonnen“.
(Jean Paul Richter, John Pecham): „Jeder Schattenkörper erfüllt die ihn umgebende Luft mit zahllosen Bildern von sich; diese Bilder, von zahllosen Pyramiden in die Luft geprägt, stellen den Körper ganz im ganzen Raum und ganz an jeder einzelnen Stelle dar.
Jede Pyramide, die sich aus einem langen Zusammenlaufen von Strahlen zusammensetzt, enthält in sich unendlich viele Pyramiden, und jede hat die Kraft wie alle zusammen, und alle zusammen wie jede einzelne.
Die zu einem Kreis zusammenlaufenden Pyramidenstrahlen mit derselben Entfernung von ihrem Gegenstand bilden gleichwinkelige Pyramidenspitzen, und in der gleichen Größe wird der Gegenstand von seinem Gegenüber (dem Auge) empfangen. Der Luftraum ist erfüllt von zahllosen Pyramiden, die aus leuchtenden Geraden zusammengesetzt sind. Verursacht werden sie von den Rändern der Oberflächen der Schattenkörper, die sich in der Luft befinden, und je weiter sich die Pyramiden vom Gegenstand ihres Ursprungs entfernen, desto spitzer werden sie: obwohl sie sich in ihrem Verlauf schneiden und durchkreuzen, vermischen sie sich doch nicht miteinander, sondern erstrecken sich und verteilen sich in die ganze Luft ringsum auslaufend, und jede von ihnen hat dieselbe Kraft, und alle zusammen vermögen soviel wie jede einzelne und jede einzelne soviel wie alle zusammen. Durch sie wird das Bild des Körpers in seiner Gänze überallhin und in seiner Gänze an jede einzelne Stelle gebracht, und jede Pyramide enthält in sich in jedem kleinsten Teil eine ganze Form des Gegenstandes ihres Ursprungs.
Leonardo‘s Grundanschaung war die, dass die Spitze einer solchen Sehpyramide mit einem bestimmten Punkt im menschlichen Auge zusammentrifft, von dem aus der Sehnerv die dort ankommenden Sinnesdaten aufnehmen und ins Gehirn weiterleiten kann.“ [4]
Der Punkt ist seine Malerei. Man versteht sie, wenn man sie als „Lösung“ betrachtet. Für ihn als Maler sind seine Bilder Mysterien, welche die „Lösungen“ enthalten.
Von hier aus ist es nun ein kleiner Schritt, den Spiegel als die eigentliche „visionäre Traumfläche“ seiner traumwandlerischen Werke zu sehen, und aus der Erkenntnis des pyramidalen Aufbaus der Sehfläche (als Schnittfläche), bestimmt diese Strukturierung die Gemälde Leonardos.
Aus dieser Entdeckung heraus zeichnet Leonardo dann, die gotische Formgebung benutzend, diese in seinen Gemälden ein. Ein Kreis aussen, ein Kreis innerhalb der Pyramidenfläche, usw...
Diesen Pyramidenquerschnitt teilt er dann mittig in jeweils 4 Dreiecke ein und beginnt damit in die entstandenen Formen (Punkt, Kreis, Viereck, Dreieck) seine Figuren einzufügen.
Diese, für das Auge schon sphärischen Verhältnisse, das ja nach dem Prinzip der Ergänzung verfährt, werden dann am Schluss noch farblich „beseelt“ und dem Werk wird „Leben eingehaucht“.
Der Phantasie des Betrachters sind dann in Variationsvielfalt keine Grenzen mehr gesetzt, da alle möglichen mathematisch-metaphysischen Berechnungen beachtet sind.
Auch die Vorliebe Leonardo‘s für Symbolik und Sinnbilder, in Doppel- und Mehrdeutigkeit ist dann im Raumvolumen mit eingerechnet.
„Der Maler muss einsam sein, besonders, wenn er das, was ihn umgibt, genau betrachten will. Er muss mit sich selbst reden und sich zu seinem Studium das Schönste und Größte auswählen, was er finden kann. Wobei er verfährt wie der Spiegel, der die Farben all der Dinge annimmt, die vor ihm stehen. Und wenn er so verfährt, geht er vor wie die Natur“.
„Der Geist des Malers hat dem Spiegel zu gleichen, der sich stets in die Farbe des Gegenstandes wandelt, den er zu seinem Gegenüber hat, und sich mit soviel Abbildern erfüllt als ihm Dinge gegenüberstehen ...“ (LdV)
„Du sollst bei deinem Malen einen flachen Spiegel zur Hand haben und dein Werk des öfteren darin betrachten...“ „Den Daseinsgrund der Malerei findet er in dem Umstande, dass eine ebene Fläche (das Spiegelbild der Natur in unserem Auge) auf einer ihr gegenüberstehenden ebenen Fläche (dem Malgrunde) ihr vollständiges Ebenbild erhält.“ [5]
„Die Malerei ist die erste der Wissenschaften, die alle augenscheinlichen Werke des höchsten Gottes wiederholt.“
In der Darstellung des Menschen und seiner Seele ist die Malerei des Lionardo da Vinci auch nach 500 Jahren seltsamerweise noch nicht veraltet. So lebt die Universalität des Virtuosen im Nachklang der Jahrhunderte bis in die heutige Zeit weiter.
Da ich in der Malweise von Lionardo da Vinci eine eindeutige Spiegelverkehrtheit festgestellt habe, zeige ich hier nur:
„GESPIEGELTE ANSICHTEN“
Die Originalansichten seiner Werke, als die Interpreten seines Lebens, als Lebensdaten seiner Persönlichkeit und der Stufenleiter seiner Empfindungen sind ja schon zur Genüge im Umlauf. Deshalb hier:
„DER WAHRE LEONARDO DA VINCI“
1Das Abendmahl Leonardo da Vincis Eine systematische Bildmonographie, Georg Eichholz, Scaneg Verlag München, 1998, Seite 122
2Das Abendmahl Leonardo da Vincis Eine systematische Bildmonographie, Georg Eichholz, Scaneg Verlag Mü., 1998, Seite 190
3Leonardo Abendmahl, Ludwig H.Heydenreich, Reclam-Verlag GmbH Stuttgart, 1958, Seite 23
4Das Abendmahl Leonardo da Vincis Eine systematische Bildmonographie, Georg Eichholz, Scaneg Verlag München, 1998, S.169/170
5Leonardo da Vinci, der Wendepunkt der Ranaissance von Woldemar von Seidlitz, Im Verlag Julius Bard Berlin, Erster und Zweiter Band, 1909, Seite 324, Seite 318)
Cecilia Galerani
Ginevra de Benci
Auch „La Bencina“ betitelt,
um 1478 - 1480,
National Gallery of Art Washington D.C.,
39cm x 37cm,
Öl und Tempera auf Pappelholz
Spruchband auf der Rückseite: „VIRTUTEM FORMA DECORAT“ zu übersetzen im Sinne von: „die Gestalt schmückt die Tugend“, „ihre Tugend ist mit Eleganz verziert“, oder „Schönheit erhöht den Glanz der Tugend“. Das Bild ist im unteren Bereich amputiert (ca. um 12-15cm), so ist es möglich, dass für Ginevra noch ein kleiner Zweig, oder eine besondere Blume in den Händen zugedacht war. Zusätzlich sind oberhalb der Schnittfläche noch mehrere fingerbreit übermalt. Die ursprüngliche Größe lässt sich jedoch aus der bemalten Rückseite feststellen.
Die dargestellte florentiner Edelfrau ist Ginevra de‘ Benci (1457-1520). Sie ist die Tochter des wohlhabenden Bankiers Amerigo de‘ Benci. Dieser ist auch Berater der Medici, Kunstsammler und Mäzen. Er gilt als einer der reichsten Bürger von Florenz.
Ginevra wird vom Dichter Alessandro Braccesi, in ihrem Seelenadel und ihrer Bescheidenheit, als die Größte in der ganzen Stadt gerühmt.
Leonardo ist eng mit Giovanni, dem Bruder Ginevra‘s, einem berühmten Kosmographen, befreundet und so entsteht dieses ätherische Porträt der Siebzehnjährigen zur Zeit der Eheschließung mit dem Kaufmann Luigi di Bernardo Niccolini und ihrer herzzerbrechenden „neuplatonischen“ Liebe zu dem venezianischen Botschafter Bernardo Bembo (1433-1519). Beide verbindet die Lyrik und die Verehrung zu dem italienischen Poeten Petrarca (1304-1374):
„Man ist nicht adlig geboren, man kann es nur werden.“
Abb. 6
Lionardo über Petrarca:
„Wenn Petrarca den Lorbeer so sehr liebte, so geschah es, weil er in der Wurst und zu Krammetsvögeln recht gut schmeckt. Ich kann solchen Kleinigkeiten freilich keinen Geschmack abgewinnen.“
In Frontalität - Das Gemälde der tatarisch-streng äugelnden Ginevra, die einer Mondscheibe gleich in innerer Zurückhaltung vor einer verdämmerten Ferne aus dem dunklen, unzugänglichen Gesträuch herausstrahlt.
Abb. 7
Zarter Wacholderzweig in der Mitte des Gemäldes mit `funkelnden roten Beeren`, die sich sternengleich über den Bilderhintergrund auszubreiten scheinen. Diese flunkern aus dem imitierten, roten Porphyrmarmor hervor und deuten in Ihrer dauerhaften Standfestigkeit auf Ginevra’s Tugenhaftigkeit hin. Der Wacholder, in der Mitte thronend, ist umgeben von einem immergrünen Lorbeerzweig (links) und einem Palmwedel (rechts)Die Reflektographie hat aufgedeckt, dass unter dem Spruchband die Inschrift: „ VIRTUS ET HONOR „ (‚Tapferkeit und Ehre‘ bzw. ‚edler Trieb und Ansehen‘) steht, was wiederum auf den Wahlspruch des Patriziers Bembo hindeutet. Er war als Abgesandter von Venedig von 1474-1476 und 1478-1480 in der Serenissima zu Florenz tätig.
Abb. 8
Auf der Rückseite des Gemäldes, auf fingiertem, rot-porphyrmarmoriertem Grund, befinden sich noch zwei Embleme Bembos: Der Lorbeerzweig (Symbol des Ruhmes) und der Dattelpalmwedel (Symbol für den Sieg über den Tod), die in einer Schlaufe mit einem Wacholder (Symbol ewigen Lebens) girlandenförmig verflochten sind.
Wir haben es hier mit einem leonardesken Rätsel in Symbolsprache zu tun, die als Auftraggeber auf den Diplomaten Bembo hindeutet, der 1475/76 in Florenz residiert.
„Ginevra“ steht als sinnbildliches Wortspiel zu „Ginepro“, der italienischen Bezeichnung für „Wacholder“ (in Bedeutung von: „immergrüner Baum“).
Er zeichnet sich aus als Baum oder Strauch mit seinen graugrünen Nadeln und seinem aromatischen Duft.
Der Wacholder gilt im Volksglauben als Spender von Leben und Gesundheit, aber auch als Abwehrmittel gegen den Teufel, Hexen und schädliche Tiere.
Die Zweige dienen zum lebenweckenden Schlagen oder, über der Haustür und im Stall aufgehängt, zur Abwehr böser Geister.
Ginevra ist die vollkommene Schöpfung „nach der Natur“ in Dreidimensionalität des Gesichtes und das Naturtalent LdV zeigt auf, dass er mit seinen ca. 22 Lenzen schon unerreichbar ist in seiner Darstellungskunst, in der Formgebung und in Lebendigkeit.
Sehr schön lässt sich das für ihn typische Ebenmaß seiner Pyramidalkonstruktion erkennen, mit dem die Querlinien durchtrennenden Auge.
Wie eine kranzförmige Sonnenscheibe strahlt das alabasterglatte, fein modellierte, ovale Gesicht Ginevra‘s auf ihren Betrachter, in einem scheinbar nie erlöschenden Lichte als köstliches Juwel menschlichen Wesens.
Nach Leonardo‘s Auffassung hat der malende Künstler acht oder genauer zehn Dinge die das Auge lehrt (predicamenti dell‘ occhio) wohl zu beachten:„Finsternis, Licht, Körper, Figur, Farbe, Ort und Lage, Entfernung und Nähe“.Zwei weitere kann man noch anführen:„Bewegung und Ruhe“.
Abb. 9
Fast der Aura eines Heiligenscheins entsprechend, umfließt ein Fluidum der Transzendenz den fahlen Kopf der vornehmen Ginevra.
Der Anonymo Gaddiano (1542-1547) weiss zu berichten: „Leonardo konterfeite in Florenz nach der Natur Ginevra d‘Amerigo Benci und so trefflich brachte er die Arbeit zu Ende, dass es nicht ein Porträt, sondern wie die leibhaftige Ginevra selbst zu sein schien.“ In dispersiver Transparenz einer kaum wahrnehmbaren idealen Spiegelseele der erwartungsvollen Jugend, ist die unnachahmbare Botschaft in Ginevra‘s leuchtendem Traumblick eingeflochten.
Ginevra, in preziöser Zierlichkeit, ist in ihrer eleganten Bescheidenheit, eine noch unberührte Jungfrau. Wie man in der mit Schnürbändern vorne zugeknöpften braunen Bluse und dem in gleicher Weise mit einem dünnen Tüllstoff bedeckten weißen Unterkleid verstehen soll.
Links- vergrößerter Bildausschnitt, leicht gedreht.RechtsOben - Phallische KirchtürmeRechtsUnten - Buschgesicht aus dem Strauchwerk (Bernardo)
Abb. 10
Hinter ihr am blauen Horizont in heller Silhouette ist jedoch schon der Kirchturm in Sicht, dessen Spitze einem Phallus ähnelt, sozusagen als Vorankündigung für ihre anstehende kirchliche Zeremonie.
Im Hintergrund noch ein baumbestandenes Naturschauspiel in lindem Windhauch am dämmrigen, golddurchglühten Abendhimmel. Die weiche Abendsonne wirft ihre metallischen Lichtreflexe auf einen hügelumrahmten, schillernden Wasserlauf.
Das flimmernde Ufer wird von fernen Hügeln überragt, deren blaue Färbung auf‘s feinste mit der tiefbraunen Farbe des Kleides kontrastiert. Koloristisch stimmt dieser Hintergrund jedoch wieder mit den azurblauen Schnürbändern überein, an denen man natürlich den nahen Himmel vergessen soll.
In Dreh- und Wendefigur wird der Kirchturm in Phallusform dann zur Nasenspitze des neuplatonisch anleutenden Bernardo, der schon mit weit geöffneten Lippen, aus dem Gebüsch hervorlechzt.
Und siehe da, dem Ehemann in Spe, Lugi, wird Leonardo wohl die zweite Kirchturmspitze zugedacht haben, die sich gleich daneben erhoben befindet.
So sind beide Verehrer vertreten, im Anklang der Kirchenglocken, sowohl in der Liebe, als auch in der nahenden Hochzeit.
Hinter der porzellanartigen Ginevra, mit ihren kurvigen aschblonden Ringellöckchen, die hinten in einer kleinen Mütze zusammengehalten sind, das stachlige, schwärzlich-grüne Wacholdergebüsch mit seinen feinen, spitzen Blättern, das in seiner Symbolträchtigkeit noch alles Böse von Ihr abwehren soll.
In der durchscheinenden, geschlossenen Lichtlücke schauen auch einige „Beschützer“ in Gestalt „kleiner Ameisenmännchen“ oder „schwarzer Stachelköpfchen“ aus den dornenähnlichen Nadelspitzen geformt, allgegenwärtig hervor.
Dies gilt auch für die Partien links und rechts neben dem Kopf der schweigsamen Ginevra in abgeschwächter Form, die aus dem Himmel herausschauenden kleinen „Strichmännchen“ gleichen.
Im spitzen Gitterwerk eingebaut und verwachsen, bewacht der beschattende Ginsterstrauch das noch vorhandene Band der „Ehre und Tugend“. Er ist der Kapitiän der aus der Seele Ginevra‘s spricht.
Somit erhält das verhaltene, innere Leben Ginevra‘s Ihre Kraft aus der Wacholderhecke heraus, die gespeicherte Sonnenenergie enthält, welche sie in transformierter Form wieder an ihr Umfeld abgibt.
Die keusche Ginevra ist eins mit dem emblematischen Wacholderbaum, mit ihm verwachsen und verschmolzen und ihre schwarze Stola umschlingt sie, wie die Wurzeln Ihres Baumes.
Man kann förmlich spüren, wie die nach unten drängende „Schalwurzel“ das Leben und die Säfte aus dem Erdreich, nach oben in die Heckenkrone befördert, welche zugleich das Haupt der Ginevra ziert.
LdV zeichnet uns den genau beobachteten „Idealwuchs“ eines Baumes mit seinen Verästelungen als „Masswerk“ der Verästelungen in seinen gegabelten Zickzackwendungen auf.
Abb. 11
Visualisierung der ausgebogenen Energieströme aus dem Wacholderbusch. Er erkennt die Gesetze des Baumwuchses und der Blattstellung:„Bei allen Baumverzweigungen spriesst das sechste obere Blatt über dem sechsten tiefer unteren, hervor.“ (LdV)
Abb. 12
In voller Körperlichkeit, wie eine Gefesselte/Gefangene schaut Ginevra mit ihren bernsteinfarbenen Augen aus ihrem knospenhaften Kerker aus verworrenen Stacheldrähten zu uns herüber. So verzückt sich langsam unsere Phantasie im Einklang mit unserem Gegenüber und man landet in einem urgöttlichen Trauma einer züchtigen Kindheit und Jugend.
Die Aufgabe und das Ziel der Poträtmalerei die sich Leonardo hier stellt, besteht darin jeden der schaut zu fesseln und die sterbliche Hülle durch die Kunst unsterblich zu machen.
„ Sterbliche Schönheit vergeht, jedoch nicht die der Kunst.“ (LdV)
Ginevra hält in einer späteren Nachahmung (Seite 16 von Lorenzo di Credi) sehr bedacht einen (Ehe-)Ring zwischen Daumen und Zeigefiger ihrer linken Hand. Der Anlass der meisten florentiner Porträts von Frauen war ja deren Hochzeitsfeier.
So wird hier zusätzlich ihr innerer Zwiespalt zu vollster Realität zwischen verhaltener Leidenschaft (Bembo) und erhabener Tugendhaftigkeit (Luigi) in sinnender, stiller Ekstase vermittelt.
So wäre auch eine frühere ‚geheime‘ Auftragserteilung des ‚Liebhabers nach Plato‘ an Leonardo möglich, um „SEINE GINEVRA“ mit nach Venedig zu entführen, damit SIE für immer bei ihm blübe und eine ‚offiziell‘ vereinbarte Auftragserteilung an Lorenzo di Credi müsste dann etwas später vom Ehegatten ‚in spe‘ als Liebesbeweis und Hochzeitsgeschenk gekommen sein..
Ginevra ist beselte Form und geformtes Leben in sprechender Bewegung, die in seltener Größe, in starker Kraft bewegten Wesens und Energie, vor uns steht, zusammengefasst auf einen Augenpunkt, der wie ein Funke flammenden Lebens aus diesem „relievo“ (plastischer Formwirkung) sprüht.
Leonardo hebt hier tiefgehend alles hervor, was Leben heißt und was die Natur an innerer Bewegung dazu aufzubieten hat („tutti perfectissimi“).
So bedeutet jedes seiner Bilder eine neue Fragestellung aus einer vorgefassten Idee, die ihn zur höchsten künstlerischen Tat antreibt. Die Einheit, mit der das Gottwesen mit dem Erdenwesen verbunden ist erscheint als bezaubernde Wirklichkeitserscheinung vom Ich, auf malerischer Raumillusionsfläche, als Menschenform im geheimnisvollen Weltraum. In einizigartigem Erfülltsein kehrt das Innere nach außen, als Offenbarung eines tiefinnerlichen Zwiegespräches, in einem Hinüber und Herüber der Seele.
Abb. 13
„Wo immer die Sonne das Wasser sieht, da sieht das Wasser auch die Sonne und kann daher überall das Bild der Sonne dem Auge wiedergeben.“
„ Es ist aber unmöglich, dass das, was auf dem Wasser gespiegelt wird, die gleiche Gestalt hat wie der sich spiegelnde Gegenstand, da der Mittelpunkt des Auges über der Oberfläche des Wassers liegt.“ (LDV)