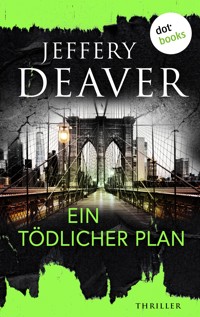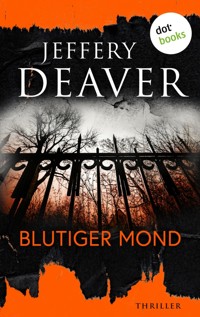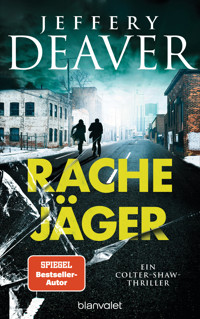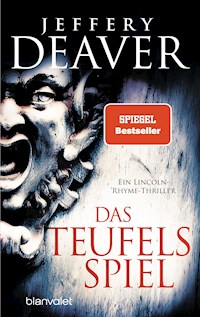9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der 2. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
Ein kaltblütiger Mörder hält Detective Lincoln Rhyme in Atem. Das einzige Erkennungsmerkmal des Killers ist seine Tätowierung – sie zeigt den Tod und ein Mädchen tanzend auf einem Sarg. Rhyme glaubt den Mörder zu kennen, und sollte sich sein Verdacht bestätigen, kennt er nur noch einen Gedanken: Rache – aus ganz persönlichen Gründen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Das unschlagbare Ermittlerteam Lincoln Rhyme und Amelia Sachs hat es diesmal mit einem würdigen Gegner zu tun. Der »Totentänzer«, ein erfahrener Auftragskiller, ist an Gerissenheit kaum zu überbieten. Er ändert sein Erscheinungsbild schneller, als er seine Opfer zur Strecke bringt, und nur eines lebte lange genug, um der Polizei einen Hinweis zu geben: Der Mörder trägt eine seltsame Tätowierung, die den Sensenmann im Tanz mit einer schönen Frau auf einem Sarg darstellt. Rhyme ist überzeugt davon, den Killer kennen, und die Erinnerung lässt bittere Rachegefühle in ihm aufsteigen. Denn bei einem Attentat des »Totentänzers« war vor einigen Jahren Rhymes Freundin Claire ums Leben gekommen. Als der Mörder erneut zuschlägt und sein Opfer, ein wichtiger Zeuge in einem Waffenschieberprozess, wie durch ein Wunder verschont bleibt, wissen Amelia und Lincoln, dass sie handeln müssen. Sie haben genau 48 Stunden Zeit, um dem »Totentänzer« eine Falle zu stellen.
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Letzter Tanz
Thriller
Deutsch von Thomas Müller und Carmen Jakobs
In Erinnerung an meineGroßmutter Ethel May Rider
ERSTER TEIL Zu viele Möglichkeiten zu sterben
Kein Falke wird zum Haustier. Da gibt es keine Gefühlsduselei.
In gewisser Weise ist im Umgang mit ihnen die Kunst eines Psychiaters gefragt.
Man mißt seinen eigenen Verstand an dem eines anderen,
mit tödlicher Logik und Interesse.
The Goshawk, T. H. White
1
Als Edward Carney sich von seiner Frau Percey verabschiedete, dachte er keinen Augenblick daran, daß es das letzte Mal sein könnte.
Er stieg in sein Auto, das auf einem der begehrten Parkplätze an der East Eighty-First Street in Manhattan stand, und fädelte sich in den Verkehr ein. Carney, von Natur aus ein aufmerksamer Beobachter, bemerkte einen schwarzen Lieferwagen, der in der Nähe ihres Stadthauses parkte. Er musterte das heruntergekommene Fahrzeug genauer: Die verspiegelten Scheiben waren schlammverspritzt, das Nummernschild war in West Virginia ausgestellt. Ihm fiel ein, daß er denselben Wagen in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in der Straße gesehen hatte. Doch in diesem Augenblick setzte sich die Autoschlange vor ihm in Bewegung. Er schaffte es gerade noch, bei Gelb über die Kreuzung zu kommen, und hatte den Lieferwagen bald völlig vergessen. Kurz darauf erreichte er den FDR Drive und fuhr Richtung Norden.
Zwanzig Minuten später jonglierte er mühsam mit einer Hand sein Autotelefon und wählte die Nummer seiner Frau. Er war beunruhigt, als sie nicht ranging. Eigentlich hätte Percey mit ihm fliegen sollen – noch am Abend zuvor hatten sie eine Münze geworfen, um auszulosen, wer von beiden den linken Sitz, den Pilotensitz, übernehmen sollte. Sie hatte gewonnen und ihn mit ihrem typischen Siegergrinsen bedacht. Aber dann war sie gegen 3.00 Uhr mit einer unerträglichen Migräne aufgewacht, die den ganzen Tag über anhielt.
Schließlich hatten sie nach ein paar Anrufen einen Ersatz-Copiloten aufgetrieben, und Percey hatte eine Tablette Fiorinal genommen und war ins Bett gegangen.
Ein Migräneanfall war so ziemlich das einzige, was sie vom Fliegen abhalten konnte.
Edward Carney war hoch aufgeschossen, fünfundvierzig Jahre alt und trug noch immer den Kurzhaarschnitt aus seiner Militärzeit. Während er dem Klingeln des Telefons lauschte, richtete er sich kerzengerade auf. Ihr Anrufbeantworter schaltete sich ein, und er legte das Telefon leicht beunruhigt in die Schale zurück.
Er hielt den Wagen vorschriftsmäßig bei exakt neunzig Stundenkilometern genau in der Mitte der rechten Spur; wie die meisten Piloten war er ein überaus vorsichtiger Autofahrer. Anderen Piloten vertraute er, die meisten Autofahrer hingegen hielt er für unberechenbar.
Im Büro von Hudson Air Charter auf dem Mamaroneck Regionalflughafen in Westchester wartete bereits ein Kuchen auf ihn. Die affektierte und stets leicht aufgedonnerte Sally Anne, die mal wieder wie die gesamte Parfümabteilung von Macy’s roch, hatte ihn selbst gebacken, um den neuen Auftrag der Firma zu feiern. Sie trug die häßliche Brosche mit dem Doppeldecker aus Kristall, die sie von ihren Enkeln letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Wachsam huschten ihre Augen durch den Raum, um sicher zu gehen, daß auch jeder der etwa ein Dutzend Mitarbeiter ein ordentliches Stück der Kalorienbombe auf seinem Teller hatte. Ed Carney nahm ein paar Bissen Kuchen zu sich und besprach die Einzelheiten des Flugs mit Ron Talbot, dessen imposanter Bauch eine Vorliebe für Kuchen vermuten ließ, obwohl er sich hauptsächlich von Kaffee und Zigaretten ernährte. Talbot hatte eine Doppelfunktion. Er war Finanzmanager und zugleich für die Einsatzplanung verantwortlich und machte sich gerade eine Menge Sorgen: Ob die Ladung rechtzeitig ankommen würde, ob der Benzinverbrauch für den Flug richtig berechnet war und ob sie den Preis für den Auftrag richtig kalkuliert hatten. Carney reichte ihm den Rest seines Kuchens und empfahl ihm, sich zu beruhigen.
Er dachte wieder an Percey, ging in sein Büro und griff zum Hörer.
Noch immer nahm niemand ab.
Aus seiner leichten Beunruhigung wurde echte Sorge. Leute mit Kindern und Leute mit einer eigenen Firma gehen immer ans Telefon, wenn es klingelt. Er knallte den Hörer auf die Gabel, dachte kurz daran, einen Nachbarn anzurufen und ihn zu bitten, einmal nachzusehen. Aber dann sah er, wie der große, weiße Lastwagen vor dem Hangar vorfuhr. 18.00 Uhr. Es war Zeit aufzubrechen.
Als Talbot Carney gerade ein Dutzend Papiere zur Unterschrift vorlegte, tauchte der junge Tim Randolph auf. Er trug einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine schmale, dunkle Krawatte. Tim bezeichnete sich als »Copiloten«, was Carney zu schätzen wußte. »Erste Offiziere« waren Firmenleute, Erfindungen von Fluggesellschaften. Carney respektierte jeden, der den rechten Sitz beherrschte, verachtete aber jegliche Anmaßung.
Lauren, Talbots großgewachsene, brünette Assistentin, trug ihr Glückskleid, dessen blaue Farbe den gleichen Ton hatte wie das Logo der Hudson Airline – die Silhouette eines Falken über einem mit Breiten- und Längengraden markierten Globus. Sie lehnte sich an Carney und flüsterte: »Jetzt ist alles okay, nicht wahr?«
»Es wird schon gutgehen«, versicherte er ihr. Sie umarmten einander kurz. Auch Sally Anne nahm ihn in die Arme und bot ihm noch ein Stück Kuchen für den Flug an. Er lehnte ab. Ed Carney wollte aufbrechen, wollte weg von den Gefühlen, weg von den Feierlichkeiten. Weg vom Boden.
Und kurz darauf war er allem entronnen. Drei Meilen über dem Boden, steuerte er einen Lear 35 A, den besten Privatjet, der je gebaut wurde. Die Maschine war schnittig wie ein Hecht, hatte keinerlei Kennzeichnung oder Insignien – nur ihre N-Registriernummer prangte auf dem blankpolierten Silber.
Sie flogen auf einen phänomenalen Sonnenuntergang zu – eine perfekte orangerote Scheibe, die in ein wildes, purpur- und rosafarbenes Wolkenmeer eintauchte und dabei ihre letzten Strahlen gen Himmel schickte.
Nur ein Sonnenaufgang war ähnlich beeindruckend. Und nur ein Sturmgewitter war spektakulärer.
Es waren 1150 Kilometer bis zum O’Hare Flughafen, und sie brauchten für die Strecke weniger als zwei Stunden. Air Traffic Control Center in Chicago bat sie höflich, auf vierzehntausend Fuß runterzugehenund übergab sie dann für das letzte Stück an Chicago Approach Control.
Tim übernahm den Funkkontakt: »Chicago Approach. Lear Vier Neun Charlie Juliet im Anflug auf vierzehntausend.«
»Guten Abend, Neun Charlie Juliet«, meldete sich ein entspannt wirkender Fluglotse. »Gehen Sie runter, und bleiben Sie dann auf achttausend Fuß. Luftdruck Chicago 30 Punkt eins, eins Inches. Erwarten Sie Radarführung für siebenundzwanzig Links.«
»Roger, Chicago. Neun Charlie Juliet von vierzehn auf acht.«
O’Hare ist der geschäftigste Flughafen der Welt, und Air Traffic Control dirigierte sie in eine Warteschleife über einem westlichen Vorort, wo sie bis zur Landeerlaubnis kreisten.
Zehn Minuten später forderte sie die funkverzerrte, aber angenehme Stimme auf: »Neun Charlie Juliet, gehen Sie Steuerkurs Null Neun Null im Gegenanflug für Landebahn auf 27 L.«
»Null Neun Null, Neun Charlie Juliet«, bestätigte Tim.
Carney blickte nach oben zu den Sternen im glitzernden Nachthimmel und dachte: Sieh mal, Percey, alle Sterne der Nacht…
Und plötzlich überkam ihn ein ganz und gar unprofessioneller Wunsch, vielleicht der erste in seiner gesamten Laufbahn. Seine Sorge um Percey schoß wie eine Fieberkurve in die Höhe. Er mußte unbedingt mit ihr reden.
»Übernimm du die Maschine«, rief er Tim zu.
»Roger«, bestätigte der junge Mann und griff, ohne zu zögern, nach dem Steuerknüppel.
Air Traffic Control meldete sich wieder krächzend: »Neun Charlie Juliet, gehen Sie auf viertausend runter. Bleiben Sie auf Kurs!«
»Roger, Chicago«, antwortete Tim. »Neun Charlie Juliet von acht auf vier.«
Carney wechselte die Frequenz seines Funkgeräts, um ein Unicom-Gespräch zu führen. Tim blickte fragend zu ihm herüber. »Ich rufe nur kurz in der Firma an«, erklärte Carney. Als er Talbot an die Leitung bekam, bat er ihn, das Gespräch zu Percey durchzustellen.
Während er wartete, ging er mit Tim die Litanei der Landevorbereitungen durch.
»Landeklappen… zwanzig Grad.«
»Zwanzig, zwanzig, grün«, antwortete Carney.
»Geschwindigkeits-Check.«
»Einhundertachtzig Knoten.«
Während Tim ins Mikrofon sprach – »Chicago, Neun Charlie Juliet, durch fünf auf vier« –, hörte Carney, wie das Telefon in seinem Haus in Manhattan tausend Kilometer entfernt zu läuten begann.
Mach schon, Percey, nimm ab! Wo bist du?
Bitte…
ATC meldete sich: »Neun Charlie Juliet, mit der Geschwindigkeit auf hundert acht null runtergehen. Übergebe jetzt an den Tower. Schönen Abend.«
»Roger, Chicago. Hundert acht null Knoten. Schönen Abend.«
Es klingelte zum dritten Mal.
Wo zum Teufel war sie nur? Was war los?
Der Knoten in seinem Magen wurde härter.
Die Turbotriebwerke gaben ein pfeifendes, bohrendes Geräusch von sich. Die Hydraulik ächzte. In Carneys Kopfhörer fiepte die Statik.
Tim gab durch: »Landeklappen dreißig Grad. Fahrwerk raus.«
»Landeklappen, dreißig, dreißig, grün. Fahrwerk raus. Drei grün.«
Dann, endlich – in seinem Kopfhörer ein hartes Klicken.
Die Stimme seiner Frau: »Hallo?«
Vor Erleichterung lachte er laut auf.
Carney setzte gerade zum Sprechen an, als ein gewaltiger Ruck durch die Maschine ging. Die Wucht der Explosion war so stark, daß sie ihm im Bruchteil einer Sekunde die sperrigen Hörer vom Kopf riß und die beiden Männer nach vorne ins Instrumentenfeld schleuderte. Um sie herum schwirrten Metallsplitter, stoben Funken.
Instinktiv griff Carney mit seiner linken Hand nach dem halb abgerissenen Steuerknüppel – eine rechte Hand besaß er nicht mehr. Er drehte sich zu Tim hinüber, gerade als dessen blutüberströmter, marionettenhaft wirkender Körper durch eines der klaffenden Löcher im Rumpf verschwand.
»O mein Gott. Nein, nein…«
Dann löste sich das gesamte Cockpit von dem zerberstenden Flugzeugrumpf und schoß in einer Spirale der Erde entgegen. In einen Feuerball aus brennendem Benzin eingehüllt, setzten Rumpf, Flügel und Triebwerke ihren Flug alleine fort.
»Oh, Percey«, stöhnte er. »Percey…« Aber es gab schon längst kein Mikrofon mehr, das seine Worte hätte auffangen können.
2
Groß wie ein Asteroid, gelblich wie Knochen.
Die Sandkörner leuchteten auf dem Computerschirm. Der Mann saß vornübergebeugt, den Nacken verkrampft, die Augen vor Konzentration zusammengekniffen.
In der Ferne war Donner zu hören. Der Morgenhimmel leuchtete gelb und grün, und jede Minute konnte ein Sturm losbrechen. Es war der verregnetste Frühling seit Menschengedenken.
Sandkörner…
»Vergrößern«, befahl er, und sofort wurde das Bild auf dem Computerschirm doppelt so groß.
Seltsam, dachte er.
»Cursor nach unten… Stop!«
Er beugte sich wieder angestrengt nach vorn und studierte aufmerksam den Bildschirm.
Sand ist die Freude eines jeden Kriminalisten, dachte Lincoln Rhyme: ein paar Körnchen nur, manchmal vermengt mit anderem Material; mit einem Durchmesser von 0,05 bis zu 2 Millimetern (alles, was größer ist, ist Kies, alles, was kleiner ist, Treibsand). Sand haftet an den Kleidern eines Täters wie klebrige Farbe und fällt praktischerweise an Tatorten und in Verstecken zu Boden – und stellt so eine Verbindung zwischen Mörder und Mordopfer her. Sand kann auch eine Menge darüber verraten, wo ein Verdächtiger sich aufgehalten hat. Trüber, dunkler Sand bedeutet, er war in der Wüste. Klarer Sand heißt Strand. Hornblende weist auf Kanada hin, Obsidian auf Hawaii. Quarz und Magma bedeuten Neu-England. Glattes, graues Magnetit kommt vor allem an den westlichen Großen Seen vor.
Aber Rhyme hatte nicht die geringste Ahnung, woher dieser besondere Sand stammen könnte. Der meiste Sand im Gebiet von New York besteht aus Quarz und Feldspat; er ist felsig am Long Island Sund, staubig am Atlantik, schlammig am Hudson. Dieser hier aber war glitzernd weiß und gezackt, vermengt mit kleinen, rötlichen Kügelchen. Und was waren das für Ringe? Weiße, steinerne Ringe, die aussahen wie mikroskopisch kleine Calamari. So etwas hatte er noch nie gesehen.
Dieses Rätsel hatte Rhyme bis vier Uhr morgens wach gehalten. Soeben hatte er eine Probe des Sandes an einen Kollegen im Washingtoner FBI-Labor geschickt, und er hatte es mit größtem Widerwillen getan. Lincoln Rhyme haßte es, wenn jemand anderes seine Fragen beantwortete.
Vor dem Fenster neben seinem Bett bewegte sich etwas. Er sah hinüber. Seine Nachbarn – zwei gedrungene Wanderfalken – waren wach und bereit, auf die Jagd zu gehen. Tauben, aufgepaßt, dachte Rhyme. Plötzlich neigte er den Kopf und murmelte leise: »Verdammt.« Der Fluch galt nicht seiner Frustration darüber, daß er das unkooperative Beweismittel nicht identifizieren konnte, sondern der bevorstehenden Unterbrechung.
Eilige Schritte waren auf der Treppe zu hören. Thom hatte Besucher hineingelassen, und Rhyme wollte jetzt niemand sehen. Er blickte voll Ärger zum Flur. »O Gott, nicht jetzt.«
Aber das hörten sie natürlich nicht, und selbst wenn, so hätten sie keine Sekunde gezögert.
Sie waren zu zweit.
Einer war schwer, der andere nicht.
Ein flüchtiges Klopfen an der offenen Tür, und schon waren sie eingetreten.
»Lincoln.«
Rhyme brummte nur.
Lon Sellitto war Detective im New York Police Department NYPD und für die schweren Schritte verantwortlich. An seiner Seite trottete sein schlanker, jüngerer Partner herein. Jerry Banks hatte sich mit einem grauen Anzug aus feinstem schottischem Tuch herausgeputzt. Seine wilde Tolle war dick mit Festiger eingesprayt – Rhyme konnte Propan, Isobutan und Vinylacetat riechen –, trotzdem stand der liebenswürdige Wirbel wie bei der Comicfigur Dagwood hartnäckig hervor.
Der rundliche Mann schaute sich in dem sechs mal sechs Meter großen Schlafzimmer um. An den Wänden hingen keinerlei Bilder. »Was hat sich verändert, Linc? Ich meine, hier in deinem Zimmer?«
»Nichts.«
»Oh, hey, ich hab’s – es ist aufgeräumt und sauber«, platzte Banks heraus, unterbrach sich dann abrupt, als er seinen Fauxpas bemerkte.
»Klar ist es sauber«, stimmte Thom zu, der in seiner akkurat gebügelten braunen Hose, dem weißen Hemd und der geblümten Krawatte mal wieder wie aus dem Ei gepellt aussah. Obwohl Rhyme sie selbst über einen Katalogversand für Thom gekauft hatte, fand er sie übertrieben bunt. Thom war bereits seit Jahren Rhymes Adlatus – und obwohl er in dieser Zeit zweimal von Rhyme gefeuert worden und einmal selbst gegangen war, hatte der Ermittler den unerschütterlichen Krankenpfleger und Assistenten jedesmal wieder eingestellt. Thom wußte über Querschnittslähmungen soviel wie ein Arzt, und er hatte von Rhyme genügend über Gerichtsmedizin gelernt, um selbst als Kriminalist arbeiten zu können. Aber er war zufrieden, das zu sein, was die Versicherung schlicht als ›Pfleger‹ bezeichnete. Allerdings lehnten sowohl Rhyme als auch Thom diese Bezeichnung ab. Rhyme nannte ihn abwechselnd »meine Glucke« oder »meine Nemesis«, zu Thoms grenzenloser Belustigung. Jetzt schob er sich an den Besuchern vorbei. »Er war dagegen, aber ich habe die Mädels von Molly Maids engagiert und sie das ganze Haus mal richtig von oben bis unten schrubben lassen. Im Grunde genommen hätte alles ausgeräuchert werden müssen. Danach hat er einen ganzen Tag nicht mit mir gesprochen.«
»Es brauchte nicht geputzt zu werden. Jetzt kann ich einfach nichts mehr finden.«
»Andererseits braucht er auch gar nichts zu finden, nicht wahr?« erwiderte Thom. »Dafür bin ich ja schließlich da.«
Rhyme war nicht in der Stimmung für weitere Scherze. »Nun, was gibt es?« fragte er und wandte sein gutaussehendes Gesicht Sellitto zu.
»Hab einen Fall. Dachte mir, daß du vielleicht helfen willst.«
»Ich bin beschäftigt.«
»Was ist das hier?« fragte Banks und deutete auf einen neuen Computer, der neben Rhymes Bett stand.
»Oh, das«, verkündete Thom mit geradezu empörender Fröhlichkeit. »Er ist jetzt auf dem neuesten Stand. Zeig es ihnen, Lincoln. Führ es vor.«
»Ich will nichts vorführen.«
Noch mehr Donner, aber kein Tropfen Regen. Wie so oft foppte die Natur heute nur.
Thom blieb hartnäckig. »Nun zeig ihnen schon, wie es funktioniert.«
»Ich will nicht!«
»Es ist ihm peinlich.«
»Thom«, murrte Rhyme.
Aber der junge Gehilfe war gegen Drohungen immun. Er zupfte an seiner scheußlichen – oder modernen – Seidenkrawatte. »Ich weiß wirklich nicht, warum er sich jetzt so anstellt. Gestern schien er noch richtig stolz auf das Ganze zu sein.«
»War ich nicht.«
Thom ließ sich nicht beirren. »Diese Box dort« – er zeigte auf einen beigen Apparat –, »die führt in den Computer.«
»Wow, ist das etwa das allerneuste Modell?« rief Banks und betrachtete den Computer voller Ehrfurcht. Um Rhymes finsterem Blick zu entkommen, stürzte sich Thom auf die Frage wie ein Storch auf einen Frosch.
»Yup, nicht schlecht, was?« strahlte er.
Aber Lincoln Rhyme war jetzt nicht an Computern interessiert. Im Augenblick interessierten ihn einzig und allein die mikroskopisch kleinen Calamari-Gebilde und der Sand, in dem sie eingelagert waren.
Thom ließ sich nicht aufhalten: »Das Mikrofon ist mit dem Computer verbunden. Was auch immer er sagt, der Computer erkennt es. Das Ding hat ziemlich lang gebraucht, bis es seine Stimme gelernt hat. Er nuschelt nämlich.«
In Wahrheit war Rhyme ziemlich zufrieden mit dem System – ein blitzschneller Computer mit Stimmerkennungssoftware, dazu eine speziell angefertigte Box, mit der er seine Umgebung steuern konnte. Allein durch seine Stimme konnte er damit die Heizung höher oder niedriger stellen, die Lichter ein- oder ausschalten, die Stereoanlage und den Fernseher bedienen, Telefonnummern wählen und Faxe verschicken. Am Computer dirigierte er den Cursor einfach nur, indem er sprach, so wie andere es mit Maus und Tastatur taten. Er konnte selbst Briefe und Berichte diktieren.
»Er kann sogar komponieren«, erklärte Thom den Besuchern voller Stolz. »Er sagt dem Computer einfach, welche Noten er in das Programm schreiben soll.«
»Nun, das ist wirklich sinnvoll«, bemerkte Rhyme säuerlich. »Musik.«
Rhyme war vom vierten Halswirbel abwärts gelähmt. Er konnte also ohne Probleme nicken. Er konnte auch mit den Schultern zucken, allerdings nicht so schroff, wie er es manchmal gerne gewollt hätte. Ein weiterer Zirkustrick von ihm war es, den linken Ringfinger ein paar Millimeter hin und her zu bewegen. Das war seit ein paar Jahren sein gesamtes Repertoire an körperlichen Möglichkeiten. Eine Sonate für Violine zu komponieren stand erst einmal nicht auf seiner Liste.
»Er kann auch Spiele spielen«, setzte Thom seinen Lobgesang auf das neue Gerät fort.
»Ich hasse Spiele. Das interessiert mich nicht.«
Sellitto, der Rhyme an ein großes ungemachtes Bett erinnerte, stierte auf den Computer, schien aber nicht sonderlich beeindruckt zu sein. »Lincoln«, begann er ernst. »Da ist so’n Fall für die Sondereinheit. Das heißt wir und die Jungs vom FBI. Sind da letzte Nacht auf ein Problem gestoßen.«
»Ein echtes Problem«, erlaubte sich Banks hinzuzufügen.
»Wir dachten… nun, ich dachte, du könntest uns vielleicht dabei helfen.«
Denen helfen?
»Ich arbeite gerade an etwas«, sagte Rhyme abwehrend. »Für Perkins, um es genau zu sagen.« Thomas Perkins war der Einsatzleiter des FBI-Büros in Manhattan. »Einer von Fred Dellrays Agenten wird vermißt.«
Sonderagent Fred Dellray war ein langjähriger Mitarbeiter des FBI und steuerte die meisten Undercover-Agenten im Bereich Manhattan. Dellray selbst war zu seiner Zeit einer der besten Undercover-Agenten des FBI gewesen. Er hatte für seine Erfolge bei der Infiltrierung – vom Hauptquartier der Drogenbosse in Harlem bis zu militanten Schwarzen-Organisationen – vom Direktor persönlich zahlreiche Belobigungen erhalten. Einer von Dellrays Agenten war nun seit ein paar Tagen verschwunden.
»Perkins hat uns davon erzählt«, sagte Banks. »Ziemlich abgedrehte Geschichte.«
Rhyme verdrehte die Augen, weil er Banks’ Ausdrucksweise unpassend fand. Allerdings mußte er zugeben, daß die Geschichte wirklich seltsam war. Der Agent war gegen 21.00 Uhr aus seinem Wagen verschwunden, den er gegenüber vom FBI-Büro im Herzen Manhattans geparkt hatte. Die Straßen waren zu diesem Zeitpunkt nicht gerade übervölkert, aber auch nicht völlig verlassen. Der Wagen, ein Crown Victoria des Büros, blieb mit laufendem Motor und offenen Türen zurück. Es gab kein Blut, keine Pulverreste einer Waffe, keine Kratzer, die auf einen Kampf hingedeutet hätten. Keine Zeugen – zumindest keine Zeugen, die bereit gewesen wären auszusagen.
Wirklich ziemlich abgedreht.
Perkins hatte eine ausgezeichnete Spurensicherungseinheit zu seiner Verfügung, einschließlich des FBI-eigenen Physical Evidence Response Teams PERT.
Aber es war Rhyme, der PERT aufgebaut hatte, und es war Rhyme, den Dellray angefordert hatte, um die Untersuchung des Tatorts auszuwerten. Die Beamtin der Spurensicherung, die mit Rhyme zusammenarbeitete, hatte Stunden mit Panellias Wagen verbracht und nicht einen einzigen verwertbaren Fingerabdruck entdeckt. Alles, was sie zurückbrachte, waren zehn Beutel mit wertlosen Spurenrückständen und – der einzige vielleicht nützliche Hinweis – einige Dutzend Körnchen von diesem seltsamen Sand.
Jene Körnchen, die jetzt so riesig und rund wie Himmelskörper auf seinem Computerschirm leuchteten.
Sellitto unterbrach seinen Gedankengang: »Lincoln, wenn du uns hilfst, wird Perkins jemand anderes auf den Panelli-Fall ansetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, daß dich diese Geschichte interessieren wird.«
Wieder diese besondere Betonung. Was hatte das alles zu bedeuten?
Rhyme und Sellitto hatten vor einigen Jahren bei mehreren großen Mordfällen zusammengearbeitet. Schwierige Fälle – Fälle von hohem öffentlichem Interesse. Er kannte Sellitto besser als die meisten anderen Polizisten. Rhyme wußte aber von sich, daß er Menschen nur schwer durchschauen konnte. Seine Ex-Frau Blaine hatte ihm in ihren hitzigen Debatten immer wieder vorgeworfen, daß Rhyme eine Patronenhülse in einem Kilometer Entfernung entdecken konnte, aber einen Menschen übersah, der direkt vor seiner Nase stand. Jetzt aber merkte er deutlich, daß Sellitto mit etwas hinter dem Berg hielt.
»Okay, Lon. Was ist los? Sag es mir.«
Sellitto gab Banks ein Zeichen.
»Phillip Hansen«, sagte der junge Polizist mit bedeutungsschwerer Stimme und hob dabei seine kümmerliche Augenbraue.
Rhyme kannte den Namen aus der Zeitung. Hansen war ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Tampa in Florida. Ihm gehörte in Armonk im Bundesstaat New York eine Großhandelsfirma. Die Firma war außergewöhnlich erfolgreich, und so war er zum Multimillionär geworden. Hansen hatte als Unternehmer ein sehr gutes Leben. Er brauchte nie nach Kunden Ausschau zu halten, brauchte für seine Firma nicht zu werben und hatte keine Probleme mit ausstehenden Rechnungen. Der einzige Haken an der Sache war, daß die Bundesregierung und der Staat New York viel Mühe darauf verwandten, PH Distributors Inc. dichtzumachen und den Firmenchef ins Gefängnis zu werfen. Das hing damit zusammen, daß Hansens Unternehmen nicht, wie er behauptete, gebrauchte Armeeausrüstung verkaufte, sondern Waffen – die meisten davon aus Armeebeständen gestohlen oder aus dem Ausland eingeschmuggelt. Anfang des Jahres waren zwei Soldaten getötet worden, als ihr Lastwagen, der mit einer Ladung Kleinfeuerwaffen nach New Jersey unterwegs war, in der Nähe der George Washington Brücke überfallen und entführt worden war. Dahinter steckte Hansen – eine Tatsache, die der New Yorker Oberstaatsanwalt und die US-Staatsanwaltschaft nur zu gut kannten, aber nicht beweisen konnten.
»Perkins und wir zimmern gerade einen Fall zusammen«, berichtete Sellitto. »Arbeiten mit der Kriminalabteilung der Army zusammen. Aber es ist eine Scheißarbeit.«
»Und es gibt niemanden, der ihn verpfeift«, ärgerte sich Banks. »Weit und breit niemanden.«
Rhyme vermutete, daß es wirklich niemand wagen würde, jemanden wie Hansen zu verraten. Der junge Detective fuhr fort: »Aber letzte Woche hatten wir endlich einen Durchbruch. Sie müssen wissen, Hansen hat einen Flugschein. Seine Firma besitzt Lagerhallen auf dem Mamaroneck Airport – das ist in der Nähe von White Plains. Ein Richter hat uns die Papiere ausgestellt, um sie mal unter die Lupe zu nehmen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Aber dann, letzte Woche an einem Abend so gegen Mitternacht: Der Flughafen ist geschlossen, aber ein paar Leute arbeiten noch. Sie sehen einen Mann, auf den Hansens Beschreibung paßt, wie er zu seinem Flugzeug fährt, ein paar große Sporttaschen reinwirft und losfliegt. Ohne Starterlaubnis, ohne Flugplan. Fliegt einfach los. Vierzig Minuten später kommt er zurück, landet, steigt in seinen Wagen und rast davon – ohne Sporttaschen. Die Zeugen geben die Registrierungsnummer an das Bundesluftfahrtamt FAA weiter. Und siehe da, es stellt sich heraus, daß es Hansens privater Jet ist, nicht der seiner Firma.«
Rhyme schlußfolgerte: »Also wußte er, daß ihr ihm auf die Pelle rückt, und deshalb wollte er etwas loswerden, das ihn mit den Morden in Verbindung bringt.« Er verstand allmählich, warum sie ihn dabeihaben wollten. Ein leichtes Interesse flackerte auf. »Konnte die Air Traffic Control seine Flugroute verfolgen?«
»La Guardia hatte ihn eine Zeitlang. Er flog geradewegs über den Long Island Sund. Dann ging er für zehn Minuten unter den Radarbereich runter.«
»Und ihr habt berechnet, wie weit über den Sund er kommen konnte. Sind Taucher draußen?«
»Klar. Und noch etwas. Wir wußten, daß Hansen ausflippen würde, sobald er erfährt, daß wir drei Zeugen haben. Deshalb haben wir dafür gesorgt, daß er bis Montag in ein Bundesgefängnis gesperrt wird.«
Rhyme lachte amüsiert. »Und ihr habt tatsächlich einen Richter soweit bekommen, einen hinreichenden Verdacht zu sehen?«
»Hm, mit dem Hinweis auf Fluchtgefahr«, grinste Sellitto. »Außerdem haben wir noch ein paar weitere Vergehen dazugeworfen, wie Verletzung der Luftfahrtregeln und fahrlässige Gefährdung. Kein Flugplan und Flug unterhalb der FAA-Mindesthöhe.«
»Was sagt denn unser Mister Hansen dazu?«
»Er beherrscht die Spielregeln perfekt. Kein Wort bei der Festnahme, kein Wort zum Staatsanwalt. Sein Anwalt bestreitet alles und bereitet eine Klage wegen widerrechtlicher Festnahme vor, bla, bla, bla… Wenn wir also die verdammten Taschen finden, dann gehen wir am Montag vor die Grand Jury und schwupp, weg ist er.«
»Vorausgesetzt«, warf Rhyme ein, »daß in den Taschen tatsächlich Belastungsmaterial ist.«
»Oh, da wird schon etwas drin sein.«
»Wie kannst du da so sicher sein?«
»Weil Hansen Schiß hat. Er hat jemanden angeheuert, um die Zeugen umzulegen. Einen hat er bereits erwischt. Hat letzte Nacht außerhalb von Chicago sein Flugzeug in die Luft gesprengt.«
Und nun wollen sie mich, um die Sporttaschen zu finden, dachte Rhyme. Faszinierende Gedanken schossen ihm durch den Kopf. War es möglich, die Position des Flugzeugs über dem Wasser aufgrund einer bestimmten Art von Niederschlag oder einer Salzablagerung zu bestimmen? Oder durch ein zerquetschtes Insekt an der Flügelkante? Konnte man den Todeszeitpunkt des Insekts feststellen? Und wie sähe es mit der Salzkonzentration und Verschmutzung des Wassers aus? Wenn eine Maschine so niedrig über dem Wasser fliegt, müßten die Düsentriebwerke und die Flügel doch eigentlich Algen aufwirbeln und sie gegen den Rumpf oder das Heck drücken?
»Ich brauche ein paar Karten des Sunds«, begann Rhyme. »Baupläne des Flugzeugs…«
»Ähm, Lincoln. Deshalb sind wir nicht hier«, unterbrach Sellitto.
»Nicht wegen der Taschen«, fügte Banks hinzu.
»Nicht? Weswegen denn dann?« Rhyme schüttelte eine besonders irritierende Strähne dunklen Haares aus seinem Gesicht und starrte den jungen Mann stirnrunzelnd an.
Sellittos Augen wanderten erneut zu der beigen Steuerungsbox, aus der sich rote, gelbe und schwarze Kabel über den Fußboden ringelten wie Schlangen, die ein Sonnenbad nahmen.
»Wir möchten, daß du uns hilfst, den Killer zu finden. Den Typen, den Hansen angeheuert hat. Wir müssen ihn stoppen, bevor er die beiden anderen Zeugen kriegt.«
»Und?« fragte Rhyme, der merkte, daß Sellitto immer noch mit etwas hinter dem Berg hielt.
Der Detective richtete seine Augen auf das Fenster und sagte schließlich: »Es sieht ganz danach aus, Lincoln, als ob es der Tänzer wäre.«
»Der Totentänzer?«
Sellitto sah Rhyme ins Gesicht und nickte.
»Bist du sicher?«
»Wir haben gehört, daß er vor ein paar Wochen einen Job in Washington erledigt hat. Hat einen Kongreßmitarbeiter umgelegt, der in Waffengeschäfte verwickelt war. Wir konnten ein paar Telefonate zurückverfolgen, die von einer Telefonzelle vor Hansens Haus mit dem Hotel geführt wurden, in dem der Tänzer wohnte. Er muß es sein, Lincoln.«
Die Sandkörner auf dem Bildschirm, die so groß wie Asteroiden und so sanft gerundet wie die Schultern einer Frau waren, verloren jeden Reiz für Rhyme.
»Nun«, sagte er leise, »da haben wir wirklich ein Problem, nicht wahr?«
3
Sie erinnerte sich.
Letzte Nacht. Das Läuten des Telefons, das das leise Trommeln des Regens gegen ihr Schlafzimmerfenster übertönt hatte.
Sie hatte es voller Abscheu angeschaut, als sei die Telefongesellschaft für ihre Übelkeit und den bohrenden Schmerz in ihrem Kopf verantwortlich, für das Blitzlichtgewitter hinter ihren Augenlidern.
Schließlich sprang sie auf und griff beim vierten Klingeln nach dem Hörer.
»Hallo?«
Es war nur ein Echo wie aus einer leeren Röhre zu hören – das typische Geräusch bei einem Funkgespräch, das zu einem Telefon durchgeschaltet wird.
Dann eine Stimme. Vielleicht.
Ein Lachen. Vielleicht.
Eine gewaltige Detonation. Ein Klicken. Stille.
Kein Freizeichen. Nur Stille, übertönt von den krachenden Wellen in ihren Ohren.
Hallo? Hallo?…
Sie legte den Hörer auf und ließ sich wieder auf ihre Couch fallen und beobachtete den abendlichen Regen und die Bäume, die im Frühlingssturm hin- und herwogten. Sie war wieder eingeschlafen. Bis das Telefon eine halbe Stunde später erneut klingelte und ihr die Nachricht übermittelte, daß Lear Neun Charlie Juliet beim Landeanflug abgestürzt war und ihren Mann und den jungen Tim Randolph in den Tod gerissen hatte.
Nun, an diesem grauen Morgen, wußte Percey Rachael Clay, daß der mysteriöse Anruf am Vorabend von ihrem Mann gekommen war. Ron Talbot – der den Mut aufgebracht hatte, sie anzurufen und ihr die Nachricht des Absturzes mitzuteilen – hatte ihr erklärt, daß er Eds Anruf genau im selben Augenblick durchgestellt hatte, als der Lear explodierte.
Eds Lachen…
Hallo? Hallo?…
Percey schraubte ihren Flachmann auf und nahm einen Schluck. Sie dachte an die stürmischen Tage vor vielen Jahren, als sie und Ed eine zum Wasserflugzeug umgebaute Cessna 180 nach Red Lake in Ontario geflogen hatten. Als sie aufsetzten, hatten sie noch genau 0,2 Liter Benzin im Tank. Sie hatten ihre glückliche Landung mit einer Flasche billigem Whisky gefeiert, der ihnen den schlimmsten Kater ihres Lebens beschert hatte. Die Erinnerung daran trieb ihr Tränen in die Augen – so wie damals der Kopfschmerz.
»Hör auf, Perce. Du hast genug davon, okay?« sagte der Mann, der auf der Wohnzimmercouch saß. »Bitte.« Er deutete auf den Flachmann.
»O ja«, antwortete sie mit zurückhaltendem Sarkasmus in der schweren Stimme. »Klar.« Und nahm einen weiteren Schluck. Hatte das Verlangen nach einer Zigarette, widerstand aber. »Warum, zum Teufel, hat er mich in letzter Sekunde angerufen?« fragte sie.
»Vielleicht hat er sich Sorgen um dich gemacht«, spekulierte Brit Hale. »Wegen deiner Migräne.«
Hale hatte in der vergangenen Nacht ebensowenig geschlafen wie Percey. Auch ihn hatte Talbot mit der Nachricht des Absturzes angerufen, und er war von seinem Appartement in Bronxville hergekommen, um bei Percey zu sein. Er war die ganze Nacht bei ihr geblieben und hatte ihr dabei geholfen, die vielen notwendigen Anrufe zu erledigen. Es war Hale, nicht Percey, der ihren Eltern in Richmond die Nachricht überbrachte.
»Er hatte keinen Grund dafür, Brit. Für einen Anruf in letzter Sekunde.«
»Das hatte nichts mit dem zu tun, was geschehen ist«, sagte Hale sanft.
»Ich weiß«, erwiderte sie.
Sie kannten sich seit Jahren. Hale war einer der ersten Piloten bei Hudson Air gewesen. Er hatte damals vier Monate lang unentgeltlich gearbeitet, dann waren seine Ersparnisse aufgebraucht, und er hatte Percey widerstrebend gebeten, ihm ein Gehalt zu zahlen. Er hatte nie erfahren, daß sie ihn aus ihrer eigenen Tasche bezahlte, da die Firma im ersten Jahr nach ihrer Gründung keinerlei Gewinn abwarf. Hale sah aus wie ein hagerer, strenger Schullehrer. In Wirklichkeit war er locker – der perfekte Gegenpol zu Percey – und ein Spaßvogel, der es schon mal fertigbrachte, besonders unangenehme und aufsässige Passagiere dadurch zu bändigen, daß er die Maschine drehte und kopfüber flog, bis sie sich beruhigt hatten. Hale übernahm oft den rechten Sitz, wenn Percey flog, und war ihr liebster Copilot. »Eine Ehre, mit Ihnen zu fliegen, Ma’am«, sagte er dann in seiner perfekten Elvis-Presley-Imitation. »Vielen Dank auch.«
Der bohrende Schmerz hinter ihren Augen war inzwischen fast verschwunden. Percey hatte bereits einige Freunde verloren – die meisten durch Abstürze –, und sie wußte, daß der seelische Schock physischen Schmerz wie eine Droge betäubte.
Dasselbe galt auch für Whisky.
Ein weiterer Schluck aus dem Flachmann. »Zum Teufel, Brit.« Sie warf sich neben ihn auf die Couch. »Oh, zum Teufel.«
Hale legte seinen starken Arm um sie. Sie lehnte ihren dunkel gelockten Kopf an seine Schulter. »Es wird alles gut werden, Baby«, murmelte er. »Versprochen. Kann ich was tun?«
Sie schüttelte den Kopf. Es war eine Frage, die keiner Antwort bedurfte.
Noch ein kleiner Schluck Bourbon, dann blickte sie auf die Uhr. Neun Uhr. Eds Mutter würde jeden Augenblick eintreffen. Freunde, Verwandte… Die Trauerfeier mußte geplant werden…
So viel zu tun…
»Ich muß Ron anrufen«, beschloß sie. »Wir müssen etwas unternehmen. Die Firma…«
Im Fluggeschäft hatte der Begriff »Firma« eine andere Bedeutung als in anderen Branchen. Die »Firma« war ein Wesen, ein lebendes Etwas. Das Wort wurde mit Ehrfurcht oder Frustration oder Stolz ausgesprochen. Manchmal auch mit Kummer. Eds Tod hatte im Leben von vielen eine Wunde hinterlassen, auch in dem der Firma. Und diese Wunde könnte durchaus tödlich sein.
So viel zu tun…
Aber Percey Clay, die Frau, die niemals in Panik geriet, die auch bei den gefährlichsten Loopings eiskalt blieb und Situationen überstanden hatte, in denen andere Piloten ins Trudeln geraten wären, saß nun wie gelähmt auf der Couch. Seltsam, dachte sie. Es fühlt sich an, als befände ich mich in einer anderen Dimension. Ich kann mich nicht bewegen.
Sie betrachtete ihre Hände und Füße, um festzustellen, ob sie womöglich schon knochenweiß und blutleer waren.
Oh, Ed…
Und natürlich dachte sie auch an Tim Randolph. Ein wirklich guter Copilot, und die waren dünn gesät. Sie rief sich sein junges, rundes Gesicht in Erinnerung – er war wie eine jüngere Ausgabe von Ed. Mit diesem grundlosen Grinsen. Aufgeweckt und gehorsam, aber entschlossen – gab klare und eindeutige Befehle, selbst an Percey, wenn er das Kommando im Flugzeug hatte.
»Du brauchst einen Kaffee«, unterbrach Hale ihre Gedanken und ging in die Küche. »Ich bringe dir einen doppelten Cappuccino mit Sahnehäubchen und extra Schokostreuseln.«
Das war einer ihrer Scherze – sich über dekadente Kaffeetrinker lustig zu machen. Echte Piloten tranken ihrer Meinung nach nur Klassiker wie Maxwell House oder Folgers-Kaffee.
Heute allerdings machte Hale – Gott segne ihn – keine Witze über kaffeetrinkende Softies – heute meinte er: Laß die Finger vom Suff. Percey verstand den Hinweis. Sie schraubte den Flachmann zu und ließ ihn mit einem lauten Klirren auf den Tisch fallen. »Okay, okay.« Sie stand auf und lief durchs Wohnzimmer. Ihr Blick fiel in den Spiegel, auf ihr Mopsgesicht. Schwarzes Haar in dichten, drahtigen Locken. (In ihrer qualvollen Jugend hatte sie sich einmal in einem Moment der Verzweiflung einen Bürstenschnitt verpassen lassen. Sie würde es ihnen schon zeigen. Doch diese Trotzreaktion, so verständlich sie auch war, brachte ihr nur noch mehr Spott ein. Sie lieferte den ach so charmanten jungen Damen an der Lee-Schule in Richmond neue Munition gegen sie.)
Percey war zierlich und hatte tiefschwarze, kugelrunde Augen – ihr größter Pluspunkt, wie ihre Mutter immer wieder betonte. Womit sie meinte, ihr einziger Pluspunkt. Und ein Pluspunkt, um den sich Männer einen Dreck scherten.
Heute lagen dunkle Ringe unter diesen Augen, und ihre Haut war fahl – Raucherhaut, erinnerte sie sich aus jener Zeit, als sie noch zwei Päckchen Marlboros am Tag geraucht hatte. Die Löcher in ihren Ohrläppchen waren schon lange zugewachsen.
Ein Blick aus dem Fenster, über die Bäume. Sie beobachtete den Verkehr vor ihrem Stadthaus, und etwas meldete sich aus ihrem Unterbewußtsein. Etwas Beunruhigendes.
Was? Was war es?
Das Gefühl verschwand, wurde verdrängt vom Klingeln an der Tür.
Percey machte auf und sah sich zwei stämmigen Polizisten gegenüber.
»Mrs. Clay?«
»Ja.«
»New York Police Department.« Dabei zeigten sie ihre Polizeimarken. »Wir sind hier, um auf Sie aufzupassen, bis wir wissen, was mit Ihrem Mann passiert ist.«
»Kommen Sie rein«, sagte sie. »Brit Hale ist auch hier.«
»Mr. Hale?« fragte einer der Polizisten und nickte dabei erfreut.
»Er ist hier? Gut. Wir hatten schon ein paar Polizisten aus Westchester County zu seinem Haus geschickt.«
Ihr Blick wanderte an einem der Polizisten vorbei auf die Straße, und im selben Augenblick meldete sich wieder dieser beunruhigende Gedanke.
Sie trat an den Polizisten vorbei auf den Treppenabsatz vor der Haustür.
»Es wäre uns lieber, wenn Sie im Haus blieben, Mrs. Clay…«
Sie starrte auf die Straße. Was war es nur?
Dann fiel es ihr ein.
»Da ist vielleicht noch etwas«, sagte sie zu den Beamten. »Ein schwarzer Lieferwagen.«
»Ein…«
»Ein schwarzer Wagen. Da war dieser schwarze Lieferwagen.«
Einer der Polizisten zückte seinen Notizblock. »Erzählen Sie.«
»Moment mal«, sagte Rhyme.
Lon Sellitto unterbrach seine Ausführungen.
Rhyme hörte, daß sich wieder Schritte näherten. Sie waren weder schwer noch leicht. Er wußte, von wem sie stammten. Dazu waren keinerlei Anstrengungen nötig. Er hatte diese Schritte einfach schon oft gehört.
Das schöne Gesicht von Amelia Sachs, eingerahmt von ihrem langen, roten Haar, erschien auf der Treppe. Rhyme sah, wie sie kurz innehielt, dann ihren Weg fortsetzte. Sie trug die marineblaue Uniform der New Yorker Polizei, komplett bis auf Krawatte und Mütze. In einer Hand schwenkte sie eine Einkaufstasche vom Jefferson Market.
Jerry Banks lächelte sie verzückt an. Seine Verliebtheit war anrührend, sehr offensichtlich, aber auch ziemlich verständlich – welche Streifenpolizisten hatten schon eine Karriere als Model in der Madison Avenue hinter sich – wohl nur die hochgewachsene Amelia Sachs. Aber sein Anhimmeln wurde nicht erwidert, und der junge Mann, der trotz seiner schlechten Rasur und seiner wilden Tolle gut aussah, war sich offenbar klar darüber, daß er so schnell nicht zum Zuge kommen würde.
»Hi, Jerry«, nickte sie. Sellitto begrüßte sie mit einem respektvollen »Sir«. (Er war Detective Lieutenant und so etwas wie eine Legende in der Mordkommission. Sachs, die Polizistengene in ihrem Blut hatte, war von klein auf zu Hause und später auf der Polizeiakademie eingebleut worden, erfahreneren Kollegen Respekt entgegenzubringen.)
»Sie sehen müde aus«, stellte Sellitto fest.
»Hab nicht geschlafen. Hab nach Sand gesucht«, erwiderte sie und zog ein Dutzend Plastikbeutel aus der Einkaufstasche. »Ich habe Vergleichsproben gesammelt.«
»Gut«, sagte Rhyme. »Aber das ist nun Schnee von gestern. Wir sind auf einen neuen Fall angesetzt worden.«
»Auf einen neuen Fall?«
»Jemand ganz Bestimmtes ist in die Stadt gekommen. Und wir müssen ihn fangen.«
»Wer?«
»Ein Killer«, antwortete Sellitto.
»Ein Profi?« hakte Sachs nach. »Mafia?«
»Ein Profi, ja, das kann man wohl sagen«, antwortete Rhyme. »Aber soweit wir wissen, hat er keine Verbindung zur organisierten Kriminalität.« Die meisten angeheuerten Killer im Lande arbeiteten im Auftrag der Mafia.
»Er ist so eine Art selbständiger Unternehmer«, fuhr Rhyme fort. »Wir nennen ihn den Totentänzer.«
Sie hob eine Augenbraue, unter der rötliche Kratzspuren zu sehen waren. »Warum?«
»Nur eines seiner Opfer lebte lange genug, um uns eine Beschreibung liefern zu können. Demnach hat er – oder zumindest hatte er – eine Tätowierung auf seinem Oberarm: der Sensenmann, der vor einem Sarg mit einer Frau tanzt.«
»Nun, das ist ja zumindest mal etwas für die Rubrik ›Besondere Kennzeichen‹«, kommentierte sie trocken. »Was wissen Sie noch über ihn?«
»Ein Weißer, vermutlich Mitte Dreißig. Das ist alles.«
»Sie sind der Tätowierung nachgegangen?« fragte Sachs.
»Natürlich«, erwiderte Rhyme schmallippig. »Bis ans Ende der Welt.« Er meinte das wortwörtlich. Jede Polizeistation in jeder größeren Stadt auf der Erde hatte nachgeforscht, ohne daß auch nur der geringste Hinweis auf eine solche Tätowierung gefunden wurde.
»Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren«, unterbrach Thom. »Zeit für ein paar Erledigungen.« Das Gespräch verstummte, während Thom seinen Chef mit geübten Bewegungen hin- und herdrehte. Dies diente dazu, seine Lungen frei zu bekommen. Querschnittsgelähmte entwickeln persönliche Beziehungen zu bestimmten Teilen ihres Körpers. Nachdem er sich seine Wirbelsäule vor einigen Jahren während der Untersuchung eines Tatorts verletzt hatte, waren seine Arme und Beine für Rhyme zu grausamen Feinden geworden. Er hatte ungeheure Energie darauf verwandt, sie dazu zu zwingen, ihm wieder zu Willen zu sein. Doch sie hatten den Kampf mühelos gewonnen und waren bewegungslos wie ein Stück Holz geblieben. Als nächstes hatte er gegen die spastischen Anfälle angekämpft, die seinen Körper erbarmungslos schüttelten. Er versuchte, ihnen mit schierer Willenskraft Einhalt zu gebieten. Nach und nach hatten sie dann aufgehört, offenbar ganz von selbst. Rhyme konnte den Sieg nicht für sich beanspruchen, aber er verbuchte ihre Niederlage. Dann wandte er sich kleineren Herausforderungen zu und nahm den Kampf gegen seine Lungen auf. Nach einem Jahr in der Rehaklinik hatte er es geschafft, sich von der künstlichen Beatmung zu befreien. Der Beatmungstubus wurde wieder aus seiner Luftröhre entfernt, und er konnte wieder selbst atmen. Das war sein einziger Erfolg im Kampf gegen seinen Körper, und er hegte den dunklen Verdacht, daß seine Lungen nur auf einen geeigneten Zeitpunkt warteten, es ihm heimzuzahlen. Er rechnete damit, daß er in einem oder zwei Jahren an einer Lungenentzündung oder einem Emphysem sterben würde.
Lincoln Rhyme hatte nicht unbedingt etwas dagegen einzuwenden zu sterben. Aber es gab so viele Todesarten. Er war fest entschlossen, daß sein Tod nicht unangenehm sein würde.
Sachs fragte: »Gibt es irgendwelche Hinweise? Letzte bekannte Adresse?«
»Hat sich zuletzt in der Gegend von Washington D.C. aufgehalten«, sagte Sellitto in seinem gedehnten Brooklyner Akzent. »Das ist alles. Sonst nichts. Oh, wir werden sicher bald von ihm hören. Dellray mit seinen ganzen Spitzeln und Informanten vermutlich als erster. Der Tänzer ist wie zehn verschiedene Menschen in einer Person. Operationen an den Ohren, Silikonimplantate im Gesicht. Mal fügt er sich Narben zu, mal läßt er sie entfernen. Mal nimmt er zu, mal nimmt er ab. Einmal hat er einen Leichnam abgehäutet – nahm die Haut der Hände und trug sie wie Handschuhe, um die Spurensicherung reinzulegen.«
»Mich konnte er allerdings nicht täuschen«, unterbrach Rhyme. »Ich hab mich nicht ins Boxhorn jagen lassen.«
Allerdings habe auch ich ihn nicht erwischt, dachte er voller Bitterkeit.
»Er plant alles bis ins kleinste Detail«, fuhr der Detective fort. »Inszeniert ein Ablenkungsmanöver und schlägt dann zu. Anschließend macht er den Tatort verdammt effizient sauber.« Sellitto unterbrach sich. Für einen Mann, der sein Leben der Jagd nach Mördern gewidmet hat, wirkte er plötzlich erstaunlich beunruhigt.
Rhyme ging nicht auf das plötzliche Verstummen seines ehemaligen Partners ein. Die Augen auf das Fenster gerichtet, setzte er den Bericht fort. »Die Sache mit den gehäuteten Händen, das war der letzte Job des Tänzers hier in New York. Ist fünf, sechs Jahre her. Er war von einem Investment-Banker an der Wall Street angeheuert worden, dessen Partner umzulegen. Erledigte den Job gut und sauber. Mein Spurensicherungsteam traf am Tatort ein und suchte ihn ab. Einer von ihnen zog ein zusammengeknülltes Blatt Papier aus dem Mülleimer. Das setzte eine Ladung PETN frei. Etwa 225 Gramm. Beide Mitarbeiter waren tot und praktisch jede eventuelle Spur vernichtet.«
»Tut mir leid, das zu hören«, murmelte Sachs. Es entstand ein unbehagliches Schweigen. Sie war seit über einem Jahr seine Schülerin und Mitarbeiterin – und in dieser Zeit waren sie auch Freunde geworden. Sie hatte sogar manchmal hier übernachtet. Hatte auf der Couch geschlafen oder keusch wie eine Schwester neben Rhyme in seinem fünfhundert Kilogramm schweren Clinitron-Bett gelegen. Aber ihre Gespräche drehten sich vor allem um kriminalistische Themen. Rhyme erzählte ihr vor dem Einschlafen Geschichten, wie er Serienmörder oder geniale Fassadenkletterer geschnappt hatte. Über persönliche Dinge zu sprechen vermieden sie meist peinlich. Auch jetzt sagte sie lediglich: »Das muß sehr schwer für Sie gewesen sein.«
Rhyme schob ihre versteckte Beileidsbekundung mit einer Kopfbewegung beiseite. Er starrte auf die leere Wand. Vor einiger Zeit hatten an den Wänden Kunstposter gehangen. Sie waren schon lange verschwunden, aber sein Geist verband die verbliebenen Klebstoffreste mit imaginären Strichen zu einem schiefen Stern. Rhyme mußte sich wieder an die schreckliche Szene der Explosion in der Wall Street erinnern, er sah die verkohlten, zerfetzten Leichen seiner Mitarbeiter vor sich. Eine große Leere und Verzweiflung breitete sich in ihm aus.
Sachs unterbrach seine düsteren Gedanken. »Der Typ, der den Tänzer damals angeheuert hatte, war der bereit auszusagen?«
»Klar war er bereit. Aber da gab es nicht viel, was er erzählen konnte. Er hinterlegte das Geld und die schriftlichen Instruktionen in einem toten Briefkasten. Kein elektronischer Transfer, keine Kontonummer. Sie haben sich nie persönlich getroffen.« Rhyme holte tief Luft. »Das Schlimmste war, daß der Auftraggeber zwischenzeitlich seine Meinung geändert hatte. Er verlor die Nerven. Aber er hatte keine Möglichkeit, mit dem Tänzer Kontakt aufzunehmen. Er hätte ohnehin nichts mehr ausrichten können. Der Tänzer hatte ihm von vornherein gesagt: ›Mich kann man nicht zurückpfeifen.‹«
Sellitto informierte Sachs über den Hansen-Fall, über die Zeugen, die den mitternächtlichen Ausflug mit seiner Maschine gesehen hatten, und über die Bombe in der vergangenen Nacht.
»Wer sind die anderen Zeugen?« fragte sie.
»Percey Clay, die Frau dieses Carneys, der in dem Flugzeug getötet wurde. Sie ist Chefin der Firma Hudson Air Charters. Ihr Mann war der Vize. Der andere Zeuge ist Britton Hale. Er arbeitet als Pilot bei ihr. Ich habe Babysitter losgeschickt, die auf beide achten.«
Banks verkündete: »Ich habe Mel Cooper hinzugezogen. Er wird unten im Labor arbeiten. Für den Hansen-Fall ist ein Sonderdezernat gebildet worden. Deshalb haben wir Fred Dellray als Vertreter des FBI dazu bekommen. Er stellt uns bei Bedarf Agenten zur Verfügung und besorgt uns für die Clay und Hale eines der sicheren Häuser vom Zeugenschutzprogramm der US-Marshals.«
Lincoln Rhymes so ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen funkte dazwischen und drängte mit Macht alle anderen Gedanken zur Seite. Er hörte nicht mehr, was der Detective sagte. In seinem Kopf liefen wieder die Bilder aus dem Büro ab, in dem der Tänzer die Bombe versteckt hatte.
Auch nach fünf Jahren war alles noch haarscharf da: Der zerfetzte Mülleimer, der wie eine schwarze Rose klaffte. Der Geruch des Sprengstoffs – ein erstickender chemischer Gestank, so ganz anders als der Rauchgeruch von Holzfeuer. Das seidige Glänzen des versengten Holzes, wie Krokodilhaut. Die verbrannten Körper seiner Techniker. Durch die Hitze der Flammen waren sie in eine Art Embryonalstellung zusammengezogen worden.
Das Summen des Fax-Apparats erlöste ihn von seinem Horrortrip in die Vergangenheit. Jerry Banks schnappte sich das erste Blatt. »Der Untersuchungsbericht vom Absturzort«, verkündete er.
Rhyme wandte seinen Kopf voller Eifer dem Faxgerät zu. »An die Arbeit, meine Damen und Herren!«
Wasch sie. Wasch sie richtig gründlich.
Soldat, sind diese Hände sauber?
Sir, gleich sind sie richtig sauber, Sir.
Der kräftig gebaute, etwa fünfunddreißigjährige Mann stand in der Toilette eines Cafés in der Lexington Avenue und war ganz in seine Aufgabe versunken.
Schrubb, schrubb, schrubb…
Er hielt kurz inne und warf einen Blick aus der Tür der Männertoilette. Niemand schien sich dafür zu interessieren, daß er seit fast zehn Minuten hier drin war.
Zurück zum Schrubben.
Stephen Kall untersuchte seine Nagelhäutchen und seine kräftigen, schon geröteten Fingerknöchel.
Sehen sauber aus, sehen ganz sauber aus. Keine Würmer. Nicht ein einziger.
Er hatte sich gut gefühlt, als er den schwarzen Lieferwagen ganz nach hinten in eine Tiefgarage fuhr. Stephen hatte die Ausrüstung, die er benötigte, aus dem Wagen genommen, war die Rampe hinaufgelaufen und hatte sich auf der geschäftigen Straße unter die Menge gemischt. Er hatte bereits mehrfach in New York gearbeitet, konnte sich aber einfach nicht an die vielen Menschen gewöhnen. Allein in diesem Block waren es mindestens tausend Menschen.
Machen mich ganz kribbelig.
Wurmig, fühle mich, als wäre ich voller Würmer.
Und deshalb war er hier in der Toilette gekommen, um sich ein wenig abzuschrubben.
Soldat, bist du damit immer noch nicht fertig? Du hast noch zwei Zielpersonen zu eliminieren.
Sir, bin fast fertig, Sir. Muß dafür sorgen, daß nicht die kleinste Spur hinterlassen werden kann, bevor ich mit der Operation fortfahre, Sir.
Oh, um Gottes willen…
Das heiße Wasser lief über seine Haut. Er schrubbte sich die Hände mit einer Bürste, die er in einem verschließbaren Plastikbeutel bei sich trug. Drückte erneut auf den Seifenspender und ließ das rosafarbene Gel in seine Handflächen träufeln.
Und schrubbte weiter.
Schließlich prüfte er noch einmal seine geröteten Hände und trocknete sie unter dem Heißluftstrom. Keine Handtücher, keine verräterischen Faserrückstände.
Auch keine Würmer.
Stephen trug an diesem Tag Tarnkleidung, allerdings keine olivfarbene Armeeuniform und auch nicht das Beige der Operation Wüstensturm. Seine Tarnung bestand aus Jeans, Reebok-Turnschuhen, einem Arbeitshemd und einer grauen Windjacke mit ein paar Farbspritzern darauf. An seinem Gürtel baumelten ein Mobil-Telefon und ein großes Metermaß. Er sah aus wie ein typischer Handwerker. Er trug diese Verkleidung deshalb, weil sich niemand in Manhattan darüber wundern würde, daß ein Arbeiter an einem so schönen Frühlingstag Baumwollhandschuhe trug.
Wieder draußen.
Immer noch viele Menschen. Aber seine Hände waren jetzt sauber, und er fühlte sich nicht mehr so kribbelig.
Er blieb an der Ecke stehen und blickte die Straße hinunter zu dem Gebäude, das einst das Haus des Ehemannes und seiner Ehefrau gewesen war. Jetzt war es nur noch das Haus der Ehefrau, denn ihr Ehemann war über der Heimat Lincolns in Millionen kleiner Teile zerfetzt worden.
Zwei Zeugen waren also noch am Leben, und sie sollten beide am Montag, wenn die Grand Jury zusammentrat, tot sein. Er blickte auf seine klobige Armbanduhr. Es war 9.30 Uhr am Samstag morgen.
Soldat, ist da genug Zeit, um sie beide zu erwischen?
Sir, ich kriege sie jetzt vielleicht nicht beide, aber ich habe noch fast achtundvierzig Stunden, Sir. Das ist mehr als genügend Zeit, um beide Ziele zu lokalisieren und zu neutralisieren, Sir.
Soldat, du hast doch nicht etwa Angst vor Herausforderungen?
Sir, ich liebe Herausforderungen, Sir.
Vor dem Haus war ein einzelner Polizeiwagen geparkt. Das hatte er erwartet.
Also gut, wir haben eine bereits ausgekundschaftete Todeszone vor dem Haus und eine noch unbekannte innen…
Seine geschrubbten Hände brannten. Er blickte die Straße in beide Richtungen entlang und ging dann los. Der Rucksack wog fast dreißig Kilogramm, aber er spürte die Last kaum. Stephen war ein wandelndes Muskelpaket mit militärischem Haarschnitt.
Während er sich dem Haus näherte, stellte er sich vor, er würde hier wohnen. Anonym. Er dachte an sich nicht als Stephen oder Mr. Kall oder Todd Johnson oder Stan Bledsoe oder die Dutzende anderer Namen, die er in den vergangenen zehn Jahren benutzt hatte. Sein wirklicher Name war wie ein rostiges Fahrrad, das im Hinterhof steht – etwas, dessen man sich zwar bewußt ist, das man aber kaum noch wahrnimmt.
Mit einer raschen Bewegung verschwand er plötzlich im Eingang des Hauses, das genau gegenüber dem Haus der Ehefrau stand. Stephen drückte die Eingangstür auf und sah zu den großen Glasfenstern auf der anderen Straßenseite hinüber, die teilweise durch einen blühenden Baum verdeckt wurden. Er setzte eine teure, gelblich getönte Schießbrille auf, und die Reflexionen im Fenster verschwanden. Jetzt konnte er im Haus schemenhafte Figuren erkennen. Ein Bulle… nein, zwei Bullen. Ein Mann, der mit dem Rücken zum Fenster stand. Vielleicht war das der Freund, der andere Zeuge, den er umbringen sollte. Und… ja, da war die Ehefrau. Klein. Hausbacken. Jungenhaft. Sie trug eine weiße Bluse, die ein gutes Ziel abgab.
Sie machte ein paar Schritte und verschwand aus seinem Blickfeld.
Stephen bückte sich und öffnete seinen Rucksack.
4
Thom setzte ihn in den Storm Arrow Rollstuhl.
Dann übernahm Rhyme das Kommando. Er nahm den strohhalmdicken Schlauch in den Mund und dirigierte so den Rollstuhl pustend und saugend zu dem kleinen Fahrstuhl in der ehemaligen Toilette, der ihn direkt und ohne Umstände ins Erdgeschoß brachte.
Als das Haus vor hundert Jahren gebaut worden war, war der Raum, in den Lincoln Rhyme nun hinein rollte, der Salon gewesen. Kostbarer Stuck, Rosetten an der Decke, in die Wand eingelassene Nischen für Ikonen und auf dem Fußboden feinste Eichendielen, so sorgfältig dicht an dicht verlegt und versiegelt, daß die Fugen nicht zu sehen waren. Angesichts von Rhymes baulichen Veränderungen hätte aber vermutlich jeder Architekt einen Anfall bekommen. Er hatte die Wand zwischen Salon und Speisezimmer einreißen und in die verbliebenen Wände große Löcher bohren lassen, die für die zusätzlichen Stromkabel notwendig geworden waren. Die so verbundenen Zimmer waren nun nicht mehr mit erlesenen Tiffany-Lampen oder stimmungsvollen Landschaftsbildern von George Inness geschmückt, sondern boten ganz andere Kunstwerke dar: Röhren mit Dichtegradienten, Computer, hochauflösende Mikroskope, Gaschromatographen, Massenspektrometer, eine PoliLight-Lampe und Ninhydrin-Tauchbecken zum Aufspüren von Fingerabdrücken. In einer Ecke thronte ein extrem teures Rasterelektronenmikroskop, das mit einem energiedispersiven Röntgenanalysegerät verbunden war. Dort lagen und standen auch einige andere alltägliche Ausrüstungsgegenstände des modernen Kriminalisten: Brillen, schnittresistente Latexhandschuhe, Bechergläser, Schraubenzieher und Zangen, Postmortem-Fingerlöffel, Skalpelle, Mundspatel, Tupfer, Becher, Plastikbeutel, Untersuchungstabletts, Untersuchungsproben. Ein Dutzend Eßstäbchen (Rhyme hatte seinen Assistenten eingebleut, Beweismaterial genauso aufzusammeln, wie sie ihr Chop Suey bei Ming Wang an der Ecke aßen.).
Rhyme steuerte den schnittigen, apfelroten Storm Arrow zum Arbeitstisch. Thom streifte ihm das Mikrofon über den Kopf und schaltete den Computer ein.
Kurz darauf erschienen Sellitto und Banks. Sie wurden von einem weiteren Mann begleitet, der gerade eingetroffen war. Er war großgewachsen, schlaksig und schwarz wie Ebenholz. Bekleidet war er mit einem grünen Anzug und einem Hemd von geradezu außerirdischem Gelb.
»Hallo, Fred.«
»Lincoln.«
»Hey.« Sachs nickte ihm kurz zu, als sie den Raum betrat. Sie hatte ihm verziehen, daß er sie vor nicht allzu langer Zeit verhaftet hatte – eine Kompetenz-Kabbelei zwischen den verschiedenen Abteilungen. Inzwischen hatten die hochgewachsene, schöne Polizistin und der gerissene Polizist eine eigenartige Zuneigung füreinander entwickelt. Nach Rhymes Einschätzung gehörten sie beide zu jenem Polizistentyp, der auf Menschen fixiert ist (wohingegen er sich selbst als Beweismittel-Typ einstufte). Dellray vertraute gerichtsmedizinischen Untersuchungen ebensowenig, wie Rhyme Zeugenaussagen Glauben schenkte. Was die ehemalige Streifenpolizistin Sachs anging, nun, sie hatte ihre natürlichen Neigungen, gegen die er nichts tun konnte, aber Rhyme war entschlossen, aus ihr die beste Kriminalistin New Yorks zu machen, wenn nicht sogar des ganzen Staates. Ein Ziel, das durchaus in ihrer Reichweite lag, auch wenn sie es vielleicht selbst nicht wußte.
Dellray schritt durch den Raum, stellte sich neben das Fenster und verschränkte seine mageren Arme. Niemand – auch Rhyme nicht – konnte den Beamten ganz genau einschätzen. Er lebte allein in einem kleinen Appartement in Brooklyn, liebte Literatur und Philosophie und liebte es noch mehr, in schummrigen Bars Billard zu spielen. Einst war er die Spitze unter den Undercover-Agenten des FBI gewesen, und noch heute tauchte in Gesprächen gelegentlich sein Spitzname aus jener Zeit auf: »Das Chamäleon« – eine ehrfürchtige Anspielung auf seine unglaubliche Fähigkeit, sich in jede Undercover-Rolle einzuleben. Auf sein Konto gingen mindestens tausend Festnahmen. Aber er hatte zu lange in diesem Bereich verbracht und war daher »überfällig« geworden – wie das FBI es nannte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihn ein Bandenboß oder Dealer erkennen und umbringen würde. Deshalb hatte er schließlich widerstrebend einen Verwaltungsjob angenommen, der darin bestand, daß er andere Undercover-Agenten und Informanten führte.
»Also, meine Jungs sagen mir, wir haben es mit dem Tänzer persönlich zu tun«, nuschelte der Agent. Seine Sprechweise war nicht so sehr typisch schwarz als vielmehr, nun… typisch Dellray. Wie sein Leben so waren auch seine Grammatik und sein Vokabular zum großen Teil improvisiert.
»Gibt’s irgendwas Neues von Tony?« fragte Rhyme.
»Von meinem verschwundenen Jungen?« Dellrays Gesicht verzerrte sich vor Wut. »Nee, nichts.«
Tony Panelli, der Beamte, der vor einigen Tagen vor dem FBI-Büro verschwunden war, hatte eine Frau und ein Haus hinterlassen. Abgesehen davon blieben von ihm nur ein grauer Ford mit laufendem Motor und ein paar Körner eines aufreizend geheimnisvollen Sandes – jene sanft gerundeten Asteroiden, die Antworten versprochen, aber bisher nicht gegeben hatten.
»Sobald wir den Tänzer geschnappt haben, machen Amelia und ich damit weiter. Rund um die Uhr«, versprach Rhyme.
Dellray klopfte zornig gegen das Ende einer Zigarette, die er hinter sein linkes Ohr geklemmt hatte. »Der Tänzer… Mist. Diesmal müßt ihr das Arschloch wirklich kriegen.«
»Was ist mit dem Mord letzte Nacht?« fragte Sachs. »Habt ihr irgendwelche Hinweise?«
Sellitto wühlte in einem Stapel aus Faxen und seinen handschriftlichen Notizen. Er sah auf. »Ed Carney startete gestern abend um 18.18 Uhr vom Mamaroneck-Flughafen. Die Firma – Hudson Air – ist eine private Chartergesellschaft. Sie fliegen Fracht, Firmenkunden, alles eben. Leasen Flugzeuge. Sie haben gerade einen neuen großen Auftrag bekommen. Sie fliegen – das ist echt heiß – Körperteile durch die Gegend, die für Transplantationen bestimmt sind. Hudson Air bringt diese Organe in Krankenhäuser im ganzen Mittleren Westen und an der Ostküste. Hab gehört, daß so was heutzutage ein knallharter Wettbewerb ist.«
»Also ein richtiger Halsabschneider-Job«, scherzte Banks, war aber der einzige, der darüber lächeln konnte.
Sellitto setzte seine Ausführungen fort. »Der Kunde ist U.S. Medical and Healthcare mit Sitz in Somers. Eine dieser kommerziellen Krankenhausketten. Carney hatte einen ganz schön engen Zeitplan. Sollte nach Chicago fliegen, dann Saint Louis, Memphis, Lexington, Cleveland, zuletzt ein Stopp in Erie in Pennsylvania. Heute früh sollte er zurückkommen.«
»Irgendwelche Passagiere?« fragte Rhyme.
»Jedenfalls keine vollständigen«, murmelte Sellitto. »Nur die Fracht. Nichts Ungewöhnliches an dem Flug. Dann, nur noch zehn Minuten von O’Hare entfernt, geht die Bombe hoch. Zerfetzt das Flugzeug in tausend Stücke. Tötet beide, Carney und seinen Copiloten. Vier weitere Personen wurden am Boden verletzt. Übrigens sollte seine Frau mit ihm fliegen, aber sie wurde krank und mußte im letzten Moment absagen.«
»Gibt’s einen Bericht der Flugsicherheitsbehörde?« erkundigte sich Rhyme. »Nein, natürlich nicht. Der kann noch nicht da sein.«
»Der Bericht wird erst in zwei, drei Tagen fertig.«
»Nun gut, wir können aber keine zwei, drei Tage warten«, schimpfte Rhyme lautstark. »Ich brauche ihn jetzt!«
Auf seinem Hals war noch immer die rosafarbene Narbe von dem Beatmungstubus zu erkennen. Aber Rhyme hatte sich von der künstlichen Lunge freigekämpft und konnte nun wie ein Weltmeister atmen. Lincoln Rhyme war zwar vom vierten Halswirbel abwärts querschnittsgelähmt, er konnte aber seufzen, husten und fluchen wie ein Seemann. »Ich muß alles über diese Bombe wissen.«
»Ich rufe ’nen Kumpel in Chicago an. Der schuldet mir noch ’nen dicken Gefallen«, versprach Dellray. »Wenn ich ihm sage, worum es geht, wird er mir alles schicken, was sie haben, und zwar presto presto.«
Rhyme nickte zustimmend und dachte dann noch einmal über das nach, was Sellitto geschildert hatte. »Okay, wir haben also zwei Tatorte. Die Absturzstelle in Chicago. Das ist nichts für Sie, Sachs. Vollkommen verunreinigt. Wir können nur hoffen, daß die Jungs in Chicago einen halbwegs ordentlichen Job machen. Der andere Tatort ist der Flughafen in Mamoroneck, wo der Tänzer die Bombe installiert hat.«
»Woher wissen wir, daß er das am Flughafen gemacht hat?« fragte Sachs und drehte ihr leuchtendrotes Haar zu einem festen Knoten zusammen. So eine prächtige Mähne war an einem Tatort ein Risiko; damit konnten die Beweisstücke verunreinigt werden. Sachs war bei ihrem Job immer mit einer Neunmillimeter Glock und einem Dutzend Haarnadeln bewaffnet.
»Gute Frage, Sachs«, lobte Rhyme. Er schätzte es, wenn sie ihn herausforderte. »Wir wissen es nicht, und wir werden es auch erst wissen, wenn wir herausgefunden haben, wo die Bombe versteckt war. Sie kann überall gewesen sein: im Frachtraum, in einem Koffer oder in einer Thermoskanne.«
Oder in einem Mülleimer, dachte er bitter und war wieder bei der Bombe in der Wall Street.
»Ich will jedes noch so kleine Teil der Bombe so schnell wie möglich hier haben. Wir müssen alles untersuchen«, verlangte Rhyme.
»Nun, Linc«, wandte Sellitto betont langsam ein. »Das Flugzeug flog eine Meile über der Erde, als es explodierte. Die Wrackteile sind über einen verdammt großen Bereich verstreut.«
»Das ist mir egal«, antwortete Rhyme, dessen Halsmuskeln schmerzten. »Läuft die Suche noch?«
Normalerweise untersuchen örtliche Bergungsmannschaften Absturzstellen, aber dies war eine Ermittlung der Bundesbehörden. Deshalb griff Dellray zum Telefon und ließ sich zu dem FBI-Agenten vor Ort durchstellen.
»Sag ihnen, daß wir jedes Stück des Wracks brauchen, an dem sich auch nur die geringste Spur Sprengstoff nachweisen läßt. Ich spreche hier von Nanogramm. Ich will diese Bombe.«
Dellray übermittelte Rhymes Wunsch. Dann blickte er auf, schüttelte den Kopf. »Der Tatort ist freigegeben.«
»Was?« brüllte Rhyme. »Nach zwölf Stunden? Das ist lächerlich. Unentschuldbar!«
»Sie mußten die Straßen wieder freimachen. Er sagt –«
»Die Feuerwehrwagen!« rief Rhyme.
»Was?«
»Jeder Feuerwehrwagen, jeder Krankenwagen, jeder Polizeiwagen… jeder Unfallwagen, der am Absturzort war. Ich will, daß alle Reifen ausgekratzt werden.«
Dellrays langes, rabenschwarzes Gesicht erstarrte. »Würdest du das bitte wiederholen? Für meinen ehemaligen guten Freund hier?« Der Beamte hielt ihm das Telefon hin.