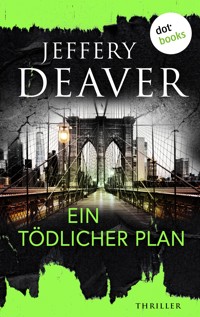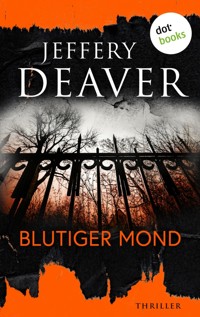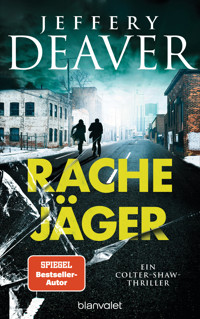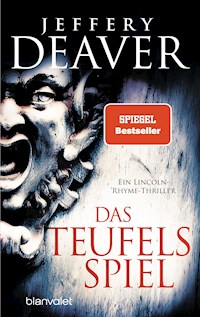
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der 6. Fall für das Ermitterduo Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
Frühmorgens in einer New Yorker Bibliothek: Beinahe zu spät bemerkt die sechzehnjährige Geneva Settle den unheimlichen Fremden, der sie mit Mordlust in den Augen beobachtet. Die Schülerin aus Harlem kann ihrem Angreifer nur knapp entkommen. Die Spuren, die Lincoln Rhyme und Amelia Sachs am Tatort entdecken, deuten zunächst auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Doch Rhyme ist überzeugt: Das junge Mädchen ist in das Visier eines gerissenen Profikillers geraten – dessen Motive weit in die Vergangenheit reichen. Und tatsächlich geht das Teufelsspiel schon bald in seine zweite, tödliche Runde …
Entdecken Sie die unabhängig voneinander lesbaren Bände der Lincoln-Rhyme-Reihe bei Blanvalet!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Frühmorgens in einer New Yorker Bibliothek: Beinahe zu spät bemerkt die sechzehnjährige Geneva Settle den unheimlichen Fremden – in den Augen des Mannes steht die nackte Mordlust! Nur mit einem Trick kann die Schülerin aus Harlem ihrem Angreifer entkommen … Die Spuren, die Lincoln Rhyme und Amelia Sachs am Tatort entdecken, deuten zunächst auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Doch Ryhme ist überzeugt: Das junge Mädchen ist in das Visier eines gerissenen Profikillers geraten – dessen Motive möglicherweise 140 Jahre alt sind. Und tatsächlich geht das Teufelsspiel schon bald in seine zweite, tödliche Runde …
Der Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm bereits zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht. Auch die Verfilmung seines Romans Der Knochenjäger (mit Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen) war weltweit ein sensationeller Kinoerfolg.
Jeffery Deaver
Das Teufelsspiel
Roman
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Twelfth Card« bei Simon & Schuster, Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Jeffery Deaver Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München. Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotiv: plainpicture/Andrea Späth UH · Herstellung: Heidrun Nawrot
Zum Gedenken an Christopher Reeve,seinen beispielhaften Mut,seine unerschütterliche Zuversicht
»Manche Leute sind deine Verwandten, andere hingegen deine Vorfahren, und du suchst dir aus, welche von ihnen du als Vorfahren haben möchtest. Aus diesen Werten erschaffst du dich selbst.«
– Ralph Ellison
ERSTER TEIL
Der Dreifünftelmann
Dienstag, 9. Oktober
… Eins
Sein Gesicht ist nass von Schweiß und Tränen. Der Mann befindet sich auf der Flucht, er rennt um sein Leben.
»Da! Da ist er!«
Der einstige Sklave kann nicht genau ausmachen, woher die Stimme kommt. Von irgendwo hinter ihm? Von rechts oder links? Vom Dach eines der baufälligen Wohnhäuser, die beidseits der schmutzigen Kopfsteinpflastergassen aufragen?
Die Juliluft ist heiß und zäh wie flüssiges Paraffin. Der schlanke Mann springt über einen Haufen Pferdemist. Kein Straßenkehrer kommt jemals in diesen Teil der Stadt. Neben einer Palette, auf der sich zahlreiche Fässer türmen, hält Charles Singleton inne und ringt nach Atem.
Ein Pistolenschuss peitscht auf. Die Kugel geht fehl. Der laute Knall der Waffe lässt ihn unwillkürlich an den Krieg denken, an jene unfassbare, wahnwitzige Zeit, während der er in staubiger blauer Uniform mit einer schweren Muskete auf Männer in staubigem Grau gezielt hatte, deren Waffen wiederum auf ihn gerichtet gewesen waren.
Er läuft nun schneller. Die Häscher feuern erneut. Auch diese Schüsse verfehlen ihn.
»Haltet ihn! Fünf Dollar in Gold für seine Ergreifung!«
Aber die wenigen Leute, die sich so früh am Morgen auf der Straße befinden – zumeist irische Lumpensammler und Tagelöhner, die mit ihren geschulterten Tragekörben oder Spitzhacken zur Arbeit stapfen –, verspüren kaum Lust, sich dem Neger in den Weg zu stellen, denn er ist von muskulöser Statur, und sein grimmiger Blick verrät wilde Entschlossenheit. Da die Belohnung zudem von einem Stadtpolizisten ausgelobt wurde, wird sie ohnehin nur ein leeres Versprechen sein.
An der Farbenfabrik Ecke Dreiundzwanzigste Straße biegt Charles nach Westen ab, rutscht jedoch auf den glatten Pflastersteinen aus und stürzt schwer. Ein berittener Polizist trabt herbei, hebt den Schlagstock und nähert sich dem Gestrauchelten. Und dann…
Und?, dachte das Mädchen.
Und?
Was ist dann mit ihm geschehen?
Die sechzehnjährige Geneva Settle drehte noch einmal den Knauf des Lesegeräts, doch der Mikrofiche bewegte sich nicht weiter; sie hatte das Ende dieser Karte erreicht. Sie nahm den Metallrahmen heraus. Er enthielt die Titelseite einer Ausgabe der Coloreds’ Weekly Illustrated mit dem Datum 23. Juli 1868. Geneva blätterte die anderen Rahmen in dem verstaubten Kasten durch. Ihre Befürchtung wuchs, dass die übrigen Seiten des Artikels fehlten und sie daher niemals herausfinden würde, was aus ihrem Vorfahren Charles Singleton geworden war. Sie hatte gehört, dass die Geschichte der Schwarzen in den Archiven oft nur unvollständig dokumentiert war, sofern überhaupt noch Unterlagen existierten.
Wo steckte bloß der Rest des Artikels?
Ah … Sie wurde schließlich doch noch fündig und setzte den Rahmen behutsam in das abgenutzte graue Lesegerät ein. Dann drehte sie ungeduldig den Knauf, um die Fortsetzung der Geschichte von Charles’ Flucht auf den Bildschirm zu bekommen.
Dank ihrer ausgeprägten Fantasie – geschult durch die unzähligen Bücher, die sie im Laufe der Jahre verschlungen hatte – war Geneva in der Lage gewesen, dem nüchternen Zeitungsbericht eine Fülle von Eindrücken abzugewinnen. Sie fühlte sich beinahe, als wäre sie zurück ins neunzehnte Jahrhundert gereist und würde höchstpersönlich an der Verfolgung des ehemaligen Sklaven durch die heißen, stinkenden Straßen New Yorks teilnehmen. In Wahrheit befand sie sich fast hundertvierzig Jahre später in einer menschenleeren Bibliothek, gelegen im vierten Stock des Museums für afroamerikanische Kultur und Geschichte an der Fünfundfünfzigsten Straße in Midtown Manhattan.
Geneva drehte den Knauf und ließ die Seiten auf dem grobkörnigen Bildschirm an sich vorbeiziehen. Dann fand sie die Fortsetzung des Artikels, versehen mit der Überschrift:
SCHANDE
Bericht über das Verbrechen eines Freigelassenen
Charles Singleton, ein Veteran des Kriegs zwischen den Staaten, begeht offenen Verrat an der Sache unseres Volkes
Ein Foto zeigte den achtundzwanzigjährigen Charles Singleton in seiner Armeeuniform. Er war hochgewachsen, hatte große Hände. Die Uniformjacke spannte an Brust und Armen und ließ auf kräftige Muskeln schließen. Breite Lippen, hohe Wangenknochen, runder Kopf, ziemlich dunkle Haut.
Das Mädchen betrachtete das ernste Antlitz, den ruhigen, durchdringenden Blick und glaubte eine gewisse Ähnlichkeit festzustellen – sie hatte den Kopf und das Gesicht ihres Vorfahren, die runde Physiognomie, den satten Teint. Bei Singletons Körperbau hörte die Übereinstimmung allerdings auf. Geneva Settle war hager wie ein kleiner Junge, worauf die Mädchen, die im Delano Project wohnten, sie immer wieder gern hinwiesen.
Sie wollte weiterlesen, aber ein Geräusch lenkte sie ab.
Ein Klicken irgendwo im Raum. Ein Türschloss? Dann hörte sie Schritte. Sie hielten inne. Dann noch ein Schritt. Schließlich Stille. Geneva schaute sich um, sah jedoch niemanden.
Sie erschauderte, ermahnte sich aber, nicht den Kopf zu verlieren. Ihr Argwohn ging auf üble Erfahrungen zurück: die Delano-Mädchen, die sie auf dem Schulhof der Langston Hughes Highschool in die Mangel nahmen, und das eine Mal, als Tonya Brown und ihre Bande aus den St. Nicholas Houses sie in eine Gasse zerrten und dermaßen verprügelten, dass sie einen Backenzahn verlor. Jungen grapschten, Jungen lästerten, Jungen demütigten. Aber die Mädchen ließen dich bluten.
Auf den Boden mit ihr, gebt’s ihr, zeigt’s dem Miststück …
Wieder Schritte. Wieder blieben sie stehen.
Stille.
Die Atmosphäre hier war nicht unbedingt vertrauenerweckend. Gedämpftes Licht, schale Luft, absolute Ruhe. Und es hielt sich niemand sonst hier auf, nicht um Viertel nach acht an einem Dienstagmorgen. Das Museum war noch geschlossen – die Touristen schliefen um diese Zeit oder saßen gerade beim Frühstück –, doch die Bibliothek öffnete um acht. Geneva hatte schon vor der Tür gewartet, so sehr hatte es sie gedrängt, diesen Artikel zu lesen. Nun saß sie in einer Nische am Ende einer großen Ausstellungshalle, in der gesichtslose Modepuppen Kleidung aus dem neunzehnten Jahrhundert trugen und an deren Wänden Gemälde von Männern mit bizarren Hüten hingen, von Frauen mit Hauben auf dem Kopf und von Pferden mit seltsam dünnen Beinen.
Ein weiterer Schritt, ein weiteres Innehalten.
Sollte sie lieber aufstehen und sich zu Dr. Barry, dem Bibliothekar, gesellen, bis dieser unheimliche Kerl verschwand?
Und dann lachte der andere Besucher.
Es klang nicht merkwürdig, sondern fröhlich.
Und er sagte: »Okay. Ich rufe später zurück.«
Sie hörte, wie ein Mobiltelefon zusammengeklappt wurde. Deshalb war er immer wieder stehen geblieben: Er hatte einfach nur der Person am anderen Ende der Leitung zugehört.
Ich hab dir doch gleich gesagt, es besteht kein Grund zur Sorge, Mädchen. Leute, die lachen und beim Telefonieren freundliche Sachen sagen, sind nicht gefährlich. Er ist langsam gegangen, weil jemand, der redet, nun mal eben langsam geht – obwohl es genau genommen ziemlich rücksichtslos ist, in einer Bibliothek zu telefonieren.
Geneva wandte sich wieder dem Bildschirm des Lesegeräts zu. Hast du es geschafft zu entkommen, Charles?, dachte sie. Mann, ich drück dir die Daumen.
Doch er kam wieder auf die Beine und setzte die feige Flucht fort, anstatt sich wie ein mutiger Mann für seine Tat zu verantworten.
So viel zum Thema objektive Berichterstattung, dachte sie verärgert.
Eine Weile gelang es ihm noch, sich den Verfolgern zu entziehen, doch die Flucht war nicht von langer Dauer. Ein Negerkaufmann, der auf der Veranda seines Ladens stand, sah den Freigelassenen und beschwor ihn im Namen der Gerechtigkeit, sich zu stellen. Er sagte, er habe von Mr. Singletons Verbrechen gehört und werfe ihm vor, dadurch Schande über alle Farbigen des Landes gebracht zu haben. Dieser Bürger, ein gewisser Walker Loakes, warf daraufhin einen Ziegelstein nach Mr. Singleton, um ihn zu Fall zu bringen.
Charles kann dem schweren Stein ausweichen. »Ich bin unschuldig«, ruft er dem Mann zu. »Ich habe nicht getan, was die Polizei mir zur Last legt.«
Genevas Vorstellungskraft hatte erneut dafür gesorgt, dass sie völlig in der Geschichte aufging.
Aber Loakes ignoriert die Behauptung des Freigelassenen, läuft auf die Straße und ruft den Polizisten zu, der Gesuchte sei zum Hafen unterwegs.
Dem früheren Sklaven ist schwer ums Herz, und er muss immer wieder an Violet und ihren gemeinsamen Sohn Joshua denken. Verzweifelt setzt er seine Flucht fort.
Er rennt und rennt …
Hinter ihm ertönt das Hufgetrappel der Polizeipferde. Vor ihm tauchen weitere Reiter auf, angeführt von einem behelmten Beamten, der drohend eine Pistole schwingt. »Halt, Charles Singleton! Keine Bewegung! Ich bin Detective Captain William Simms und seit zwei Tagen auf der Suche nach dir.«
Der Freigelassene gehorcht. Er lässt die breiten Schultern hängen, senkt die starken Arme und saugt mit tiefen Atemzügen die feuchte, faulige Luft am Ufer des Hudson River ein. In der Nähe steht das Frachtbüro der Hafenschlepper, und überall auf dem Fluss sieht Charles die Masten der Segelschiffe emporragen, als wollten sie ihn vielhundertmal mit ihrer Verheißung der Freiheit verhöhnen. Keuchend lehnt er sich gegen das große Schild der Swiftsure Express Company und blickt dem Beamten entgegen. Die Hufschläge des Pferdes hallen laut von den Pflastersteinen wider.
»Charles Singleton, du bist hiermit wegen Einbruchdiebstahls verhaftet. Ergib dich freiwillig, oder wir werden dich zwingen. Du wirst in Ketten gelegt, aber es liegt ganz bei dir, ob es für dich dabei ohne Schmerzen oder mit Blutvergießen abgeht.«
»Man wirft mir ein Verbrechen vor, das ich nicht begangen habe!«
»Ich wiederhole: Ergib dich oder stirb. Eine andere Wahl hast du nicht.«
»Doch, Sir, die habe ich«, ruft Charles und rennt wieder los – genau auf den Kai zu.
»Stehen bleiben oder wir schießen!«, ruft Detective Simms.
Aber der Freigelassene springt mit einem Satz über die Brüstung des Kais wie ein Pferd über ein Hindernis. Einen Moment lang scheint er zu schweben, dann stürzt er mit rudernden Armen neun Meter hinab in das trübe Wasser des Hudson River. Dabei murmelt er ein paar Worte, vielleicht ein Stoßgebet, vielleicht eine Liebeserklärung an Frau und Kind, doch was auch immer es sein mag, keiner der Verfolger kann es hören.
Der einundvierzigjährige Thompson Boyd war noch fünfzehn Meter von dem Mädchen entfernt und kam langsam näher.
Er trug bereits Latexhandschuhe, zog sich nun die Skimaske über das Gesicht, rückte die Sehschlitze zurecht und öffnete kurz die Trommel seines Revolvers, um sicherzugehen, dass nichts klemmte. Zwar hatte er das zuvor schon überprüft, aber in seiner Branche konnte man nicht vorsichtig genug sein. Er steckte die Waffe in die Tasche des dunklen Regenmantels und holte einen Schlagstock hervor.
Boyd befand sich in der Ausstellungshalle zwischen den Bücherregalen, hinter denen die Tische mit den Mikrofilmlesegeräten standen. Seine Augen brannten an jenem Morgen ausgesprochen heftig. Er rieb sie sich mit zwei Fingern und musste vor Schmerz blinzeln.
Dann vergewisserte er sich abermals, dass niemand sonst sich im Raum aufhielt.
Es gab weder hier noch unten im Gebäude irgendwelche Wachleute. Auch keine Überwachungskameras oder Besucherlisten, in die man sich eintragen musste. Alles bestens. Dennoch blieben ein paar logistische Probleme. In dem großen Saal war es absolut still, und Thompson konnte sich nicht unbemerkt anschleichen. Das Mädchen würde demnach wissen, dass jemand anders zugegen war, und womöglich nervös oder zumindest hellhörig werden.
Daher hatte er diesen Flügel der Bibliothek betreten, die Tür hinter sich verriegelt und dann ein leises Lachen von sich gegeben. Thompson Boyd lachte schon seit vielen Jahren nicht mehr. Doch er war ein Profi und wusste um die Macht der guten Laune – und wie er sie sich für seine Arbeit zunutze machen konnte. Ein Lachen – verbunden mit einem heiteren Abschiedsgruß und dem Geräusch eines zusammenklappenden Mobiltelefons – würde das Mädchen in Sicherheit wiegen, schätzte er.
Der Trick schien zu funktionieren. Boyd warf einen schnellen Blick um das Regalende herum und sah das Mädchen, das auf den Bildschirm des Lesegeräts starrte. Ihre Hände hingen zu beiden Seiten herab, ballten sich fortwährend zu Fäusten und öffneten sich wieder. Offenbar war sie in eine aufregende Lektüre vertieft.
Boyd ging los.
Und hielt im selben Moment inne. Das Mädchen stand vom Tisch auf. Er hörte ihren Stuhl über das Linoleum scharren. Wollte sie etwa den Raum verlassen? Nein. Er vernahm das Geräusch des Trinkbrunnens und ein paar gierige Schlucke. Dann hörte er sie Bücher aus dem Regal ziehen und neben dem Lesegerät stapeln. Es herrschte kurz Stille, dann holte sie noch mehr Bücher und legte sie mit dumpfem Laut auf dem Tisch ab. Schließlich folgte das Quietschen des Stuhls, als sie sich wieder hinsetzte. Dann war alles ruhig.
Thompson schaute erneut. Sie saß an ihrem Platz und las in einem der zehn oder zwölf Bücher, die sich vor ihr auftürmten.
Er ging wieder los, in der Rechten den Schlagstock, in der Linken die Tüte mit den Kondomen, dem Teppichmesser und dem Isolierband.
Nun kam er direkt auf sie zu, war noch sieben Meter hinter ihr, dann fünf. Er hielt den Atem an.
Drei Meter. Auch falls sie nun aufsprang, würde er sie mit einem Satz zu fassen bekommen – um ihr das Knie zu zertrümmern oder sie mit einem Schlag auf den Kopf zu betäuben.
Noch zwei Meter, anderthalb …
Er blieb stehen und legte die Tüte lautlos auf einem Regal ab. Dann umfasste er den lackierten Eichenholzknüppel mit beiden Händen, trat vor und holte aus.
Das Mädchen blieb gänzlich in den Text versunken und merkte nicht, dass der Angreifer nur eine Armeslänge hinter ihr stand. Thompson ließ den Schlagstock mit aller Kraft auf die Wollmütze des Mädchens niedersausen.
Knack …
Als der Knüppel mit hohlem Knall ihren Kopf traf, schickte der Aufprall eine schmerzhafte Vibration durch Boyds Hände.
Irgendetwas stimmte nicht. Das Geräusch war falsch, und das Gefühl passte auch nicht. Was ging hier vor?
Thompson Boyd wich zurück, denn der Körper fiel zu Boden.
Und zwar in zwei Teilen.
Der Torso der Puppe kippte in eine Richtung, der Kopf in eine andere. Im ersten Moment war Thompson völlig verblüfft. Dann blickte er zur Seite und entdeckte die untere Hälfte der Figur. Sie steckte nach wie vor in einem Ballkleid und stand neben mehreren anderen Puppen, die allesamt Frauenkleidung aus dem Amerika des neunzehnten Jahrhunderts trugen.
Nein…
Das Mädchen hatte irgendwie erkannt, dass er eine Bedrohung darstellte. Daraufhin war sie aufgestanden und hatte ein paar Bücher aus den Regalen geholt, um zu kaschieren, dass sie im Anschluss eine der Puppen auseinander nahm. Sie hatte der Figur ihr Sweatshirt und die Wollmütze übergestreift und sie dann auf dem Stuhl platziert.
… Zwei
Geneva Settle rannte.
Sie floh. Wie ihr Vorfahr Charles Singleton.
Sie keuchte. Wie Charles vor hundertvierzig Jahren auf der Flucht vor der Polizei.
Aber im Gegensatz zu ihm ließ Geneva nun jegliche Würde vermissen, davon war sie überzeugt. Sie schluchzte, schrie um Hilfe, geriet vor lauter Panik ins Stolpern und prallte hart gegen eine Wand, wobei sie sich den Handrücken aufschürfte.
Da ist sie, da ist sie, die dürre kleine Rotznase … Packt sie!
Der Gedanke an die Aufzugkabine erschreckte sie. Sie würde praktisch in der Falle stecken. Also entschied sie sich für die Feuertreppe. Sie stieß die Tür aus vollem Lauf auf, was ihr einen Moment lang den Atem raubte, und wurde von dem grellgelben Licht geblendet, doch sie hielt nicht inne. Mit großen Schritten hastete sie zur dritten Etage hinunter und zerrte an dem Türknauf, aber die Brandschutztüren ließen sich von dieser Seite nicht öffnen. Geneva musste es bis ins Erdgeschoss schaffen.
Sie lief weiter nach unten und rang nach Luft. Warum? Was wollte dieser Mann?, grübelte sie.
Mit Leuten wie uns gibt das dürre kleine Miststück sich nicht ab …
Die Pistole … Deshalb hatte sie Verdacht geschöpft. Geneva Settle gehörte keiner Gang an, aber als Schülerin der mitten in Harlem gelegenen Langston Hughes Highschool hatte sie im Laufe der Zeit zwangsläufig ein paar Waffen zu Gesicht bekommen. Als ein charakteristisches Klicken an ihre Ohren gedrungen war – das ganz eindeutig nicht von einem Mobiltelefon stammen konnte –, hatte sie sich gefragt, ob der lachende Mann womöglich bloß freundlich getan hatte und in Wahrheit Böses im Schilde führte. Dann war sie scheinbar arglos aufgestanden, hatte einen Schluck Wasser getrunken und eigentlich sofort die Flucht ergreifen wollen, wäre ihr nicht bei einem verstohlenen Blick zu den Regalen die Skimaske aufgefallen. Ihr wurde klar, dass sie unmöglich an dem Fremden vorbeikommen konnte, solange seine Aufmerksamkeit nicht auf den Tisch gerichtet blieb. Daher hatte sie geräuschvoll einige Bücher aufgestapelt, die nächstbeste Modepuppe geholt, ihr Mütze und Sweatshirt übergezogen und sie auf den Stuhl vor dem Lesegerät gestellt. Dann hatte sie abgewartet, bis er sich dem Tisch näherte, und war hinter ihm vorbeigeschlichen.
Macht sie fertig, macht das Miststück fertig…
Nun lief Geneva die nächste Treppe hinunter.
Über ihr ertönten Schritte. Herrje, er folgte ihr tatsächlich! Er hatte ebenfalls das Treppenhaus betreten und war nur noch ein Stockwerk hinter ihr. Halb rennend, halb stolpernd stürmte sie nach unten und hielt sich dabei die verletzte Hand. Die Schritte kamen immer näher.
Die letzten vier Stufen nahm Geneva mit einem Sprung. Auf dem harten Betonboden knickten ihre Beine ein, und sie prallte gegen die rau verputzte Wand. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rappelte sie sich auf, hörte seine Schritte, sah seinen Schatten an der Wand.
Sie schaute zu der Stahltür. Ihr Atem stockte. Um den Griff war eine Kette gewickelt.
Nein, nein, nein… Es war mit Sicherheit nicht legal, die Tür am Ende der Feuertreppe mit einer Kette verschlossen zu halten. Was die Betreiber des Museums offenbar nicht davon abhielt, sich auf diese Weise vor Einbrechern zu schützen. Vielleicht hatte auch der Fremde die Kette dort angebracht, um vorsorglich den Fluchtweg zu versperren. Hier stand sie also nun, gefangen in einem düsteren Betonschacht. Aber wurde die Tür überhaupt durch die Kette blockiert?
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Los, Mädchen!
Geneva warf sich mit aller Kraft gegen den Griff.
Die Tür schwang auf.
Gott sei …
Ein gewaltiger Lärm erfüllte urplötzlich ihre Ohren, und ein Schmerz durchzuckte sie. Hatte man ihr in den Kopf geschossen? Dann begriff sie, dass sie den Türalarm ausgelöst hatte. Die Sirene heulte so gellend wie Keeshs kleine Cousinen. Geneva stand in der Gasse, schlug die Tür hinter sich zu und wusste im ersten Moment nicht, ob sie nach rechts oder links rennen sollte.
Auf den Boden mit ihr, gebt’s ihr, zeigt’s dem Miststück …
Sie entschied sich für rechts, erreichte die Fünfundfünfzigste Straße und lief mitten zwischen die zahlreichen Passanten, die sich dort auf dem Weg zur Arbeit befanden. Einige der Leute musterten sie beunruhigt, andere argwöhnisch, aber die meisten ignorierten das verängstigte Mädchen. Dann hörte Geneva, wie hinter ihr die Sirene wieder lauter wurde, weil ihr Verfolger die Tür aufstieß. Würde er sich aus dem Staub machen oder ihr weiterhin nachsetzen?
Geneva eilte die Straße entlang auf Keesh zu, die dort auf dem Bürgersteig stand, in einer Hand einen Pappbecher Kaffee hielt und soeben versuchte, sich im Wind eine Zigarette anzuzünden. Ihre mokkabraune Klassenkameradin – die sorgfältig violettes Make-up aufgelegt und sich die Haare mit blonden Strähnchen verlängert hatte – war genauso alt wie Geneva, aber einen Kopf größer und wesentlich üppiger, mit großen Brüsten, ausladenden Hüften und noch manch anderen straffen Rundungen. Sie hatte draußen gewartet, denn sie interessierte sich weder für Museen noch für irgendwelche anderen Gebäude, in denen man nicht rauchen durfte.
»Gen!« Ihre Freundin ließ den Kaffeebecher fallen und lief ihr entgegen. »Was is’n los? Du siehst ja ganz fertig aus!«
»Dieser Mann…«, stieß Geneva keuchend hervor und spürte, wie ihr schwindlig wurde. »Da war so ein Kerl, der ist auf mich losgegangen.«
»Scheiße, echt?« Lakeesha schaute sich um. »Wo steckt er denn?«
»Keine Ahnung. Er hat mich verfolgt.«
»Bleib ruhig. Dir wird nichts passieren. Lass uns verschwinden. Na los, komm schon!« Die füllige Lakeesha – die jede zweite Sportstunde schwänzte und seit zwei Jahren rauchte – trabte los, so gut sie konnte, nach Luft schnappend und mit rudernden Armen.
Nach nur einem halben Block verringerte Geneva das Tempo und blieb schließlich stehen. »Warte mal.«
»Was hast du vor, Gen?«
Die Panik war einem anderen Gefühl gewichen.
»Los doch«, drängte Keesh außer Atem. »Beweg deinen Hintern.«
Doch Geneva Settle hatte ihre Meinung geändert. Statt Angst verspürte sie nun Wut. Verdammt, er soll nicht einfach so davonkommen, dachte sie. Sie drehte sich um und ließ den Blick über die Straße schweifen. Dann entdeckte sie, wonach sie Ausschau gehalten hatte, dicht bei der Einmündung der Gasse, aus der sie eben erst geflohen war. Sie ging dorthin zurück.
Einen Block vom afroamerikanischen Museum entfernt hörte Thompson Boyd auf, sich hastig durch die Menge der morgendlichen Berufspendler zu drängen. Thompson war ein Durchschnittstyp. In jeder Hinsicht. Mittelbraunes Haar, weder dick noch dünn, mittelgroß, weder gut aussehend noch hässlich, weder muskulös noch schmächtig. (Im Gefängnis hatte man ihn »Joe Jedermann« genannt.) Die meisten Leute sahen direkt durch ihn hindurch.
Aber ein Mann, der im Laufschritt durch Midtown hetzte, erregte unweigerlich Aufsehen, sofern er nicht geradewegs auf einen Bus, ein Taxi oder eine U-Bahn-Station zusteuerte. Also passte Boyd sich der Geschwindigkeit der anderen an. Kurz darauf tauchte er in der Menge unter, und niemand achtete mehr auf ihn.
Während er an der Kreuzung Sechste Avenue und Dreiundfünfzigste Straße vor der roten Ampel wartete, überlegte er hin und her. Dann traf Thompson eine Entscheidung. Er zog den Regenmantel aus und legte ihn sich über den Arm, wobei er darauf achtete, dass seine Waffen zugänglich blieben. Danach machte er kehrt und schlug den Rückweg zum Museum ein.
Thompson Boyd war ein Fachmann, der stets überaus korrekt vorging. Was er nun vorhatte – nämlich zum Schauplatz eines soeben erst fehlgeschlagenen Überfalls zurückzukehren –, mochte unklug erscheinen, da in Kürze zweifellos die Polizei dort eintreffen würde.
Andererseits wusste er aus Erfahrung, dass die Anwesenheit der Polizei zu allgemeiner Sorglosigkeit verleitete. Oft kam man unter solchen Umständen wesentlich einfacher an jemanden heran. Der Durchschnittsmann schlenderte nun mit dem Passantenstrom unauffällig in Richtung des Museums zurück, ein ganz gewöhnlicher Berufspendler, ein Joe Jedermann auf dem Weg zur Arbeit.
Es war ein echtes Wunder.
Irgendwo im Gehirn oder im Körper trat ein mentaler oder physischer Reiz auf – ich will das Glas nehmen, ich muss die Pfanne loslassen, die mir die Finger verbrennt. Der Reiz löste einen Nervenimpuls aus, der sich entlang der Neuronen durch den Körper fortpflanzte. Dieser Impuls bestand nicht, wie die meisten Leute glaubten, aus einem konstanten elektrischen Strom, sondern ähnelte eher einer Kettenreaktion, die dadurch hervorgerufen wurde, dass die Oberfläche der jeweiligen Nervenzelle einen Moment lang von einer positiven auf eine negative Ladung wechselte. Die Stärke des Impulses war immer gleich – entweder es gab ihn oder es gab ihn nicht –, ebenso wie seine Geschwindigkeit, die etwa vierhundert Kilometer pro Stunde betrug.
Sobald der Impuls an seinem Ziel eintraf – einem Muskel, einer Drüse oder einem Organ –, reagierte dieses darauf und ließ die Herzen schlagen, die Lungen atmen, die Körper tanzen, die Hände Blumen pflanzen, Liebesbriefe schreiben oder Raumschiffe steuern.
Ein Wunder.
Es sei denn, es ging etwas schief. Es sei denn, du warst der Leiter einer kriminaltechnischen Abteilung und untersuchtest gerade eine U-Bahn-Baustelle, die Schauplatz eines Mordes gewesen war. Dann fiel dir ein Stützbalken ins Genick und zertrümmerte es am vierten Halswirbel, also vier Knochen unterhalb der Schädelbasis. So wie es vor einigen Jahren Lincoln Rhyme ergangen war.
Wenn so etwas passierte, konnte alles Mögliche daraus folgen.
Auch falls der Schlag nicht direkt das Rückenmark durchtrennte, so traten dort gleichwohl Blutungen auf, deren Druck die Neuronen zerquetschte oder abschnürte. Die absterbenden Nervenzellen verschlimmerten den Schaden noch, indem sie bei ihrem Tod – aus unbekannten Gründen – eine toxische Aminosäure freisetzten, die weitere Neuronen tötete. Falls der Patient überlebte, bildete sich rund um die Nervenzellen letzten Endes Narbengewebe und hüllte sie ein wie Erde einen Sarg – eine passende Metapher, denn im Gegensatz zu den Neuronen im restlichen Körper konnten die Nervenzellen des Gehirns und des Rückenmarks sich nicht regenerieren. Sobald sie erst einmal abgestorben waren, blieben sie auf ewig funktionslos.
Nach solch einem »katastrophalen Vorkommnis«, wie die Mediziner es dezent umschrieben, stellte sich bei manchen der Patienten – nämlich bei denjenigen, die Glück gehabt hatten – heraus, dass die Neuronen, von denen lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag und Atmung abhingen, weiterhin arbeiteten. Diese Patienten überlebten.
Doch womöglich waren sie eher diejenigen, die Pech gehabt hatten.
Manch einer von ihnen wäre lieber gleich gestorben und hätte dadurch keine Infektionen, wund gelegenen Stellen, Muskelverkürzungen und Krämpfe erleiden müssen. Auf diese Weise wäre ihm auch die ständige Gefahr einer autonomen Dysregulation erspart geblieben, die einen Schlaganfall nach sich ziehen konnte. Und er hätte die schaurigen wandernden Phantomschmerzen vermieden, die sich genau wie echte Schmerzen anfühlten, aber weder durch Aspirin noch Morphium gelindert werden konnten.
Ganz zu schweigen von der grundlegenden Änderung der Lebensumstände: den Physiotherapeuten und Betreuern, den Beatmungsgeräten, Kathetern und Erwachsenenwindeln, der ständigen Abhängigkeit … und natürlich den Depressionen.
Manche der Betroffenen gaben einfach auf und entschieden sich für den Tod. Selbstmord war immer eine Option, wenngleich keine einfache. (Versuch doch mal, dich umzubringen, wenn du bloß deinen Kopf bewegen kannst.)
Andere hingegen setzten sich zu Wehr.
»Hast du genug?«, fragte der schlanke junge Mann in Stoffhose, weißem Hemd und dunkelrot geblümter Krawatte.
»Nein«, erwiderte Rhyme angestrengt atmend. »Ich will noch weitermachen.« Er war auf einem komplizierten Trimmrad festgeschnallt. Sie befanden sich in einem der Gästezimmer im ersten Stock seines Stadthauses am Central Park West.
»Ich glaube, es reicht allmählich«, sagte Thom, sein Betreuer. »Du bist schon über eine Stunde dabei. Deine Herzfrequenz ist ziemlich hoch.«
»Es ist, als würde ich auf das Matterhorn fahren«, keuchte Rhyme. »Ich bin Lance Armstrong.«
»Das Matterhorn gehört nicht zur Tour de France. Es ist ein Berg. Man kann an ihm hochklettern, aber nicht per Fahrrad.«
»Danke für die Belehrung, Thom. Ich hab’s nicht wörtlich gemeint. Wie viel habe ich geschafft?«
»Fünfunddreißig Kilometer.«
»Lass uns noch fünfundzwanzig dranhängen.«
»Wohl kaum. Fünf.«
»Zehn«, feilschte Rhyme.
Der gut aussehende Betreuer hob seufzend eine Augenbraue. »Also gut.«
Mehr als zehn hätte Rhyme ohnehin nicht gewollt. Seine Stimmung hob sich. Er liebte es zu gewinnen.
Die Übung ging weiter. Die Maschine wurde zwar durch seine Muskeln angetrieben, doch es bestand ein gewaltiger Unterschied zu den Trimmrädern in einem Fitnesscenter. Der Stimulus, der den Impuls durch die Nervenbahnen schickte, kam nicht von Rhymes Gehirn, sondern von einem Computer, der durch Elektroden mit den Beinmuskeln verbunden war. Bezeichnet wurde ein solches Gerät als FES-Fahrradergometer. Die funktionelle elektrische Stimulation ahmte mittels Computer, Kabeln und Elektroden das Nervensystem nach und schickte winzige Stromstöße in die Muskeln, wodurch diese sich genauso verhielten, als ginge der Impuls vom Gehirn aus.
Für alltägliche Aktivitäten wie das Gehen oder den Gebrauch von Gegenständen kam die FES nur selten zur Anwendung. Ihr eigentlicher Nutzen war therapeutischer Natur und hatte zum Ziel, den Gesundheitszustand von Schwerbehinderten zu verbessern.
Rhyme verdankte die Anregung zu diesen Übungen einem Mann, den er sehr bewunderte: dem verstorbenen Schauspieler Christopher Reeve, der als Folge eines Reitunfalls eine sogar noch gravierendere Schädigung davongetragen hatte als Rhyme. Durch Willenskraft und unermüdliches Training – und zur Überraschung der meisten Schulmediziner – war es Reeve gelungen, an zuvor paralysierten Körperteilen einige motorische und sensorische Fähigkeiten zurückzuerlangen. Nachdem Rhyme jahrelang erwogen hatte, sich einer riskanten Rückenmarksoperation zu unterziehen, war er letztlich zu dem Entschluss gelangt, stattdessen wie Reeve ein konsequentes, hartes Übungsprogramm in Angriff zu nehmen.
Der vorzeitige Tod des Schauspielers hatte Rhyme dazu veranlasst, seine Anstrengungen noch zu verstärken, und Thom hatte daraufhin Robert Sherman ausfindig gemacht, einen der besten Rückenmarkspezialisten der Ostküste. Der Arzt hatte für Rhyme einen Übungsplan zusammengestellt, der das Ergometer, eine Wassertherapie und einen Laufapparat umfasste – ein großes Gerät mit computergesteuerten Roboterbeinen, die Rhyme »gehen« ließen.
Die Therapie hatte Erfolge gezeitigt. Rhymes Herz und Lunge waren gekräftigt worden. Seine Knochendichte entsprach der eines gesunden Mannes gleichen Alters. Die Muskelmasse hatte zugenommen. Er befand sich nun in nahezu der gleichen körperlichen Form wie einst als Leiter der Investigation and Resources Division des New York Police Department, der auch die Spurensicherung unterstand. Damals hatte er täglich viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt und manche Tatorte sogar höchstpersönlich untersucht, was für einen Beamten im Range eines Captains äußerst ungewöhnlich gewesen war. Darüber hinaus hatte er überall in der Stadt Stein-, Erd-, Beton- oder Rußproben gesammelt und in einer forensischen Datenbank katalogisiert.
Dank Shermans Übungen wies Rhymes Körper, der oft stundenlang in gleicher Haltung mit dem Rollstuhl oder Bett in Kontakt blieb, weniger Druckstellen auf. Seine Darm- und Blasenfunktion besserte sich kontinuierlich, und er litt wesentlich seltener unter Harnwegsinfektionen. Zudem war seit Beginn der Übungen nur ein einziger Fall von autonomer Dysregulation aufgetreten.
Dennoch blieb natürlich eine Frage offen: Würden die Monate voller Strapazen nicht nur seine Muskeln und Knochen stärken, sondern auch eine heilende Wirkung haben? Ein simpler Test der motorischen und sensorischen Fähigkeiten konnte es ihm sofort verraten, aber dazu war ein Krankenhausbesuch erforderlich, und Rhyme schien irgendwie nie Zeit dafür zu finden.
»Du kannst keine einzige Stunde erübrigen?«, pflegte Thom ihn zu fragen.
»Eine Stunde? Eine Stunde? Seit wann dauert ein Krankenhaustermin nur eine Stunde? Und wo steht wohl dieses besagte Krankenhaus, Thom? In Nimmerland? In Oz?«
Dr. Sherman hatte ihm schließlich das Versprechen abgetrotzt, sich dem Test zu unterziehen. In einer halben Stunde würden Rhyme und Thom zum New York Hospital aufbrechen, um sich Klarheit über seine Fortschritte zu verschaffen.
Vorerst jedoch dachte Lincoln Rhyme nicht daran, sondern an das Radrennen, an dem er soeben teilnahm – und das eindeutig auf dem Matterhorn stattfand, herzlichen Dank. Außerdem war er besser als Lance Armstrong.
Nachdem er fertig war, schnallte Thom ihn von dem Fahrrad ab, badete ihn und zog ihm ein weißes Hemd und eine dunkle Hose an. Dann hob er ihn in den Rollstuhl. Rhyme fuhr mit dem winzigen Aufzug ins Erdgeschoss, wo die rothaarige Amelia Sachs im Labor, dem früheren Wohnzimmer, saß und Beweise aus einem der Fälle registrierte, zu denen das NYPD Rhyme als Berater hinzugezogen hatte.
Mit seinem einzigen noch beweglichen Finger – dem linken Ringfinger – steuerte Rhyme den leuchtend roten Rollstuhl Modell Storm Arrow per Touchpad geschickt durch den Raum zu Amelia. Sie beugte sich zu ihm herüber und küsste ihn auf den Mund. Rhyme erwiderte den Kuss und drückte seine Lippen fest auf die ihren. Einen Moment lang verharrten sie so. Rhyme genoss die Wärme ihrer Nähe, das Kitzeln ihres Haars auf seiner Wange, den lieblichen Blumenduft der Seife.
»Wie weit hast du’s heute geschafft?«, fragte Amelia.
»Ich könnte jetzt schon im Nordteil von Westchester sein – falls man mich nicht rechts rausgewinkt hätte.« Ein finsterer Blick zu Thom. Der Betreuer zwinkerte Sachs zu und blieb völlig ungerührt.
Die hochgewachsene, gertenschlanke Frau trug einen marineblauen Hosenanzug und eine der schwarzen oder dunkelblauen Blusen, die sie seit ihrer Beförderung zum Detective bevorzugte. (Im Diensthandbuch der Polizei stand eine Warnung: Eine sich farblich abhebende Oberbekleidung bietet ein deutlicheres Ziel im Brustbereich.) Die Garderobe war zweckmäßig und schlicht, ganz anders als in Amelias einstigem Job; bevor sie zur Polizei ging, hatte Sachs einige Jahre als Mannequin gearbeitet. In Hüfthöhe wölbte die Jacke sich ein wenig nach außen. Dort hing die Glock Automatik, und zwar am Bund einer Männerhose; Amelia legte unbedingten Wert auf eine Gesäßtasche, in der sie ihr eigentlich verbotenes, aber oft sehr nützliches Springmesser verstauen konnte. Und sie trug wie üblich weiche Schuhe mit gepolsterten Sohlen. Das Gehen bereitete ihr Schmerzen, denn sie litt an Arthritis.
»Wann fahren wir los?«, fragte sie Rhyme.
»Zum Krankenhaus? Oh, du brauchst nicht mitzukommen. Bleib lieber hier und nimm die Beweise auf.«
»Ich bin fast fertig. Außerdem geht es nicht darum, ob ich mitzukommen brauche. Ich möchte mitkommen.«
»Affentheater«, murmelte er. »Das wird ein Affentheater. Wusst ich’s doch.« Er wollte Thom einen vorwurfsvollen Blick zuwerfen, doch der Betreuer war weggegangen.
Es klingelte an der Tür. Thom trat hinaus auf den Korridor und kehrte gleich darauf mit Lon Sellitto zurück. »Hallo allerseits.« Der stämmige Lieutenant, der einen seiner typischen zerknitterten Anzüge trug, nickte vergnügt. Rhyme fragte sich, was hinter der guten Laune stecken mochte. Vielleicht hatte sie mit einer kürzlich erfolgten Verhaftung zu tun oder dem NYPD-Budget für neue Planstellen oder womöglich auch nur mit der Tatsache, dass er ein paar Pfund abgenommen hatte. Das Gewicht des Detectives schwankte stark, worüber er regelmäßig klagte. In Anbetracht der eigenen Lage hatte Lincoln Rhyme wenig Verständnis dafür, wenn jemand über körperliche Makel wie zu viel Leibesumfang oder zu wenig Haar jammerte.
Diesmal aber schien Sellittos Hochstimmung dienstlich bedingt zu sein. Der Lieutenant schwenkte einige Dokumente. »Das Urteil wurde bestätigt.«
»Ah«, sagte Rhyme. »Der Schuh-Fall?«
»Ja.«
Rhyme war natürlich zufrieden, wenngleich kaum überrascht. Warum sollte er auch? Immerhin hatte er die umfangreiche Beweislast gegen den Mörder aufgebaut; der Schuldspruch konnte also unmöglich revidiert werden.
Es war ein interessanter Fall gewesen: Man hatte auf Roosevelt Island – dem eigentümlichen Landstreifen voller Wohngebäude mitten im East River – zwei ermordete Diplomaten vom Balkan aufgefunden, denen jeweils der rechte Schuh fehlte. Das NYPD tat daraufhin, was es bei schwierigen Fällen häufig tat: Es zog Rhyme als beratenden Kriminalisten hinzu – so die gegenwärtige Umschreibung für einen forensischen Wissenschaftler –, der bei den Ermittlungen helfen sollte.
Amelia Sachs untersuchte den Tatort, Spuren wurden gesichert und analysiert. Zunächst wiesen die Anhaltspunkte in keine eindeutige Richtung, und die Polizei kam zu dem Schluss, das Mordmotiv müsse im Bereich der europäischen Politik zu suchen sein. Der Fall blieb offen und ruhte eine Weile – bis beim NYPD ein FBI-Memo eintraf, in dem ein herrenloser Koffer auf dem Flughafen JFK erwähnt wurde. Der Koffer enthielt Aufsätze über Satellitenpeilung, zwei Dutzend elektronische Schaltkreise sowie einen rechten Männerschuh, in dessen ausgehöhltem Absatz ein Computerchip versteckt war. Rhyme vermutete, es könne sich um einen der Schuhe von Roosevelt Island handeln, und, siehe da, er hatte Recht. Auch einige andere Spuren in dem Koffer verwiesen auf den Tatort.
Das roch nach Spionage … fast wie in einem Buch von Robert Ludlum. Sogleich machten erste Theorien die Runde. FBI und Außenministerium legten eine hektische Aktivität an den Tag. Auch jemand aus Langley tauchte auf, was nach Rhymes Erinnerung das erste Mal war, dass die CIA sich für einen seiner Fälle interessierte.
Der Kriminalist musste immer noch lachen, wenn er an die Enttäuschung der Bundesbeamten dachte, die so gern an eine weltweite Verschwörung geglaubt hätten. Eine Woche nach Auffindung des Schuhs verhaftete ein Team des Sondereinsatzkommandos unter Führung von Detective Amelia Sachs einen Geschäftsmann aus Paramus, New Jersey; einen ungehobelten Zeitgenossen, der über Auslandspolitik höchstens so viel wusste, wie in USA Today zu lesen stand.
Rhyme hatte durch eine Untersuchung des Feuchtigkeitsgehalts und der chemischen Bestandteile des Schuhabsatzes bewiesen, dass die Aushöhlung einige Wochen nach der Ermordung der beiden Männer erfolgt sein musste. Darüber hinaus hatte er festgestellt, dass der Computerchip aus dem örtlichen Fachhandel stammte und die GPS-Informationen nicht nur nicht geheim waren, sondern frei verfügbar im Internet standen, wo man sie seit ein oder zwei Jahren nicht mehr aktualisiert hatte.
Ein fingierter Tatort, hatte Rhyme gefolgert. Danach war es ihm gelungen, den Steinstaub im Koffer zu einer Fliesenfabrik in Jersey zurückzuverfolgen. Eine schnelle Überprüfung der Telefongespräche sowie einiger Kreditkartenbelege führte zu dem Ergebnis, dass die Frau des Fabrikbesitzers mit einem der Diplomaten schlief. Ihr Mann hatte von dem Verhältnis erfahren und gemeinsam mit einem Möchtegern-Tony-Soprano, der in seiner Fabrik arbeitete, sowohl den Geliebten als auch dessen bedauernswerten Kollegen ermordet. Dann hatte er die Spuren gelegt, um ein politisches Motiv vorzutäuschen.
»Durchaus eine Affäre, allerdings keine diplomatische«, hatte Rhyme seine Zeugenaussage vor Gericht theatralisch beendet. »Mit geheimen Treffen, allerdings nicht zum Zwecke der Spionage.«
»Einspruch«, hatte der Verteidiger mit matter Stimme gerufen.
»Stattgegeben.« Der Richter musste trotzdem lachen.
Die Geschworenen berieten zweiundvierzig Minuten und befanden den Fabrikanten dann für schuldig. Die Anwälte legten natürlich – wie stets – Revision ein, waren aber vor der Berufungsinstanz gescheitert, wie Sellitto soeben berichtet hatte.
»Lasst uns den Sieg mit einer Fahrt zum Krankenhaus feiern«, sagte Thom. »Bist du so weit?«
»Hetz mich nicht«, murrte Rhyme.
In diesem Moment meldete sich Sellittos Pager. Der Detective sah auf das Anzeigefeld, runzelte die Stirn, nahm dann sein Mobiltelefon vom Gürtel und wählte eine Nummer.
»Hier Sellitto. Was gibt’s?« Der massige Mann nickte langsam und knetete mit der freien Hand geistesabwesend seine Speckrolle. Zuletzt hatte er es mit der Atkins-Diät versucht. Die vielen Steaks und Eier hatten offenbar nicht den gewünschten Erfolg gebracht. »Es geht ihr gut?… Und der Täter?… Ja … Das ist bedauerlich. Bleib dran.« Er blickte auf. »Uns wurde ein Zehn-vierundzwanzig gemeldet. Kennt ihr das afroamerikanische Museum an der Fünfundfünfzigsten? Das Opfer war ein junges Mädchen, ein Teenager. Versuchte Vergewaltigung.«
Amelia Sachs zuckte zusammen und war sofort voller Mitgefühl. Rhyme reagierte anders und fragte sich ganz automatisch: Wie viele Tatorte gibt es? Hat der Täter das Mädchen verfolgt und dabei eventuell etwas verloren? Haben die beiden miteinander gekämpft und Spuren ausgetauscht? Ist er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Hat er einen Wagen benutzt?
Und noch ein weiterer Gedanke schoss ihm durch den Kopf, aber Rhyme hatte nicht vor, ihn laut zu äußern.
»Ist sie verletzt?«, fragte Sachs.
»Eine Schürfwunde an der Hand, mehr nicht. Sie konnte fliehen und einen Streifenbeamten verständigen. Unser Mann hat nachgesehen, aber das Scheusal war schon weg … Also, könnt ihr euch den Tatort vornehmen?«
Sachs sah Rhyme an. »Ich weiß, was du sagen wirst: dass wir beschäftigt sind.«
Das gesamte NYPD stand unter enormem Druck. Viele Beamte waren vom üblichen Dienst abgezogen und der Antiterrorabteilung zugewiesen worden, bei der es in letzter Zeit besonders hektisch zuging; dem FBI lagen mehrere anonyme Berichte über mögliche Bombenanschläge auf israelische Ziele im Großraum New York vor. Infolge der Personalknappheit hatte auch Rhyme so viel zu tun wie schon seit Monaten nicht mehr. Er und Sachs untersuchten derzeit zwei Betrugsfälle, einen bewaffneten Raubüberfall und einen seit drei Jahren ungelösten Mord.
»Ja, wir sind ziemlich beschäftigt«, fasste Rhyme zusammen.
»Das geht nicht nur dir so«, sagte Sellitto. »Wie heißt es doch so schön? Ein Unglück kommt selten allein.«
»Danke, sehr mitfühlend.« Rhyme neigte den Kopf. »Ich wäre gern behilflich. Ehrlich. Aber wir müssen uns bereits um all die anderen Fälle kümmern. Und außerdem habe ich jetzt einen Termin. Im Krankenhaus.«
»Komm schon, Linc«, sagte Sellitto. »Bei keinem deiner Fälle ist ein Kind betroffen. Dieser Mistkerl hat es auf Teenager abgesehen. Lass ihn uns aus dem Verkehr ziehen. Wer weiß, wie viele Mädchen wir dadurch retten können! Du kennst die Stadt – es spielt keine Rolle, was sonst noch los ist. Sobald irgendein Ungeheuer auf Kinder losgeht, werden die hohen Tiere dir freie Hand lassen, um ihn zu schnappen.«
»Aber das wären insgesamt fünf Fälle«, sagte Rhyme mürrisch. Er ließ die Stille einen Moment lang wirken. »Wie alt ist sie?«, fragte er dann zögernd.
»Sechzehn, um Himmels willen. Komm schon, Linc.«
Ein Seufzen. »Na, also gut«, sagte er schließlich. »Ich mach’s.«
»Ernsthaft?«, fragte Sellitto überrascht.
»Warum hält mich bloß jeder für herzlos?«, klagte Rhyme und verdrehte die Augen. »Alle halten mich für einen Spielverderber, sogar du, Lon. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir Prioritäten setzen müssen. Aber ich schätze, du hast Recht. Das hier ist wichtiger.«
»Hat dein plötzlicher Anfall von Hilfsbereitschaft womöglich etwas mit der Tatsache zu tun, dass du jetzt deinen Krankenhausbesuch verschieben kannst?«, fragte der Betreuer.
»Natürlich nicht. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Aber da du es gerade erwähnst, sollten wir den Termin lieber absagen. Gute Idee, Thom.«
»Das ist nicht meine Idee – du hast das so eingefädelt.«
Stimmt, dachte er. »Ich?«, rief er entrüstet. »Das klingt ja so, als hätte ich in Midtown Leute überfallen.«
»Du weißt, was ich meine«, sagte Thom. »Du könntest den Test durchführen lassen und wieder hier sein, bevor Amelia mit dem Tatort fertig ist.«
»Wir könnten im Krankenhaus aufgehalten werden. Was heißt ›könnten‹? Es gibt dort immer irgendwelche Verzögerungen.«
»Ich rufe Dr. Sherman an und verschiebe den Termin«, sagte Sachs.
»Ja, sag ab. Aber leg noch keinen neuen Termin fest. Wir wissen nicht, wie lange das hier dauern wird. Der Täter hat vielleicht noch mehr auf dem Kerbholz.«
»Ich vereinbare einen neuen Termin«, widersprach sie.
»Lass mindestens zwei oder drei Wochen Luft.«
»Ich richte mich nach Dr. Sherman«, sagte Sachs entschlossen.
… Drei
Instinkt.
Streifenpolizisten entwickelten einen sechsten Sinn dafür, verdeckt getragene Schusswaffen zu erkennen. Die alten Hasen der Truppe sagten, sie könnten es schlicht an der Körperhaltung der betreffenden Person ablesen. Dabei spielte weniger das tatsächliche Gewicht der Pistole eine Rolle als vielmehr die gewichtigen Konsequenzen, die das Tragen einer Waffe mit sich brachte. Sie verlieh dem Besitzer Macht.
Und es bestand die Gefahr, erwischt zu werden. Wer in New York unerlaubt eine Schusswaffe bei sich trug, musste mit einer Haftstrafe rechnen. Eine verdeckte Kanone bedeutete Knast. So einfach war das.
Nein, Amelia Sachs konnte nicht genau sagen, woran es lag, aber sie wusste, dass der Mann, der gegenüber dem Museum für afroamerikanische Kultur und Geschichte an einer Hauswand lehnte, bewaffnet war. Er stand mit verschränkten Armen da, rauchte eine Zigarette und musterte das gelbe Absperrband der Polizei, die blinkenden Signallichter, die Beamten.
Als Sachs sich dem Tatort näherte, kam ein blonder Streifenpolizist auf sie zu – so jung, dass es sich um einen Neuling handeln musste. »Hallo«, sagte er. »Ich war als Erster vor Ort. Ich …«
Sachs lächelte. »Sehen Sie nicht mich an«, flüsterte sie. »Schauen Sie zu dem Müllhaufen ein Stück die Straße hinauf.«
Der Mann sah sie verständnislos an. »Wie bitte?«
»Den Müllhaufen«, wiederholte sie mit schroffem Flüstern. »Nicht mich.«
»Verzeihung, Detective«, sagte der junge Mann mit dem kurzen Haarschnitt. Auf dem Namensschild an seiner Brust stand R. Pulaski. Es hatte noch keine einzige Delle oder Schramme davongetragen.
Sachs wies auf den Abfall. »Zucken Sie die Achseln.«
Er zuckte die Achseln.
»Kommen Sie mit. Behalten Sie weiter den Müll im Auge.«
»Gibt es …?«
»Lächeln.«
»Ich …«
»Wie viele Cops braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?«, fragte Sachs.
»Keine Ahnung«, sagte er. »Wie viele?«
»Ich weiß es auch nicht. Das ist kein Witz. Aber lachen Sie jetzt, als hätte ich Ihnen eine tolle Pointe geliefert.«
Er lachte. Ein wenig nervös. Aber es war ein Lachen.
»Nicht aus den Augen lassen.«
»Den Abfall?«
Sachs knöpfte ihr Jackett auf. »Jetzt lachen wir nicht mehr. Wir interessieren uns für den Müll.«
»Wieso …?«
»Weiter.«
»Okay. Ich lache nicht. Ich betrachte den Müllhaufen.«
»Gut.«
Der Bewaffnete lehnte immer noch an der Hauswand. Er war Mitte vierzig, von kräftiger Statur, mit militärisch kurzer Frisur. Amelia bemerkte nun die Ausbuchtung an seiner Hüfte. Es musste sich um eine lange Waffe handeln, vermutlich um einen Revolver, denn man konnte die Trommel erahnen. »Folgendes«, sagte Sachs leise zu ihrem Kollegen. »Auf zwei Uhr steht ein Mann. Er ist bewaffnet.«
Der Neuling – mit dem Igelschopf eines kleinen Jungen, leuchtend beige wie Karamell – ließ sich zum Glück nichts anmerken. »Ist das etwa der Täter? Glauben Sie, es ist der Vergewaltiger?«
»Keine Ahnung. Ist auch egal. Vorerst stört mich nur, dass er bewaffnet ist.«
»Was machen wir jetzt?«
»Wir gehen weiter, an ihm vorbei. Dann schauen wir uns den Müllhaufen an, finden nichts von Bedeutung und machen kehrt. Sie werden langsamer und fragen mich, ob ich einen Kaffee möchte. Ich sage ja. Sie gehen herum auf seine rechte Seite. Er wird mich im Auge behalten.«
»Warum Sie?«
Wie erfrischend naiv. »Er wird, glauben Sie mir. Sie nähern sich ihm vorsichtig von hinten. Dann geben Sie einen Laut von sich, räuspern sich oder so. Er wird sich umdrehen. Dann komme ich von der anderen Seite.«
»Okay, verstanden… Soll ich, Sie wissen schon, meine Waffe ziehen?«
»Nein. Lassen Sie ihn einfach merken, dass Sie dort hinter ihm stehen.«
»Und falls er seine Waffe zieht?«
»Dann ziehen Sie ebenfalls.«
»Und falls er schießt?«
»Ich glaube nicht, dass er das wird.«
»Aber falls doch?«
»Dann schießen Sie auf ihn. Wie heißen Sie mit Vornamen?«
»Ronald. Ron.«
»Wann haben Sie bei uns angefangen?«
»Vor drei Wochen.«
»Sie werden das prima machen. Los jetzt.«
Sie gingen zu dem Müllhaufen und untersuchten ihn flüchtig, fanden dort nichts von Interesse und drehten um. Dann blieb Pulaski plötzlich stehen. »He, Detective, wie wär’s mit einem Kaffee?«
Er übertrieb es ein wenig und hätte wahrscheinlich keinen Schauspielpreis dafür bekommen, aber alles in allem war es eine glaubwürdige Vorstellung. »Ja, gern.«
Er machte zwei Schritte und hielt inne. »Wie trinken Sie Ihren Kaffee?«, rief er.
»Äh, mit Zucker«, sagte sie.
»Wie viele Stücke?«
Herrje … »Eines«, sagte sie.
»Okay. Wollen Sie auch was zu essen?«
Danke, es reicht, sagte ihr Blick. »Nein, nur Kaffee.« Sie wandte sich wieder dem Tatort zu und spürte, wie der Mann mit der Waffe ihr langes rotes Haar begutachtete, das sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sein Blick fiel auf ihre Brüste, dann auf ihren Hintern.
Warum Sie?
Er wird, glauben Sie mir.
Sachs ging weiter auf das Museum zu. Sie sah zu einem Schaufenster auf der anderen Straßenseite und orientierte sich anhand des Spiegelbildes. Als die Augen des Rauchers sich wieder auf Pulaski richteten, drehte Amelia sich um und ging auf ihn zu. Sie hatte ihre Jacke zurückgeschlagen wie ein Revolverheld seinen Staubmantel, um die Glock notfalls schnell ziehen zu können.
»Sir«, sagte sie mit fester Stimme. »Bitte lassen Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann.«
»Tun Sie, was die Lady sagt.« Pulaski stand auf der anderen Seite des Fremden und hielt die Hand in der Nähe seiner Waffe.
Der Mann sah Sachs an. »Nicht schlecht, Detective.«
»Halten Sie einfach nur die Hände still. Tragen Sie eine Waffe?«
»Ja«, entgegnete der Mann, »und zwar ein deutlich größeres Kaliber als damals im Drei-fünf.«
Mit den Ziffern war ein Revier gemeint. Der Mann war ein ehemaliger Cop.
Vermutlich.
»Sie arbeiten für einen Sicherheitsdienst?«
»Genau.«
»Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Mit der linken Hand, wenn’s geht. Die Rechte bleibt, wo sie ist.«
Er holte seine Brieftasche heraus und reichte sie Sachs. Sein Waffenschein und der Dienstausweis waren in Ordnung. Amelia ließ den Mann trotzdem per Funk überprüfen. Gegen ihn lag nichts vor. »Danke.« Sachs’ Anspannung ließ nach. Sie gab dem Mann die Papiere zurück.
»Kein Problem, Detective. Hier ist ja ganz schön was los.« Er nickte in Richtung der Einsatzwagen, die vor dem Museum die Straße blockierten.
»Wir werden sehen«, erwiderte sie zurückhaltend.
Der Wachmann steckte die Brieftasche ein. »Ich bin zwölf Jahre im Streifendienst gewesen. Dann wurde ich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt und hab’s zu Hause nicht mehr ausgehalten.« Er deutete auf das Gebäude hinter sich. »Sie werden hier eine Menge Leute mit Waffen vorfinden. Da drinnen sitzt einer der größten Edelsteinhändler der Stadt. Er gehört zur Juwelenbörse im Diamantenbezirk. Aus Amsterdam und Jerusalem treffen hier jeden Tag Steine im Wert von mehreren Millionen Dollar ein.«
Amelia warf einen Blick auf das Haus. Es sah nicht besonders eindrucksvoll aus, sondern wie ein ganz normaler Bürobau.
Der Mann lachte. »Ich dachte, dieser Job wäre ein Kinderspiel, aber ich muss genauso hart schuften wie früher als Bulle. Nun ja, viel Glück bei Ihrem Fall. Ich wünschte, ich könnte behilflich sein, aber ich bin erst nach dem ganzen Trubel hier angekommen.« Er wandte sich an Pulaski. »He, Junge.« Er wies auf Sachs. »Im Dienst und vor anderen Leuten heißt es nicht ›Lady‹, sondern ›Detective‹.«
Der Neuling musterte ihn verunsichert, aber Amelia konnte sehen, dass er die Botschaft verstanden hatte. Sachs hätte ihn selbst darauf hingewiesen, sobald sie außer Hörweite gewesen wären.
»Tut mir Leid«, entschuldigte Pulaski sich bei ihr.
»Sie haben es nicht gewusst. Jetzt wissen Sie’s.«
Was als Motto für die gesamte Polizeiausbildung gelten konnte.
Sie wandten sich zum Gehen. »Oh, he, Junge?«, rief der Wachmann.
Pulaski drehte sich um.
»Sie haben den Kaffee vergessen.« Er grinste.
Vor dem Eingang des Museums ließ Lon Sellitto den Blick über die Straße schweifen und sprach derweil mit einem Sergeant. Dann sah er das Namensschild des jungen Polizisten. »Pulaski, Sie sind als Erster am Tatort gewesen?«
»Jawohl, Sir.«
»Was war los?«
Der junge Mann räusperte sich und deutete auf eine Gasse. »Ich war auf der anderen Straßenseite, ungefähr dort, auf meiner üblichen Runde. Um etwa acht Uhr dreißig kam das Opfer, eine Afroamerikanerin im Alter von sechzehn Jahren, auf mich zu und meldete mir, dass …«
»Sie können es ruhig mit eigenen Worten beschreiben«, sagte Sachs.
»Äh … ja. Okay. Also, ich stehe da drüben, und auf einmal kommt dieses Mädchen zu mir, völlig außer sich. Sie heißt Geneva Settle, ist im dritten Jahr auf der Highschool und hat im vierten Stock an einem Referat oder so gearbeitet.« Bei diesen Worten zeigte er auf das Museum. »Und dann ging dieser Kerl auf sie los. Weiß, eins achtzig, Skimaske. Er wollte sie vergewaltigen.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Sellitto.
»Ich habe oben die Tüte mit seinen Utensilien gefunden.«
»Haben Sie hineingesehen?«, fragte Sachs stirnrunzelnd.
»Mit einem Kugelschreiber. Nur ganz kurz. Ich hab nichts angefasst.«
»Gut. Fahren Sie fort.«
»Das Mädchen konnte entwischen und ist über die Feuertreppe bis in die Gasse gelangt. Er hat sie erst verfolgt, ist dann aber in die andere Richtung verschwunden.«
»Hat jemand gesehen, wohin er danach gelaufen ist?«, fragte Sellitto.
»Nein, Sir.«
Der Detective schaute über die Straße. »Haben Sie die Absperrung wegen der Medien errichtet?«
»Ja, Sir.«
»Nun, sie ist fünfzehn Meter zu dicht dran. Schaffen Sie die Leute bloß weiter nach hinten. Reporter sind wie Blutegel. Vergessen Sie das nie.«
»Jawohl, Detective.«
Sie haben es nicht gewusst. Jetzt wissen Sie’s.
Er lief los und fing an, die Absperrung zu verlegen.
»Wo ist das Mädchen?«, fragte Sachs.
»Ein Officer hat sie und ihre Freundin zum Revier in Midtown North mitgenommen«, sagte der Sergeant, ein stämmiger Latino mit dichtem grau meliertem Haar. »Man verständigt ihre Eltern.« Die Herbstsonne spiegelte sich in seinen vielen goldenen Auszeichnungen wider. »Danach sollen die Mädchen zu Captain Rhyme gebracht und befragt werden.« Er lachte. »Die Kleine ist wirklich clever. Wissen Sie, was sie gemacht hat?«
»Was denn?«
»Sie hatte bemerkt, dass Gefahr drohte, also hat sie einer Modepuppe ihr Sweatshirt und ihre Mütze übergezogen. Der Täter ist darauf hereingefallen, und sie hat sich dadurch genug Zeit zur Flucht verschafft.«
Sachs lachte. »Und sie ist erst sechzehn? Ganz schön pfiffig.«
»Sie übernehmen den Tatort«, sagte Sellitto zu ihr. »Ich lasse die Leute befragen.« Er ging den Bürgersteig entlang zu drei Beamten – einer in Uniform, die anderen beiden in unauffälliger Zivilkleidung – und wies sie an, sich unter den Schaulustigen sowie in den umliegenden Geschäften und Bürogebäuden nach Zeugen umzuhören. Ein anderes Team sollte sich um das halbe Dutzend Straßenverkäufer kümmern, die entweder Kaffee und Donuts anboten oder gerade erst ihre Stände aufbauten, um am Mittag Hotdogs, Brezeln oder Fladenbrote mit Gyros und Falafel anbieten zu können.
Eine Hupe ertönte. Amelia drehte sich um. Aus der Zentrale in Queens war der Bus der Spurensicherung eingetroffen.
Der Fahrer stieg aus. »Hallo, Detective.«
Sachs nickte ihm und seinem Partner zu. Sie kannte die jungen Männer von früheren Fällen. Dann zog sie ihre Jacke aus, legte die Waffe ab und streifte sich einen weißen Tyvek-Overall über, um den Tatort nicht durch eigene Spurenpartikel zu verunreinigen. Danach schnallte sie sich die Glock wieder um und folgte damit der Ermahnung, die Rhyme seinen Leuten stets mit auf den Weg gab: Lass dir keine Einzelheit entgehen, aber pass auf dich auf.
»Könnt ihr mir mit dem Gepäck helfen?«, fragte sie und nahm einen der metallenen Koffer, in denen die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände zur Sicherstellung von Spuren und Beweisstücken verstaut waren.
»Na klar.« Einer der Techniker schnappte sich zwei weitere Koffer.
Amelia setzte ein Headset auf und stöpselte es in ihr Funkgerät ein. Ron Pulaski kehrte zurück und führte sie und die beiden Beamten der Spurensicherung in das Gebäude. Im vierten Stock verließen sie den Aufzug und bogen nach rechts ab, in Richtung einer Doppeltür, über der ein Schild hing, auf dem Booker T. Washington Room stand.
»Da drinnen ist der Tatort.«
Sachs und die Techniker öffneten die Koffer und packten ihre Geräte aus.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er durch diese Tür hereingekommen ist«, fuhr Pulaski fort. »Der einzige andere Ausgang ist die Brandschutztür. Sie lässt sich nicht vom Treppenhaus aus öffnen und war nicht gewaltsam aufgestemmt. Also, er kommt durch diese Tür, verriegelt sie und geht dann auf das Mädchen los. Sie kann über die Feuertreppe fliehen.«
»Wer hat dieses Schloss für Sie geöffnet?«, fragte Sachs.
»Ein Mann namens Don Barry, der leitende Bibliothekar.«
»Hat er den Raum mit Ihnen betreten?«
»Nein.«
»Wo ist er jetzt?«
»In seinem Büro im zweiten Stock. Wissen Sie, ich habe mich gefragt, ob vielleicht einer der Angestellten der Täter gewesen sein könnte. Also habe ich ihn um eine Liste aller männlichen weißen Mitarbeiter gebeten, jeweils mit Angabe des Aufenthaltsortes zum Zeitpunkt des Überfalls.«
»Gut.« Sachs hatte dasselbe vorgehabt.
»Er hat gesagt, er bringt uns die Aufstellung nach unten, wenn er fertig ist.«
»Okay, nun schildern Sie mir, was mich dort drinnen erwartet.«
»Das Mädchen hat am Mikrofilmlesegerät gesessen. Hinten rechts. Sie können es nicht übersehen.« Pulaski wies auf das andere Ende eines großen Raumes, in dem zunächst mehrere hohe Regalreihen voller Bücher standen. Dahinter erkannte Sachs eine Ausstellungsfläche mit Puppen in historischer Kleidung, mit Gemälden und Vitrinen voller alter Schmuckstücke, Handtaschen, Schuhe und Gebrauchsgegenstände – der übliche verstaubte Museumskram, den man sich anschaute und gleichzeitig darüber nachdachte, in welchem Restaurant man essen würde, sobald der Kulturhunger gestillt war.
»Was für Sicherheitsmaßnahmen gibt’s hier?«, fragte Sachs und hielt nach Überwachungskameras Ausschau.
»Gar keine. Weder Kameras noch Wachleute oder Besucherlisten. Man geht einfach rein.«
»Es wäre ja auch zu schön gewesen.«
»Ja, Ma’… Ja, Detective.«
Sachs wollte ihm sagen, dass »Ma’am« im Gegensatz zu »Lady« in Ordnung war, aber sie wusste nicht, wie sie den Unterschied erklären sollte. »Eine Frage noch. Haben Sie die Stahltür im Erdgeschoss geschlossen?«
»Nein, ich hab sie so gelassen, wie ich sie vorgefunden habe. Offen.«
»Demnach könnte der Tatort heiß sein.«
»Heiß?«
»Der Täter könnte zurückgekommen sein.«
»Ich …«
»Sie haben nichts falsch gemacht, Pulaski. Ich möchte es bloß wissen.«
»Nun, ja, ich schätze, er könnte wieder hier sein.«
»Also gut, Sie bleiben hier an der Tür und spitzen die Ohren.«
»Worauf soll ich Acht geben?«
»Tja, ob der Täter auf mich schießt, zum Beispiel. Aber mir wäre es lieber, wenn Sie vorher seine Schritte hören könnten. Oder wenigstens das Geräusch, wenn er die Schrotflinte durchlädt.«
»Sie meinen, ich soll Ihnen den Rücken freihalten?«
Sachs zwinkerte ihm zu. Dann machte sie sich auf den Weg.
Sie gehört also zur Spurensicherung, dachte Thompson Boyd und beobachtete die Frau dabei, wie sie in der Bibliothek hin und her ging, den Boden betrachtete und nach Fingerabdrücken, Hinweisen oder was auch immer suchte. Er machte sich keine Sorgen, dass sie etwas finden könnte. Er war vorsichtig gewesen, wie immer.
Thompson stand auf der anderen Seite der Fünfundfünfzigsten Straße im fünften Stock am Fenster. Nachdem das Mädchen ihm entwischt war, war er um zwei Blocks herumgeschlendert, zu diesem Gebäude gegangen und im Treppenhaus bis zu dem Flur emporgestiegen, von dem aus er nun die Straße überblickte.
Vor kurzem hatte sich ihm eine zweite Gelegenheit geboten, das Mädchen zu töten; die Kleine hatte eine Weile vor dem Museum auf der Straße gestanden und mit den Polizisten geredet. Doch es waren viel zu viele Beamte vor Ort gewesen, als dass er einen gezielten Schuss hätte anbringen und unbemerkt davonkommen können. Immerhin war es ihm gelungen, sie mit der Kamera in seinem Mobiltelefon zu fotografieren, bevor man sie und ihre Freundin in einen Streifenwagen verfrachtet hatte, der daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westen verschwunden war. Außerdem hatte Thompson hier noch etwas zu erledigen und daher an diesem Fenster Position bezogen.
Während seiner Zeit im Gefängnis hatte Thompson viel über Justizbeamte und Polizisten gelernt. Es fiel ihm leicht, die trägen unter ihnen zu erkennen, die ängstlichen, die dummen und die naiven. Auch die talentierten erkannte er auf den ersten Blick, die cleveren, diejenigen, die eine Bedrohung darstellten.
Wie die Frau, die er gerade beobachtete.
Thompson träufelte sich Medizin in die ständig gereizten Augen und ertappte sich dabei, dass er mehr über die Beamtin wissen wollte. Sie untersuchte den Tatort voller Konzentration und mit einer gewissen Andacht. Boyds Mutter hatte bisweilen mit einer ähnlichen Miene in der Kirche gesessen.
Die Fremde verschwand außer Sicht, aber Thompson behielt das Fenster im Blick und pfiff unterdessen eine leise Melodie. Dann war die Frau in Weiß wieder zu sehen. Er verfolgte, wie exakt sie vorging, wie sorgfältig sie ihre Schritte setzte, wie behutsam sie etwas aufhob und inspizierte, um das Beweisstück nur ja nicht zu beschädigen. Andere Männer hätten sich vielleicht von ihrer Schönheit oder ihrer Figur angezogen gefühlt; trotz des Overalls war unschwer zu erkennen, wie ihr Körper wohl aussehen mochte. Boyd hingegen lagen derartige Gedanken wie immer fern. Dennoch glaubte er einen Hauch von Vergnügen zu verspüren, während er die Frau bei der Arbeit beobachtete.
Er musste an etwas aus seiner Vergangenheit denken… Thompson runzelte die Stirn, sah die Frau hin und her gehen, hin und her … Ja, das war’s. Das Muster erinnerte ihn an die Gehörnten Klapperschlangen, auf die sein Vater ihn hingewiesen hatte, wenn sie gemeinsam auf der Jagd gewesen waren oder Spaziergänge unternommen hatten, damals in der texanischen Wüste am Rand von Amarillo, unweit ihres Wohnwagens.
… Vier
»Wie sieht’s aus, Sachs?«
»Gut«, teilte sie Rhyme über Funk mit.
Sie beendete soeben das Gitternetz – womit eine Technik zur Untersuchung eines Tatorts gemeint war: Man schritt das Areal ab, als würde man einen Rasen mähen, erst in senkrechten Bahnen, dann in waagerechten. Dabei beachtete man nicht nur den Boden, sondern ebenso die Decken und Wände. Auf diese Weise wurde jeder Quadratzentimeter aus verschiedenen Blickwinkeln in Augenschein genommen. Es gab auch noch andere Suchverfahren, doch Rhyme bestand stets auf dieser Methode.
»Was heißt ›gut‹?«, fragte er gereizt. Rhyme mochte keine Verallgemeinerungen oder »schwammigen« Formulierungen, wie er es nannte.
»Er hat ein paar Requisiten zurückgelassen«, erwiderte sie. Da die Funkverbindung zwischen Rhyme und Sachs hauptsächlich dazu diente, dem Kriminalisten einen unmittelbaren Eindruck der Tatorte zu verschaffen, hielten die beiden sich bei ihren Gesprächen für gewöhnlich nicht an die für den Polizeifunk gültigen Richtlinien, beispielsweise die Sprechaufforderung durch das Wörtchen Kommen.
»Ach, wirklich? Damit können wir ihn vielleicht genauso eindeutig identifizieren wie anhand seiner Brieftasche. Was denn konkret?«