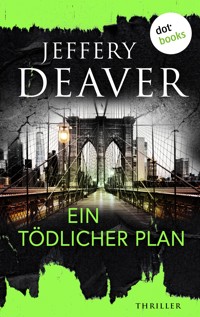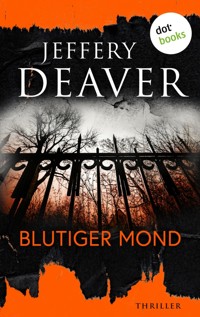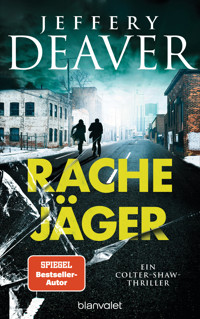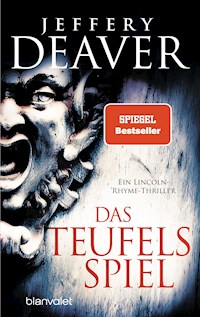1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer dunklen Seitengasse wird die Leiche eines Mannes gefunden. Sein Name ist Eduardo Rinaldo, er war ein Lieferfahrer – doch seine Ladung war oft alles andere als legal. Lincoln Rhyme und Amelia Sachs übernehmen den Fall, doch statt Jagd auf den Killer zu machen, folgen sie bald der Spur der letzten Lieferung des Ermordeten quer durch die Stadt. Irgendwo in New York City muss es ein Versteck voller sehr gefährlicher Waren geben – und Rhyme und Sachs sind nicht die Einzigen, die es um jeden Preis finden wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
In einer dunklen Seitengasse wird die Leiche eines Mannes gefunden. Sein Name ist Eduardo Rinaldo, er war ein Lieferfahrer – doch seine Ladung war oft alles andere als legal. Lincoln Rhyme und Amelia Sachs übernehmen den Fall, doch statt Jagd auf den Killer zu machen, folgen sie bald der Spur der letzten Lieferung des Ermordeten quer durch die Stadt. Irgendwo in New York City muss es ein Versteck voller sehr gefährlicher Waren geben – und Rhyme und Sachs sind nicht die Einzigen, die es um jeden Preis finden wollen.
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Tödliche Lieferung
Short Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2017 als E-Book unter dem Titel »The Deliveryman« bei CreateSpace Independent Publishing. E-Book-Ausgabe 2017 Copyright © der Originalausgabe 2017 by Gunner Publications, LLC Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Dr. Rainer Schöttle Umschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Arcangel/Reilika Landen AF · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-22100-3 V002 www.blanvalet.de
I Donnerstag, 20.30 Uhr
»Wie sieht’s aus, Sachs? Wie war der Tatort? Kompliziert? Schwierig? Unmöglich?«
Lincoln Rhyme wandte sich mit seinem motorisierten Rollstuhl von dem Computer ab, an dem er eine E-Mail gelesen hatte.
Soeben trat Amelia Sachs durch den gewölbten Eingang seines Labors am Central Park West und stellte die große graue Plastikbox, die sie mitgebracht hatte, auf einen nahen Untersuchungstisch. Das großzügig ausgestattete Labor hatte Rhyme im einstigen Salon des Hauses einrichten lassen.
Amelia zog ihre schwarze Einsatzjacke aus. Darunter trug sie blaue Jeans und ein – diesmal gebrochen weißes – T-Shirt, wie meistens, wenn sie in einen Tyvek-Overall steigen und am Schauplatz eines Verbrechens das Gitternetz abschreiten musste. Ihr hübsches Gesicht, das Antlitz eines ehemaligen Mannequins, verzog sich zu einem Lächeln. »Der Tatort? Sagen wir mal … herausfordernd. Du hast gute Laune.«
»Ja, hat er. Das ist ziemlich verwirrend«, sagte Rhymes Betreuer, der nun hinter Sachs den Raum betrat. Thom Reston, ein schlanker junger Mann, war mit einer dunkelgrauen italienischen Stoffhose und einem braungrauen Hemd wie immer tadellos gekleidet. Seit einem Unfall war Rhyme vom vierten Halswirbel an abwärts weitgehend gelähmt. Aus diesem Grund neigte er, was wenig überraschend war, zu bisweilen recht dramatischen Temperamentsausbrüchen. (Auch schon vorher, als er noch Leiter der New Yorker Spurensicherung gewesen war, war er oft mürrisch gewesen und hatte dabei ein oft unerträgliches Verhalten an den Tag gelegt, das räumte er selbst ein.) Nach Jahren in Rhymes Diensten kannte Thom die emotionale Verfassung seines Schützlings sehr gut und konnte sich ein fundiertes Urteil erlauben, ähnlich wie bei einem alten Ehepaar, wo einer die Stimmung des anderen instinktiv erfasst.
»Meine Laune dürfte für den Fall wohl kaum von Bedeutung sein. Warum auch?« Seine Augen waren auf die Kiste mit den Beweisen gerichtet, die von dem komplizierten, schwierigen und wenn schon nicht unmöglichen, dann doch herausfordernden Tatort stammten, den Sachs in Manhattan kürzlich untersucht hatte.
Der halbherzige Einwand schien Sachs zu belustigen. »Der Fall Baxter?«, fragte sie.
»Falls ich gute Laune hätte – was, wie ich erneut betonen möchte, ohne jegliche Bedeutung ist –, dann könnte das einer der Gründe dafür sein.«
Es war außergewöhnlich schwierig gewesen, die Anklage gegen Baxter aufzubauen, und diese Arbeit stellte für Rhyme eine bislang einzigartige Erfahrung dar; er konnte sich nicht entsinnen, schon jemals ein reines Wirtschaftsverbrechen verfolgt zu haben, weder zu seiner Zeit als Detective des NYPD noch in den letzten Jahren als forensischer Berater. Baxter, ein Upper Eastsider/Long Islander wurde beschuldigt, andere Upper Eastsider/Long Islander um viele Millionen Dollar betrogen zu haben (nun ja, die Opfer kamen genau genommen aus ganz New York samt Umland, gehörten aber alle zur Schicht der Reichen und Superreichen). Die meisten der Geschädigten konnten den Verlust vermutlich verschmerzen, doch ungeachtet aller sozialistischen Anwandlungen oder berechtigten Klagen über die Schere zwischen Arm und Reich darf man sich nicht einfach nehmen, was anderen gehört. Der frühere Börsenmakler und Wertpapierhändler hatte sich zunehmend raffiniertere Finanztricks ausgedacht und jahrelang unbemerkt abkassiert. Eine stellvertretende Bezirksstaatsanwältin war ihm letztendlich auf die Schliche gekommen und hatte Rhyme um Unterstützung bei der Beweislage in dem Fall gebeten. Er hatte all seine forensischen Fähigkeiten einsetzen müssen, um den Weg des Geldes zu identifizieren, die Übergabestellen, die abgelegenen Orte, an denen Münztelefone oder andere Festnetzanschlüsse benutzt worden waren, die Treffen in Restaurants und Bars und Naturschutzgebieten, die Anwesenheit an Bord von Privatjets, die relevanten Dokumente und die Kunstgegenstände, die man mit dem gestohlenen Geld erworben hatte.
Es war Rhyme gelungen, genügend Beweise für eine Verurteilung wegen Überweisungsbetrugs, schweren Diebstahls und weiterer Finanzvergehen zusammenzutragen, doch das reichte ihm nicht, und er grub weiter … mit dem Ergebnis, dass Baxter anscheinend mehr auf dem Kerbholz hatte als zunächst angenommen. Rhyme hatte Anzeichen für mindestens einen Schusswaffengebrauch gefunden und zudem eine illegale Waffe entdeckt, die in einem gemieteten Lagerraum versteckt war. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft konnten deren Einsatz keinem konkreten Opfer zuordnen; man mutmaßte, er habe irgendeinen armen Teufel mit ein oder zwei gut platzierten Schüssen aus der 45er einfach nur eingeschüchtert. Doch eine von Kugeln durchsiebte Leiche war gar nicht nötig; schon der Besitz einer Faustfeuerwaffe ohne die vorgeschriebene Lizenz stellte eine ernst zu nehmende Straftat dar. Die Staatsanwältin erweiterte die Anklage entsprechend, und heute hatten die Geschworenen den Mann in allen Punkten für schuldig befunden.
Lincoln Rhyme lebte für die – okay – Herausforderung der forensischen Arbeit, und sobald sein Beitrag zu einem Fall geleistet war, verlor er das Interesse daran. Heute jedoch hatte die Staatsanwältin ihm in ihrer E-Mail nicht nur das Urteil übermittelt, sondern auch hinzugefügt, eines der von Baxter finanziell geschädigten Betrugsopfer habe sich unter Tränen bei ihr bedankt und »auch bei allen anderen, die bei diesem Fall geholfen haben«. Der Schuldspruch erleichtere es ihr wesentlich, Baxter auf die Rückerstattung von wenigstens einem Teil des Geldes zu verklagen. Nun könne die Frau doch noch ihre Enkel aufs College schicken.
Rhyme hielt Rührseligkeit für die womöglich nutzloseste aller Emotionen, und doch freute er sich über seine Mitwirkung an Das Volk gegen Baxter. Daher die, jawohl, gute Laune.
Doch Baxter würde nun hinter Gittern verschwinden, Rhymes Auftrag war erfüllt, und daher wollte er sich wieder an die Arbeit begeben. Er erkundigte sich erneut nach dem Tatort, den Sachs vor Kurzem in Manhattan untersucht hatte.
»Das Opfer war der achtunddreißig Jahre alte Eduardo »Echi« Rinaldo, ein selbstständiger Lieferfahrer mit ordnungsgemäß angemeldetem Gewerbe«, erwiderte sie. »Doch er hat auch ein wenig auf der Straße gedealt und für die Banden transportiert, was auch immer die transportiert haben wollten, und das war nicht ganz so ordnungsgemäß: Diebesgut, Drogen und sogar illegale Einwanderer.«
»Menschliche Ware?«
»Ja. Aber immerhin lebendig, nicht tot.« Sie zuckte die Achseln. »Auch bei diesen Transporten war er selbstständig und hat für jeden gearbeitet, der gezahlt hat, aber hauptsächlich für die Latino-Gangs. Die GT hatte so gut wie nichts über ihn.«
Die Gang Task Force der Abteilung für organisiertes Verbrechen, die von der NYPD-Zentrale an der Police Plaza Nummer eins aus operierte, war unerreicht, was die Überwachung der Bandenaktivitäten im Großraum New York anging. Falls bei denen nichts gegen den verstorbenen Echi vorlag, musste der Tote wirklich eine ausgesprochen kleine Nummer gewesen sein.
»Auch die Banden haben demnach die Vorteile des Outsourcings für sich entdeckt«, sinnierte Rhyme.
»Warum Versicherungs- und Rentenbeiträge zahlen, wenn man es vermeiden kann?« Sachs lächelte und fuhr fort: »Er wurde in einer Gasse aufgeschlitzt, und das wirklich heftig. Die Waffe ist noch unbekannt, aber ich würde auf eine gezackte Klinge tippen. Halsvene und Handgelenke. Er hat noch versucht, auf die Straße zu kriechen, ist aber nicht weit gekommen. Der Gerichtsmediziner sagt, nach zwei oder drei Minuten war er verblutet.«
Der Täter musste gewusst haben, was er tat. Die weit überwiegende Zahl aller Stich- und Schnittverletzungen ist nur oberflächlich. Wenn jemand mit einer Klinge schnell töten will, muss er zielgerichtet die wichtigen Venen und Arterien angreifen.
Rhymes Augen hatten sich wieder auf die von Sachs mitgebrachte Box gerichtet. »Mehr hast du nicht gefunden?«
Es klingelte an der Tür. Thom ging hin, um zu öffnen. Sachs lachte leise auf – ein gewisser Sarkasmus lag in ihrer Heiterkeit, fand Rhyme. Und gleich darauf erkannte er den Grund dafür. Zwei Technikerinnen der Spurensicherung kamen mit Sackkarren herein, darauf insgesamt ein Dutzend verschnürter Kisten, die so aussahen wie die erste. Jede einzelne war bis zum Rand gefüllt.
»Bittet und es wird euch gegeben«, sagte Sachs.
»Das alles kommt von einem Tatort?«
»Hast du nicht was von unmöglich gesagt?«
»Aber doch nicht so unmöglich.«
Er schätzte die Zahl der am Schauplatz des Mordes an Rinaldo sichergestellten Beweise auf etwa fünfhundert. Wie jeder Kriminalist wusste, waren zu viele Spuren genauso problematisch wie zu wenige.
»Wir haben hier unter anderem Zigarettenstummel, Joint-Klammern, Einwickelfolien, Kaffeebecher, ein Kinderspielzeug, Bierdosen, Kondome, Papierfetzen und Kassenbons«, sagte sie. »Es war eine ziemlich verdreckte Gasse.«
»Meine Güte.«
Sachs begrüßte die beiden Frauen – eine Latina und eine Weiße – und zeigte ihnen die Untersuchungstische, auf denen sie die Kisten abstellen sollten. Die Latina warf Rhyme einen ehrfürchtigen Blick zu. Nur wenige der niederen Dienstränge der Spurensicherung bekamen den legendären Kriminalisten je zu Gesicht.
Rhyme nickte ihr nur kurz zu. Verehrung konnte er genauso wenig gebrauchen wie Rührseligkeit, vielleicht sogar noch weniger.
Sachs hingegen bedankte sich und erwähnte irgendein bevorstehendes geselliges Beisammensein mit einer, beiden oder sonst jemandem. Dann gingen die Frauen wieder.
Ihr Telefon summte. Sachs nahm das Gespräch an und trat ein Stück beiseite. Ihr Gesicht war ernst. Rhyme vermutete, wenngleich er sich nicht sicher war, dass es um private Dinge ging. Amelias Mutter hatte seit einer Weile gravierende Gesundheitsprobleme und musste sich demnächst einer Herzoperation unterziehen. Sachs, die sowohl beruflich als auch privat seine Partnerin war, machte der Zustand der Frau schwer zu schaffen.
Sie trennte die Verbindung. Er sah sie fragend an, doch sie schüttelte nur kurz den Kopf. Das hieß: Später. Erst der Fall. Lass uns weitermachen.
»Was wissen wir über den Ablauf des Mordes?«, fragte Rhyme.
»Rinaldo hat einen Kastenwagen gefahren. Um achtzehn Uhr hat er vor einer Bodega an der Einunddreißigsten Straße West gehalten, um sich dort Zigaretten zu kaufen. Als er wieder nach draußen kam, gab es irgendeine heftige Auseinandersetzung. Worum es dabei ging, wissen wir nicht, nur dass es ein lautstarker Streit war. Der Zeuge konnte die Worte nicht hören.«
»Ein Zeuge.« Das bedeutete Rhyme nicht viel. Er glaubte an die kalte Wissenschaft der Beweise und misstraute zutiefst den Angaben all derjenigen, die bei einem Verbrechen zugegen gewesen waren, ob nun als Beteiligte oder als Beobachter.
»Sein Sohn. Acht Jahre alt. Er hat im Wagen gesessen und gewartet.«
»Er hat demnach alles mit angesehen.« Rhyme konnte widerwillig akzeptieren, dass ein Augenzeuge des unmittelbaren Geschehens in der Lage sein könnte, den Ermittlern weiterzuhelfen – sofern diese angemessen skeptisch blieben.
Doch Sachs sagte: »Nein. Der Mord wurde im hinteren Teil einer Gasse neben dem Geschäft verübt. Der Junge ist erst später aus dem Führerhaus des Wagens ausgestiegen. Er sagt, er habe eine Gestalt – vermutlich männlich und mit Mütze, aber das war es auch schon – aus der Gasse auf die Straße laufen gesehen, und zwar hinter dem Lieferwagen. Dann habe der Mann ein Taxi herangewinkt, und ein ganz normales Auto habe angehalten. Also ein Privattaxi.«
»Sonst noch etwas?«
»Bis jetzt nicht. Ein paar Detectives hören sich um, aber ich rechne nicht mit weiteren Erkenntnissen.«
Private Taxifirmen waren oftmals ohne Lizenz tätig und führten kaum Buch über ihr Geschäft. Die Eigentümer und Fahrer arbeiteten nur ungern mit der Polizei zusammen, denn sie agierten in einer gesetzlichen Grauzone. »Aber der Junge – er heißt Javier – glaubt, er habe gehört, wie der Täter zu dem Fahrer gesagt hat: ›Im Village‹. Den Rest konnte er nicht verstehen. Dann ist der Wagen losgefahren.«
Greenwich Village erstreckte sich über Dutzende Quadratkilometer. Ohne nähere Erkenntnisse, um den Zielort einzugrenzen, hätte der Killer auch »Connecticut« sagen können. Oder »Neuengland«.
»Eines dabei ist komisch«, sagte Sachs. »Wenn man bedenkt, dass Rinaldo Transporte für die Gangs erledigt hat – wie kann dann sein Mörder mit dem Village zu tun haben?«
Das bunte und skurrile Viertel war noch nie für Bandenaktivitäten bekannt gewesen, obwohl sich dort ursprünglich vor allem italienische Einwanderer niedergelassen hatten. Die Familien des organisierten Verbrechens wohnten und arbeiteten jedoch andernorts, nämlich in Little Italy – südlich der Houston Street – und in Brooklyn sowie, bis zu einem gewissen Ausmaß, in der Bronx. Die heutigen »kriminellen« Bewohner der Mulberry Street oder der Vierten Straße West arbeiteten an der Wall Street für all die Banken und Maklerfirmen, die nach dem Motto »Wir sind zu groß als dass man uns bankrott gehen lassen könnte« ihre Geschäftstätigkeiten ausübten.
Rhyme musterte die Beweismitteltüten und -behältnisse, die Sachs gefüllt hatte. Die Gegenstände darin würden ihnen vielleicht verraten, wohin genau ins Village der Täter gefahren war – sofern überhaupt eine berufliche oder private Verbindung dorthin bestand und er nicht bloß gut zu Abend essen oder einen ausgefallenen Cocktail trinken wollte; auch Mörder lasen mittwochs die Gastronomiebeilage der New York Times.
»Es war kein Raubüberfall?«
»Nein. Das Schloss hinten am Lieferwagen war intakt und der zugehörige Schlüssel in Rinaldos Jacke. Das Bargeld in seiner Brieftasche – immerhin mehrere Hundert Dollar – wurde nicht angerührt. Falls er noch etwas anderes bei sich hatte, wieso sollte der Täter es ihm abnehmen, das Geld aber zurücklassen?«
»War etwas im Wagen?«
»Nein, der war leer. Und es gab weder ein Fahrtenbuch noch eine Lieferliste. Was auch immer seine Ladung an jenem Tag gewesen sein mag, er hat sie abgeliefert. Der Verkäufer in der Bodega – der den Täter nicht gesehen haben will – behauptet, es habe noch eine Zeugin gegeben, eine Frau auf der anderen Straßenseite. Aber ich konnte sie nicht finden. Nach ihr wird derzeit auch gesucht.«
»Wo, zum Teufel, bleibt Mel Cooper?«, murrte Rhyme. Er hatte den Kriminaltechniker angerufen und um seine Hilfe bei der Analyse gebeten. Das war vor einer halben Stunde gewesen, und obwohl Cooper gesagt hatte, er würde etwa sechzig Minuten benötigen, wurde Rhyme allmählich ungeduldig.
Sachs ersparte sich jeden Kommentar. Sie steckte ihr Haar hoch und schob es unter eine Chirurgenhaube. Dann zog sie Latexhandschuhe über, gefolgt von einer Schutzbrille und einem Mundschutz. Gemäß Rhymes Anweisung ordnete sie die Beweise nach den Stellen, an denen sie am Tatort gesichert worden waren.
Und es waren viele.
»Javier war ziemlich verstört«, sagte Sachs, während sie die Funde sortierte.
»Wer?«
»Der Sohn. Rinaldos Sohn.«
»Kein Wunder. Das war doch zu erwarten. Ist er bei seiner Mutter?«
»Es gibt keine Mutter.« Wegen des Mundschutzes konnte Rhyme nicht sehen, ob sie lächelte, als sie hinzufügte: »Ich habe ihn gefragt, ob er eine Mutter hat. Er hat geantwortet: ›Jeder hat eine Mutter.‹ Dann hat er gesagt, sie habe ihn und seinen Vater schon vor Jahren verlassen. Für heute Nacht konnte ich ihn bei der Kinder- und Jugendhilfe unterbringen. Morgen wird er als Notfall vorübergehend in Pflege gegeben. Ich habe mich freiwillig für die Fahrt gemeldet.«
»Warum?«