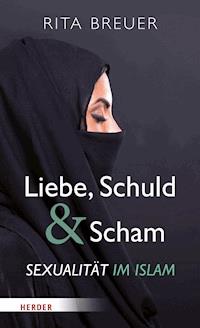1. Let’s talk about Sex – im Islam
2. Nähert euch nicht der Unzucht – grundlegende Aspekte islamischer Sexualmoral
3. Der Geschlechtstrieb erwacht: Jugend und Pubertät
4. Beschneidung und Brustvergrößerung – Eingriffe in den Körper
5. Jungfräulichkeit weg – was nun?
Hymen-Rekonstruktion – das Geschäft mit der Wiederherstellung der Jungfräulichkeit
6. Die Ehe – Allheilmittel gegen Unzucht
7. Sexuelle Praktiken zwischen erlaubt und verboten
8. Sexualität und Fortpflanzung
9. Sexuelle Gewalt
10. Was nicht sein darf, das nicht kann sein?
11. Sonderformen im islamischen Extremismus
12. Sexualmoral in der innerislamischen Diskussion
1. Let’s talk about Sex – im Islam
Sexualität ist ein ebenso eigenes wie interessantes Thema, tabuisiert und doch irgendwie immer und überall präsent. Für das Verständnis muslimischen Lebens ist sie ein Schlüsselthema, denn kaum etwas prägt so sehr und so nachhaltig die islamische Ethik und Rechtslehre, das Leben von Individuum, Familie und Gesellschaft, die Möglichkeiten und Grenzen der Integration, aber auch den politischen Islam mit seinen legalistischen und militanten Ausprägungen wie die Sexualität.
Der Islam ist per se eine mit zahlreichen Regeln behaftete Religion, die das Leben der Gläubigen im religiös-rituellen Bereich, aber auch im Alltag, im Umgang in Ehe, Familie und Gesellschaft wie in Fragen der öffentlichen Ordnung gestaltet. Persönliche wie politische Spielräume gibt es streng genommen nur dort, wo die Religion keine verbindlichen Regeln vorgibt. Die normativen Quellen des Islams – Koran und Sunna – enthalten somit auch zahlreiche Hinweise auf das regelgerechte Sexualverhalten der Menschen, die von Rechtsgelehrten mit Ratschlägen und Fatwas an die Gläubigen ausgelegt und weitergedacht werden und in einem umfassenden einschlägigen Verhaltenskodex münden, der insbesondere im persönlichen Umgang der Geschlechter innerhalb und außerhalb der Ehe zu beachten ist und über dessen Einhaltung Familie und Gesellschaft, gelegentlich aber auch staatliche Stellen wachen.
Auf der einen Seite steht das positive Bekenntnis zur grundsätzlich zu bejahenden und zwingend auszulebenden menschlichen Sexualität, die als gute Gabe Gottes der Fortpflanzung wie dem Vergnügen der Menschen dient. Ein Verzicht auf gelebte Sexualität erscheint abwegig bis unmöglich und noch dazu als Verweigerung gegenüber der göttlichen Schöpfungsordnung.
Gleichzeitig bedarf es umfangreicher Maßnahmen, um den so ausgeprägten Geschlechtstrieb zu kontrollieren, denn nichts ist schlimmer als Zina – Unzucht – Sex außerhalb der Ehe. Damit es so weit erst gar nicht kommt, muss alles vermieden werden, was zur Unzucht führen könnte. Je nach Strenge der Auslegung kann es hier um ungestörte Zweisamkeit, den Austausch von Zärtlichkeiten oder auch bereits den Blickkontakt oder das Händeschütteln mit dem anderen Geschlecht gehen, das Telefonieren oder die Klassenfahrt.
Eine Fülle von sozialen und rechtlichen Regeln sowie Mechanismen sozialer Kontrolle ist dazu angetan, ein regelgerechtes Sexualleben sicherzustellen und abweichendes Verhalten insbesondere von Mädchen und Frauen zu vermeiden. Hierzu zählt die im traditionellen Milieu noch recht strenge Trennung der Geschlechter, insbesondere aber die Kleiderordnung, die gewährleisten soll, dass die weiblichen Reize nicht zu unsittlichen Gedanken oder gar Handlungen reizen. In der Folge werden unter anderem gemischter Sport- und Schwimmunterricht, die Teilnahme an Klassenfahrten, die Teilnahme muslimischer Jugendlicher am sozialen Leben ihrer Altersgenossen und vieles mehr infrage gestellt. In allen Fällen geht es um das eine: die Aufrechterhaltung der islamischen Ordnung in Fragen der Sexualmoral, die in religiös orientierten Familien im Konfliktfall allemal höher bewertet wird als beispielsweise Bildung und soziale Integration. Auch die im westlichen Denken so wertvolle Autonomie und Selbstbestimmung kann sich allenfalls in den von der Religion gesetzten Regeln bewegen und ist diesen unterzuordnen.
Dabei ist das regelgerechte Sexualverhalten insbesondere von Mädchen und Frauen so zentral für die Beurteilung ihrer Moral und Frömmigkeit, dass jedes noch so kleine Zuwiderhandeln offenbar durch kein noch so großes Engagement in anderen, von der Religion für wichtig erachteten Bereichen wettgemacht werden kann. Der Zustand ganzer islamischer Gesellschaften wird maßgeblich an der sichtbaren Einhaltung islamischer Sexualmoral festgemacht. In der Auseinandersetzung mit dem Westen nimmt die Werbung für eine strenge Auslegung islamischer Kleidervorschriften, eine vermehrte Abschottung der Frauen und die Aufgabe jeder sexuellen Selbstbestimmung deutlich zu. Angesichts der großen Anzahl von Muslimen, die als Minderheiten in kulturell anders geprägten Gesellschaften leben, werden partielle Lockerungen im Umgang der Geschlechter und im Umgang mit den strikten Normen islamischer Sexualmoral vom konservativen Mainstream-Islam bis hinein in alle Strömungen des Islamismus als westliche Einflussnahme und Einfallstor des Teufels bekämpft.
Durch die strenge Moral entstehen zahlreiche Doppelbödigkeiten, indem abweichende und unerwünschte Verhaltensweisen mal verteufelt, mal schlicht geleugnet werden: heimliche Beziehungen, häufig mit »ausweichenden« Sexualpraktiken wie Analverkehr zur Vermeidung von Schwangerschaft und Entjungferung, Homosexualität, sexueller Missbrauch, Pornographie, Prostitution. Was nicht sein kann, das nicht sein darf, und wenn es gar nicht zu übersehen ist, dann ist es sicher dem Wesen nach zutiefst unislamisch, möglicherweise Teil einer Verschwörung, die den Islam vernichten will. Die Folgen dieser Vogel-Strauß-Politik sind erheblich: Präventionsprogramme beispielsweise gegen Aids sind in mehrheitlich muslimischen Ländern kaum durchführbar, da eben die meisten »Risikoverhaltensweisen« schlicht ignoriert werden. Ganze Bevölkerungsgruppen wie Homosexuelle oder Prostituierte werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und leben häufig mit großer Angst oder gar außerhalb der Legalität. Opfern sexueller Gewalt wird jede Hilfe versagt, indem man das Thema schlicht ignoriert oder das Opfer zum Täter macht. Doch auch im militanten Jihad ist Sex ein Thema: als Mittel der besonderen Unterstützung und Ermutigung der Kämpfer bis zur Legitimation von Versklavung zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung.
Die vielschichtigen Aspekte islamischer Sexualmoral und ihrer Umsetzung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, islamischer Werteordnung und westlicher Welt, Integration und Parallelgesellschaft sollen im Rahmen dieses Buches beleuchtet werden. Es ist kein Blick in muslimische Betten, sondern auf die vielen Aspekte des islamischen Normensystems, die sich um das Thema Sex drehen.
Manch einer mag jetzt die Relevanz der religiösen Normen für das reale Leben infrage stellen. Die Diskrepanz einer Weltanschauung zwischen Theorie und gelebter Praxis kann ja bisweilen groß sein. Wie relevant sind also tatsächlich die Vorgaben der Religion für das Sexualleben der Musliminnen und Muslime? Werden sie als Handlungsanweisungen angenommen und umgesetzt, oder schreiben die vielen Religionsgelehrten, die sich mit besonderem Eifer dieser Thematik annehmen, an der Lebensrealität vorbei? Natürlich liegt die Antwort irgendwo dazwischen, wenngleich sie eine große Nähe zur tatsächlichen Relevanz der religiösen Regeln in diesem Bereich aufweist. Für die islamische Welt gilt zunächst in fast zu verallgemeinernder Form, dass das islamkonforme Sexualverhalten beider Geschlechter, in besonderer Weise aber der Mädchen und Frauen, als in die Zuständigkeit der Gesellschaft oder auch des Staates fallend angesehen wird. Wo beispielsweise die islamische Kleidung der Frau staatlicherseits gefördert oder gar verordnet wird, macht man sich ein Geschlechterbild zu eigen, das im Islam verwurzelt ist. Die hier so oft betonte Freiwilligkeit des Kopftuchtragens beispielsweise spielt in solchen Kontexten gar keine Rolle. Es geht nicht um die individuelle Freiheit der Lebensgestaltung, sondern um die Einhaltung und Durchsetzung der religiösen Normen, die für alle gelten sollen. Was diesbezüglich der Staat nicht regelt und sanktioniert, erledigen Familie und Gesellschaft, die mit Argusaugen darüber wachen, dass es keine unerlaubten Kontakte zwischen den Geschlechtern gibt, Mädchen sich sittsam und zurückhaltend verhalten und auf ihre Jungfräulichkeit bedacht sind, unerwünschte Personengruppen wie Homosexuelle und Prostituierte ignoriert oder geächtet werden und vieles mehr. Die vielen Erfahrungen und Berichte aus diesem Bereich stellen keine bedauerlichen Einzelfälle dar, sondern sind die Regel und prägen das Leben der überwältigenden Mehrheit der Muslime. Natürlich sind diese nicht alle damit einverstanden, jedoch muss jedes von der Norm abweichende Verhalten gerade im Bereich der Sexualität heimlich geschehen, mit der steten Angst vor Entdeckung und Bestrafung. Auch wenn die mehrheitlich muslimischen Länder sich heute hinsichtlich ihrer Islamauslegung und Orientierung an der Scharia unterscheiden, ist bei unserem Thema eine allzu große Differenzierung leider unangebracht. Auch in Staaten, die in weiten Teilen eine westliche Gesetzgebung übernommen haben und beispielsweise schon lange und dezidiert auf die Anwendung des islamischen Strafrechts verzichten, gilt im Bereich Frau, Familie, Ehre und Sexualität der Islam, und das selbst bei Menschen, die eigentlich nicht sonderlich religiös sind. Über westliche Kleidung, die Vernachlässigung der religiösen Pflichten, ja selbst ein gelegentliches Feierabendbier lässt sich eher hinwegsehen als über den drohenden Ehrverlust durch das Sexualverhalten der Tochter, Schwester oder Ehefrau.
2. Nähert euch nicht der Unzucht – grundlegende Aspekte islamischer Sexualmoral
Ohne Sex geht es nicht!
Es gibt Menschen, die auch nach Erreichen der Geschlechtsreife langfristig oder sogar auf Dauer ohne Sex leben. Es können dies beispielsweise Priester, Ordensleute, buddhistische Nonnen und Mönche sein, Personen, die aus religiösen Gründen ein solches Leben wählen. Es können Menschen sein, denen einfach nicht der richtige Partner bzw. die richtige Partnerin begegnet ist und die deshalb allein leben. Betroffen hiervon sind neben vielen Einzelfällen auch beispielsweise Frauen der Nachkriegsgeneration in großer Zahl, in der die Männer einer bestimmten Altersgruppe stark dezimiert waren. Und schließlich gibt es Menschen, die sich selbst als asexuell empfinden und beschreiben, die kein Verlangen nach Sex haben oder die Vorstellung gar unangenehm oder bedrohlich finden. Die Antwort des Islams ist in all diesen Fällen fast unisono ablehnend.
Ein freiwilliger oder erzwungener Verzicht auf gelebte Sexualität erscheint als widernatürlich und Verstoß gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Menschen, die ohne Sex leben, begegnet man mit einer Mischung aus Argwohn, Skepsis und Mitleid. Im Koran wird das Mönchtum, womit hier der Zölibat gemeint ist, ein einziges Mal erwähnt und als menschliche Erfindung eingeordnet, die sich in der Praxis nicht durchhalten lässt:
»Hierauf ließen wir hinter ihnen her unsere (weiteren) Gesandten folgen. Und wir ließen Jesus, den Sohn der Maria, folgen und gaben ihm das Evangelium, und wir ließen im Herzen derer, die sich ihm anschlossen, Milde Platz greifen, Barmherzigkeit und Mönchtum. Sie brachten es (von sich aus) auf. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben. (Sie haben es) vielmehr (von sich aus) im Streben nach Allahs Wohlgefallen (auf sich genommen). Doch hielten sie es (nachdem sie es erst einmal auf sich genommen hatten) nicht richtig ein. – Und wir gaben denjenigen von ihnen, die (an die Wahrheit der ihnen übermittelten Offenbarung) glaubten, ihren Lohn. Aber viele von ihnen waren Frevler.«2
Dieser Koranvers nimmt ganz offensichtlich Bezug auf die ehelos lebenden christlichen Mönche in Mohammeds Umfeld. Ihm, der den Frauen so außerordentlich zugetan war, war diese Form der Enthaltsamkeit fremd und möglicherweise geradezu unheimlich. Und so prägte er den berühmten Ausspruch: »Es gibt kein Mönchtum im Islam.« Konkret soll dies die Antwort auf die Klage einer Frau gewesen sein, die sich beim Propheten über die übertriebene sexuelle Zurückhaltung ihres Mannes beschwerte. Doch werden die Worte ganz generell als Absage an grundsätzliche sexuelle Enthaltsamkeit mit dem Ziel der totalen und ausschließlichen Gotteshingabe gewertet. Abweichende Einzelmeinungen sind ausgesprochen selten, insbesondere, wenn es um das Leben der Muslime selber geht. Vereinzelt gab es unter den Mystikern auch Personen und Strömungen, die die Ehelosigkeit als Teil ihres spirituellen Lebens betrachteten, so die berühmte Mystikerin Rabia, die im 8. Jahrhundert ihre Verheiratung ablehnte, um sich ganz auf Gott konzentrieren zu können. Von der Orthodoxie wurde dies stets als widernatürlich und dem göttlichen Schöpfungsauftrag konträr abgelehnt. Ordensstand und Zölibat als christliche Formen Gott geweihter Keuschheit wird mit Skepsis, teils aber auch mit einer gewissen Achtung begegnet. Dort, wo das interreligiöse Klima noch nicht durch den politischen Islam vergiftet ist, bewundern viele Muslime die große Hingabe und Selbstaufopferung von Priestern und Ordensleuten, die häufig in den Feldern von Gesundheit und Bildung auch im Dienste der Muslime tätig sind und hier vielfältige Berührungspunkte haben. Unterstellungen, sie würden diesen Lebensstil nur vorgeben und in Wahrheit gar nicht durchhalten, hört man hier eigentlich nicht. Gegenüber den eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern allerdings, die allein, das heißt getrennt von Herkunftsfamilie ohne Ehepartner, leben wollen, ist man da deutlich skeptischer. Dass diese sich ohne die stete Kontrolle durch das familiäre Umfeld der moralischen Anfechtungen erwehren und – vorübergehend bis zur Ehe – ein Leben ohne Sex führen könnten, erscheint quasi unmöglich. Es ist dies der sehr einfache Grund, warum das Alleinleben insbesondere von jungen Erwachsenen bis heute kaum akzeptiert wird und nur äußerst selten vorkommt.
Die Sexualität im Rahmen einer Ehe auszuleben ist als natürliche Bestimmung des Menschen ein Recht und – mehr noch – eine Pflicht. So kann und darf es aus muslimischer Sicht diejenigen Menschen, die ohne Sex leben, weil sie einfach nicht den richtigen Partner gefunden haben, nicht geben. So etwas kann passieren, wenn man die Partnersuche dem Zufall oder der individuellen Verantwortung überlässt. Die Wahl des richtigen Ehepartners, den Gott für jeden Menschen bereithält, wird also aus gutem Grund als familiäre und gemeinschaftliche Aufgabe angesehen, und die Gemeinschaft lässt diesbezüglich niemanden zurück. Gelegentlich zieht dieses Versprechen auch junge Konvertitinnen und Konvertiten an, die Probleme haben, mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen und den passenden Partner zu finden. Haben sie erst den Islam angenommen, bereitet die Gemeinschaft ihrem Alleinsein ein Ende. Und dort, wo beispielsweise nach Kriegen die weibliche Bevölkerung deutlich zahlreicher ist als die männliche, schafft die Polygamie einen Ausweg, durch den niemand ohne Ehe, Sex und Nachkommen bleiben muss. Dass hierzulande so viele inzwischen hoch betagte Frauen infolge des Krieges unverheiratet blieben und heute allein und kinderlos alt werden, ist aus dieser Perspektive eine Folge der westlichen Verweigerung der Polygamie. Ihr gottgegebenes Recht auf Ehe, Sex und Kinder wurde ihnen vorenthalten; stattdessen waren sie beständig der Gefahr der Unzucht ausgesetzt.
Und was ist mit denjenigen, die kein Verlangen nach Sex empfinden? Vereinzelt wenden sich auch zu diesem Thema Betroffene an die Gelehrten und offenbaren ihre Not in einer Gesellschaft, die ein Leben ohne Sex nicht akzeptiert. Einer jung verheirateten Frau, die den Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann als lustlos erlebt, wird empfohlen: »Der Geschlechtsverkehr und der Geschlechtstrieb gehören zur natürlichen Veranlagung der meisten Menschen – ja sogar der Tiere –, um die Nachkommenschaft und die Menschheit – sowie das Tierreich – zu erhalten. Wer sich davon abwendet und sich zurückhält, ist vielleicht krank. So sollte sie sich behandeln lassen und nach Heilung suchen. Für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel. Allah sandte für jede Krankheit ein Heilmittel herab, das manche kennen und manche nicht. Sie sollte also, wenn es nicht anders geht, eine Psychologin aufsuchen. […] Eine Heilmethode wäre auch die islamische Ruqya (Heilung durch Quranrezitation).«3
Ratsuchende, die nach eigenem Bekunden kein sexuelles Verlangen spüren und teilweise bekennen, der Gedanke an Sex ekle sie an, werden auf das Vorbild des Religionsstifters verwiesen, der dem Liebesleben große Bedeutung beimaß. Mohammed heiratete im Jahr 695 n. Chr. etwa fünfundzwanzigjährig seine erste Ehefrau Khadija, die nach der Überlieferung fünfzehn Jahre älter war als Mohammed. Khadija war bereits zweimal verheiratet gewesen, also sexuell nicht ganz unerfahren. Ob Mohammed voreheliche Kontakte zu Frauen hatte, ist nicht bekannt, aus muslimischer Sicht auf jeden Fall zu verneinen. Trotz ihres schon fortgeschrittenen Alters gebar Khadija ihm sieben Kinder, von denen vier Töchter erwachsen wurden; sie sollten die einzigen Kinder Mohammeds bleiben, die nicht in frühen Jahren starben. Khadija war die Erste, die der Botschaft Mohammeds Glauben schenkte und ihn in dem Bewusstsein stärkte, der Prophet Gottes für die Araber zu sein. Als Inhaberin eines Karawanenunternehmens hatte sie Mohammed einst in ihren Dienst genommen und war ihm nicht nur moralisch, sondern auch wirtschaftlich eine große Stütze. Bis zu ihrem Tod im Jahr 619 blieb sie seine einzige Ehefrau. Danach allerdings heiratete Mohammed zahlreiche weitere Frauen, vermutlich insgesamt dreizehn, wobei er teilweise bis zu neun Ehefrauen gleichzeitig hatte. Ein eigener Koranvers erlaubte ihm im Unterschied zu den anderen Gläubigen die zulässige Gesamtzahl von maximal vier Ehefrauen zu überschreiten. Aus muslimischer Perspektive dienten diese Ehen vornehmlich der Versorgung von Kriegswitwen, doch gab es auch solche, die seiner besonderen Zuneigung geschuldet waren. Neben seinen Ehefrauen machte Mohammed Gebrauch vom Konkubinat, der islamrechtlich erlaubten sexuellen Beziehung des Herrn zu seiner Sklavin, und hatte mehrere sogenannte Beischläferinnen. Diese von den Muslimen im alten Arabien vorgefundene Institution fand zunächst Eingang in die neue Religion und legitimierte im Kriegsfall die Versklavung von Menschen als Kriegsbeute und, sofern es sich um Frauen handelte, die Möglichkeit, sexuell mit ihnen zu verkehren. Alles in allem zeigt also der in allem vorbildhafte Prophet, dass ein intensives Sexualleben innerhalb der Grenzen des Islams nicht nur erlaubt, sondern gut und empfehlenswert ist. Was aber der Religionsstifter offenbar ausgiebig praktizierte, kann doch, so die Gelehrten, nicht abstoßend oder gar eklig sein, nicht objektiv, aber eben auch nicht subjektiv im Empfinden einzelner Menschen. Ehe und Sexualität abzulehnen ist somit ein widernatürliches und sündhaftes Verhalten.
Der Handschlag und andere Wege zur Unzucht
Im Mai 2016 stand ein Arzt aus Bergisch Gladbach vor Gericht. Er hatte die Behandlung einer muslimischen Patientin verweigert, die ihn in Begleitung ihres Ehemannes aufsuchte und sich weigerte, dem Arzt die Hand zu geben. Dies, so die Frau, verstoße gegen die Auflagen ihrer Religion. Der Arzt sah daraufhin das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört und wollte die Frau nicht mehr behandeln. Ein Notfall, der ihn ungeachtet der Umstände dazu verpflichtet hätte, lag nicht vor. Der Ehemann aber klagte auf 2000 Euro Schmerzensgeld wegen Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip. Die Frage des Händeschüttelns hat in jüngerer Zeit vermehrt den Weg in die öffentliche Diskussion gefunden, beispielsweise nachdem sich Anfang 2016 zwei muslimische Schüler einer Sekundarschule im schweizerischen Therwil aus religiösen Gründen weigerten, ihrer Lehrerin die Hand zu geben. Niemand, so die Jungen im Alter von vierzehn und sechzehn Jahren, könne sie zu dieser Berührung zwingen. Die Schulleitung erteilte ihnen zunächst Dispens und zog eine Welle der Empörung auf sich – aus der Schweizer Öffentlichkeit, aber auch von moderaten und fortschrittlichen Muslimen, die diese Aushöhlung eines Rituals der Höflichkeit nicht zulassen wollten. Der Vater der beiden Jugendlichen ist dabei kein Geringerer als der amtierende Imam der Faysal-Moschee in Basel und wird von seinen konservativen bis streng konservativen Anhängern ob seiner Konsequenz und Glaubensstrenge gefeiert. Letztlich entschied die zuständige Schulbehörde, die generelle Verweigerung des Handschlags sei unzulässig, vielmehr seien Schulen berechtigt, diese kulturell verwurzelte Geste der Höflichkeit zur Begrüßung und Verabschiedung einzufordern.
»Und nähert euch nicht der Unzucht. Sie ist etwas Schändliches, und sie ist ein übler Weg.«4 Diese Empfehlung des Korans wird im konservativ muslimischen Milieu auf jede Berührung des anderen Geschlechtes – außer in der Ehe oder bei enger Verwandtschaft – und damit auch auf den Handschlag bezogen, der als Vorstufe der Unzucht zu meiden ist. In den letzten Jahren hatten bereits gelegentlich Gallionsfiguren aus der salafistischen Szene wie Hassan Dabbagh und Pierre Vogel von sich reden gemacht, weil sie als Gäste bei Talkshows der Gastgeberin nicht die Hand geben wollten. Dies wurde im Namen der interreligiösen Toleranz hingenommen. Nicht so von Julia Klöckner, die die Handschlag-Verweigerung eines Imams im Rahmen des Besuches einer Flüchtlingsunterkunft im Herbst 2015 öffentlich als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz problematisierte. Aber auch in weniger prominenten Situationen kommt es immer wieder zu solchen Affronts, die das nichtmuslimische Gegenüber irritiert und brüskiert zurücklassen. Nicht jeder kommt schließlich auf die Idee, dass ein Händedruck beim Sex enden könnte.
Der Kontakt mit Angehörigen des anderen Geschlechtes außerhalb der engsten Familie soll auf das unvermeidbare Minimum reduziert werden. Nach sehr strenger Lesart sollten insofern Mann und Frau vor und außerhalb der Ehe auch nur miteinander telefonieren, wenn es sich nicht vermeiden lässt und in sehr sachlicher Form geschieht. Keinesfalls darf die Stimme verführen oder durch Flirten, Scherze oder Ähnliches unsittliche Gedanken provozieren, die unsittliches Handeln nach sich ziehen könnten. Ähnlich verhält es sich mit dem Austausch von Briefen. Was hier als nachgerade absurde Extremmeinung einer kleinen Minderheit erscheint, spiegelt sich in der Realität vieler streng-islamischer Familien wider, in denen der Vater keinesfalls dulden würde, dass die Tochter unkontrolliert mit einem fremden Mann telefoniert oder Briefe von ihm erhält.
Da aus islamischer Sicht bereits leichte Berührungen eine nicht mehr aufzuhaltende Lawine auslösen können, darf es auch zwischen Verlobten keine Form der allmählichen körperlichen Annäherung geben. Bis zur Hochzeit sind lediglich Gespräche zum gegenseitigen Kennenlernen im Beisein enger Verwandter erlaubt. Ansonsten heißt es: Abstand wahren, kein in die Augen schauen, keine Berührung, kein Händchenhalten und schon gar kein Kuss. Dies und vieles mehr versetzt nämlich die Beteiligten in einen Gemütszustand, in dem die Lage außer Kontrolle gerät, und ist somit abzulehnen. Dazu der einflussreiche Gelehrte Yusuf al-Qaradawi: »Im Bereich des Sexuellen verbietet der Islam auch, eine Person des anderen Geschlechts lange anzuschauen, denn das Auge ist der Schlüssel der Gefühle und der Blick ein Bote des Verlangens, der die Botschaft der Hurerei oder des Ehebruchs trägt.«5
In der Türkei machte es der konservativ-islamische Präsident Erdogan Anfang 2016 offiziell. Das staatlich kontrollierte Amt für Religionsangelegenheiten Diyanet ließ in einem offiziellen Rechtsgutachten verlauten, Verlobte mögen sich in dieser Phase ihres Lebens, in der weiterhin jede Form der unerlaubten Annäherung verboten ist, islamkonform verhalten. So sei jedes unbeobachtete Zusammentreffen weiterhin unerwünscht, ebenso Händchenhalten in der Öffentlichkeit oder Flirten; beides könne zu »unerwünschten Ereignissen« führen. Hier zeigt sich eine große Nähe zum extrem rigiden wahhabitisch-salafistischen Islamverständnis: »Wenn zwischen einem Mann und einer Frau eine Verlobung besteht, die Eheschließung jedoch noch nicht stattgefunden hat, so ist die Frau nach wie vor eine ihm fremde Frau. Fremd in dem Sinne, dass beide sich nur in Anwesenheit eines zur Ehe verbotenen männlichen Verwandten (Mahram) sehen dürfen. Gegen eine Unterhaltung zwischen Verlobten ist nichts einzuwenden, sofern dies notwendig ist und alle Formen der Umgarnungen und Schmeicheleien unterlassen werden. Diese Regel gilt für jedermann, ob verlobt oder nicht. Was eine Unterhaltung mit der Verlobten am Telefon oder im Chat angeht, so ist dies nach Möglichkeit zu umgehen, indem man die Angehörigen der Verlobten – wie zum Beispiel ihren Vater oder ihren Bruder – anspricht, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Sollte es dennoch zu einem Gespräch mit der Verlobten am Telefon oder im Chat kommen, so sollte man wie bereits oben erwähnt alle Formen der Umgarnungen und Schmeicheleien unterlassen. Wir betonen noch einmal, dass es sich bei den Verlobten noch nicht um Ehepartner handelt und dass sich die beiden, Gott bewahre, möglicherweise wieder trennen, wenn sie sich in einigen Dingen nicht einigen können.«6
Die Türkei ist grundsätzlich ein Land mit einer großen Spannbreite religiöser Haltungen und Lebensweisen von traditionell-islamisch über alle möglichen Zwischenstufen bis hin zu sehr liberal in einzelnen Vierteln der Großstädte. Die staatliche Religionsbehörde versucht indes mit 100000 Mitarbeitern und einem Jahresetat von über einer Milliarde Euro der konservativen Lesart des Islams à la Erdogan über alle möglichen Fragen des Lebens Gehör zu verschaffen. Das führt mal zu Anerkennung und Zustimmung, mal zu Verärgerung oder gar Gelächter. Und so verkündet Erdogan kurz nach seiner Belehrung an die Verlobten des Landes: Schluss mit lustig! Ab sofort soll es Frauen bei Strafandrohung verboten sein, in der Öffentlichkeit zu lachen oder zu lächeln, denn beides sei keine weibliche Tugend, sondern schamlos, egal ob am Strand oder in der Einkaufsstraße. Manch einer hielt das für einen Aprilscherz, doch wurde bereits Mitte 2014 in der Türkei darüber sinniert, welchen Beitrag das öffentliche Lachen von Frauen neben Fernsehserien, stundenlangen Telefongesprächen und Drogenkonsum zum allgemeinen Sittenverfall des Landes leiste. Erdogans Vize Bülent Arinc, der bis dato schon mehrfach durch sein eigentümliches Verhältnis zu Frauen aufgefallen war, äußerte seinerzeit voller Bedauern: »Wo sind unsere Mädchen, die leicht erröten, ihren Kopf senken und die Augen abwenden, wenn wir in ihre Gesichter schauen?«7
Zwischen Kopftuch und Burkini – die Bedeckung der Scham
Der ewigen Kopftuchdebatte in Deutschland sind viele Menschen längst überdrüssig. Kopftuch im öffentlichen Dienst und bei Lehrerinnen, Kopftuch in Schulen und teilweise Kindergärten, Vollverschleierung in der Öffentlichkeit. Worum es auch geht: Im weitesten Sinne haben wir es hier immer mit Geschlechterbildern und Sexualmoral im Islam zu tun, denn der islamischen Kleidung der Frau kommt eine Schlüsselrolle zur Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens zu und sie wird ausschließlich sexuell begründet.
»Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren. Das ist lauterer für sie. Gott hat Kenntnis von dem, was sie machen. Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren, ihren Schmuck nicht offen zeigen, mit Ausnahme dessen, was sonst sichtbar ist. Sie sollen ihren Schleier auf den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, es sei denn ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Trieb mehr haben, den Kindern, die die Blöße der Frauen nicht beachten. Sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit man gewahr wird, was für einen Schmuck sie verborgen tragen. Bekehrt euch allesamt zu Gott, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehe.«8 Dieser Koranvers ist Ausgangspunkt der Überlegungen zur islamischen Kleiderordnung, die durch die Bedeckung der Scham (aura) gewährleisten soll, dass es keine unerlaubten Grenzüberschreitungen zwischen den Geschlechtern gibt. Die Scham bezeichnet in diesem Fall kein Gefühl, sondern ist ausschließlich auf Teile des Körpers bezogen. Die Scham des Mannes beschränkt sich nach mehrheitlicher Überzeugung auf den Bereich zwischen Bauchnabel und Knien; streng genommen muss damit nur dieser Teil des Körpers beim Gebet sowie in der Öffentlichkeit bedeckt sein, um der Religion Genüge zu tun. Das Schamempfinden ist aber anders geprägt; so ist es in der islamischen Welt allgemein üblich, dass Männer Arme und Beine teilweise oder vollständig bedecken und weite Hosen bevorzugen. Darüber hinaus beeinflusst mancherorts das überlieferte Vorbild des Propheten die Kleidung der Männer. Die in vielen Ländern verbreitete traditionelle orientalische Männerkleidung besteht aus einem langen, weiten Gewand, das durch seinen Schnitt keine Körperkonturen erkennen lässt, häufig aber erstaunlich durchsichtig ist. Vielerorts ist es außerdem üblich, eine Kopfbedeckung und einen Bart zu tragen, wofür es aber keine religiöse Vorschrift gibt. Die zahlreicher werdenden Salafisten sehen das allerdings anders. Sie wollen sich auch in äußeren Dingen ganz an der islamischen Frühzeit und dem Vorbild Mohammeds orientieren und sind sich auch sicher, wie das aussah: eine weite Hose, die über den Knöcheln endet, ein langes weites Oberteil, Kopfbedeckung und Bart, wobei die Oberlippe meist rasiert wird. Aus ihrer Sicht ist es Pflicht des Mannes, sich so zu kleiden. Enge Jeans, Anzüge, Krawatten und dergleichen gelten hingegen als abzulehnende Kleidung der Ungläubigen.
Die Scham der Frau ist deutlich weiträumiger angelegt und erstreckt sich nach breitem Konsens auf den ganzen Körper einschließlich der Haare, aber mit Ausnahme der Hände und des Gesichts. Ob die Füße dazugehören und somit ebenfalls bedeckt werden müssen, ist umstritten. Aus dem Koran ist keine konkrete Kleiderordnung abzuleiten und schon gar keine Verpflichtung zum Kopftuch. Der Text beschränkt sich auf die oben zitierte allgemeine Aufforderung, den Schmuck zu bedecken, ohne zu konkretisieren, was damit gemeint ist. Aus der Sicht von Reformern gibt dies den Spielraum, die Kleidung dem jeweiligen sozialen und historischen Kontext anzupassen. Das aber sieht die überwältigende Mehrheit der Islamgelehrten anders und verweist auf einen erläuternden Hadith (Hadithe sind Überlieferungen über die Worte und Taten des Religionsstifters Mohammed), nach dem Mohammed seine spärlich bekleidete Schwägerin angewiesen haben soll, sich zu bedecken. Mit einem Fingerzeig auf ihr Gesicht und ihre Hände habe er sodann gesagt, nur das dürfe sichtbar sein. Hieraus rührt die Mehrheitsmeinung innerhalb des Islams, dass Mädchen ab der Pubertät und Frauen den ganzen Körper außer Gesicht und Händen vollständig bedecken sollen, und zwar möglichst in einer Weise, die keine Körperkonturen erkennen lässt. Figurbetonte oder transparente Kleidung ist vollkommen inakzeptabel.
Mit Eintreten der Geschlechtsreife findet der Begriff der Scham Anwendung, und die Kleidervorschriften treten in Kraft. Wenn also Ayshe eines Morgens mit Kopftuch in der Schule erscheint, kann man einigermaßen sicher sein, dass sie gerade ihre erste Periode bekommen hat; bisweilen werden auch die nächsten Schulferien abgewartet, damit der Wechsel nicht ganz so abrupt erscheint. Kleinen Mädchen ist das Kopftuchtragen nur bei rituellen Handlungen wie dem Gebet oder beim Koranstudium auferlegt; außerhalb dieses Rahmens dürfen sie ihr Haar und durchaus auch in einem gewissen Rahmen Arme und Beine zeigen.
Die Kleidervorschriften gelten beim Gebet und immer dann, wenn Frau und Mann mit Angehörigen des jeweils anderen Geschlechtes zusammenkommen könnten, die nicht ihre Ehepartner sind oder so enge Verwandte, dass eine Heirat ausgeschlossen wäre, in jedem Falle also in der Öffentlichkeit. Sie gelten nicht an Orten, die ausschließlich einem Geschlecht vorbehalten sind, also beispielsweise im öffentlichen Bad für Männer oder einem Schwimmbad für Frauen, noch zu Hause im engeren Familienkreis. Viele Frauen tragen aber auch hier den ganzen Tag die islamische Kleidung, sei es weil sie häufiges Umziehen vermeiden wollen, jederzeit mit Besuch rechnen müssen oder am Fenster von Fremden gesehen werden könnten. Ihrem Ehemann gegenüber ist die Frau dagegen angehalten, sich zu schmücken und ihre Reize zu betonen. So spricht nichts dagegen, wenn die Frau durch gesunde Ernährung, Diät und gymnastische Übungen ihre Schönheit zu erhalten und optimieren sucht. Ferner ist es ihr erlaubt, ja sogar empfohlen, Schmuck und edle Stoffe zu tragen und ihren Ehemann mit Parfum, Schminke und aufreizenden Dessous zu erfreuen. Was uns paradox erscheinen mag, ist Spiegel der islamischen Moral, die für das Leben in der Ehe einerseits und in der Öffentlichkeit andererseits grundverschiedene Verhaltensmaßstäbe vorgibt.
Vereinzelt und insbesondere im salafistischen Lager wird der Begriff der Scham in vierfacher Hinsicht noch weiter ausgelegt – aus allgemein muslimischer Perspektive handelt es sich in allen Fällen um unislamische Formen der Übertreibung: das Tragen von Handschuhen, der Gesichtsschleier oder der Ganzkörperschleier, der das Gesicht einschließt, die Betrachtung der weiblichen Stimme als Teil ihrer Scham und die Verschleierung kleiner Mädchen vor der Pubertät. Allen Aspekten liegt die Vorstellung zugrunde, die landläufige Praxis banne die Gefahr der außerehelichen sexuellen Annäherung nicht hinreichend, sodass man es mit der Bedeckung der Scham lieber etwas genauer nehmen sollte. Bei der Vollverschleierung bleibt lediglich ein Schlitz für die Augen, der manchmal noch durch einen Netzstoff von außen so gut wie undurchsichtig erscheint, sodass die Trägerin sich zwar orientieren, ihr aber niemand in die Augen schauen kann. Was hierzulande unter Sicherheitsaspekten gelegentlich problematisiert wird, nämlich die Nichtidentifizierbarkeit der Frau als Individuum, ist gerade beabsichtigt. Niemand außer dem Ehemann hat das Recht, seine Frau zu sehen und zu erkennen, sie ist sein Eigentum. Wenn gemäßigtere Musliminnen ihre Kopftücher häufig mit Bedacht und passend zur sonstigen Kleidung aussuchen und binden und oftmals auch an Schminke nicht sparen, setzen puritanische Milieus auf Unauffälligkeit und Einförmigkeit. Schmuck, Schminke und Parfum sind ohnehin dem Gatten vorbehalten, aber auch farbige Kleidung könnte Verwirrung stiften, sodass den Frauen geraten wird, den Ganzkörperschleier in schwarz oder allenfalls noch einer anderen gedeckten Farbe – braun, beige, dunkelblau oder dunkelgrau – zu wählen. Die in Afghanistan übliche jeansblaue Burqa ist da schon vergleichsweise gewagt. Knallige Farben und Muster sind aus salafistischer Sicht abzulehnen, ebenso der oft unter dem Kopftuch zu sehende sogenannte Kamelhöcker; gemeint ist der aufgetürmte Haarknoten, der zeigt, dass die zu bedeckenden Haare reichlich vorhanden sind. Aber auch der könnte Männer irritieren. Jede Verschönerung der Frau in der Öffentlichkeit, jedes noch so geringe Anzeichen von Individualität und Attraktivität ist unbedingt zu vermeiden.
Was für die Befürworter der Vollverschleierung maximale Tugend der Frau bedeutet, interpretieren ihre Kritiker als maximale Sexualisierung. So sagt die gebürtige Pakistanerin und Konvertitin zum Christentum Sabatina James zur Vollverschleierung: »In Pakistan habe ich eine Nikab getragen, eine Verschleierung, die nur die Augen freilässt. Muslimische Frauen, die sich verschleiern, fühlen sich, als ob sie nicht existieren. Sie haben keine Persönlichkeit, dürfen nicht gesehen werden, sie sind unsichtbar, sie sind nichts. Verhüllte Frauen nehmen am öffentlichen Leben nicht teil, werden nie angesprochen. Nur im eigenen Haus können sie kommunizieren, meist mit dem eigenen Mann und ihrer Familie. Hinzu kommen die Gründe für eine Verhüllung: Eine Frau muss nach islamischem Recht eine Burka tragen, damit der Mann durch ihre Schönheit nicht in Versuchung gerät. Das bedeutet: Frauen werden in der muslimischen Welt einzig als sexuelle Objekte behandelt, ihnen wird die Persönlichkeit und ihr Verstand abgesprochen. Und nicht wenige Musliminnen verhüllen sich, um zu zeigen, dass sie sich ihrem Mann unterwerfen. Ich meine daher, dass ein Burka-Verbot ein richtiger Schritt ist.«9
Dort, wo die Vollverschleierung der Frau propagiert wird, gilt in der Regel auch ihre Stimme als Teil der Scham, die die Männer reizen könnte. So wird dazu geraten, dass Frauen außerhalb des Hauses ihren männlichen Begleiter sprechen lassen, wenn sie aber selbst sprechen müssen, ihre Stimme senken und eventuell verstellen. Keinesfalls darf die Frau mit ihrer Stimme spielen oder sie einsetzen, um zu betören oder bestimmte Gefühle zu erzeugen. Zärtliche und schmeichelnde Worte sind nur innerhalb der Ehe und abseits der Öffentlichkeit erlaubt. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Koranvers: »Ihr Frauen des Propheten! Ihr seid nicht wie (sonst) jemand von den Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig sein wollt, dann seid nicht unterwürfig im Reden (mit fremden Männern), damit nicht (etwa) einer, der in seinem Herzen eine Krankheit hat, (nach euch) Verlangen bekommt! Sagt (vielmehr nur), was sich geziemt!«10
Und schließlich ist immer häufiger zu beobachten, dass Mädchen bereits deutlich vor der Pubertät nach strengen Vorschriften gekleidet sind und manchmal schon im Kindergartenalter Kopftücher tragen. Dieser vorauseilende Gehorsam erklärt sich wohl teilweise aus dem Bestreben, lieber zu übertreiben als etwas zu versäumen, ist aber meist eine erzieherische Maßnahme und Vorbereitung auf die später einzuhaltenden Regeln, die dann nicht abrupt von einem auf den anderen Tag in Kraft treten. Freiheiten, die man nie gehabt hat, wird man später weniger vermissen. So lernen Mädchen bereits früh, sich in ihren Bewegungen maximal einzuschränken, denn mit Kopftuch tobt und klettert es sich nun mal nicht so gut. Diese Aktivitäten sind allerdings bei Mädchen auch nicht erwünscht, nicht nur könnte – so die Angst – das Jungfernhäutchen reißen, die Mädchen könnten sich auch zu Lachen, Schreien, Rennen und Ähnlichem verleiten lassen, was der Tugend allemal nicht förderlich ist. Der Berliner Psychologe Ahmad Mansour hat in diesem Zusammenhang sehr treffend darauf hingewiesen, dass so schon Mädchen im Kindesalter zu Sexobjekten degradiert werden, die anstelle einer freien und natürlichen Entwicklung permanent mit dem korrekten Sitz ihrer Kleidung beschäftigt sind.
Die Realität islamischer Frauenkleidung ist – noch – vergleichsweise bunt und vielfältig. In Regionen, in denen es keinen staatlich oder gesellschaftlich verordneten Kopftuchzwang gibt, verzichten viele Musliminnen darauf – in Deutschland sind es etwa zwei Drittel. Rückschlüsse auf den persönlichen Grad der Religiosität lässt das nicht zu. Vielmehr gibt es zahlreiche Musliminnen, die sich als tief gläubig bezeichnen, das Kopftuch aber für unwesentlich halten und es daher nicht tragen. Sehr häufig begegnet man im Straßenbild auch Musliminnen, die ihr Kopftuch mit reichlich Makeup und engen Jeans kombinieren und ihren sehr persönlichen Weg gefunden haben, Islam und westliche Mode unter einen Hut zu bringen. Von Kritikern werden sie oft abfällig »Kopftuch-Bitches« genannt, weil sie sich bewusst und gerne auch mit Kopftuch attraktiv zeigen. Muslimische Organisationen im Westen wie auch die muslimischen Verbände und selbsternannten Interessenvertreter in Deutschland betonen gemeinhin, dass sie für die Wahlfreiheit von Mädchen und Frauen in der Kleiderfrage eintreten. Dabei fällt allerdings auf, dass weibliche Mitglieder von Funktionärinnen bis zu jugendlichen Teilnehmern an religiösen Bildungsmaßnahmen ausnahmslos traditionell gekleidet sind. Auch hier ist nicht zu vergessen, dass in konservativ-religiösen Familien eben nicht die eigene Entscheidungsfindung der Kinder im Mittelpunkt steht, sondern die Übernahme religiöser Überzeugungen und Ausdrucksformen. Ein junges Mädchen, das sich frei für oder gegen das Kopftuch entscheiden soll, muss zunächst einmal gelernt haben, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und Überzeugungen entwickeln zu können, die von denen der Eltern abweichen, und ferner das sichere Gefühl haben, dass ihre Entscheidung keine negativen Konsequenzen nach sich zieht. Dass dies in vielen Familien der Fall ist, steht außer Frage, in vielen anderen aber ist es ebenso zweifellos nicht der Fall.
In Ländern, die konsequent nach der Scharia regiert werden, ist die islamische Kleidung allerdings keine Option, sondern staatlich verordnet; Zuwiderhandlungen werden geahndet. Umstritten ist dabei, ob das Schleiergebot auch für Nichtmusliminnen gilt; unter anderem in Iran, Nordnigeria, Saudi-Arabien, Somalia und dem Gaza-Streifen ist dies längst der Fall und Ausdruck eines muslimischen Überlegenheitsgefühls, das auch Andersgläubigen die Einhaltung der Scharia in der Öffentlichkeit abverlangt.
Die lokale Kultur der einzelnen Länder, die sich jeweils mit den Werten und Normen des Islams vermischt hat, wird auch in der Kleidung deutlich sichtbar. Musliminnen in Bangladesch und Indien tragen in der Regel den gleichen Sari wie Hindus und Christinnen; ihre Glaubensschwestern im Senegal und anderen Ländern südlich der Sahara kleiden sich gerne afrikanisch bunt, Frauen, die schwere Feldarbeit verrichten müssen, kleiden sich entsprechend. Allerdings ist der Einfluss der arabischen Welt und insbesondere des saudischen Königreiches in den letzten Jahren weit über die eigenen Grenzen hinaus zu spüren. Mit der Ideologie des einen wahren und unverwechselbaren Islams, der für alles einen einzigen Maßstab hat, sagen sie von der Muslimbruderschaft bis in alle Schattierungen des Wahhabismus und Salafismus hinein jedem Lokalkolorit den Kampf an: Die Einheit aller Muslime müsse auch in äußeren Dingen wie einheitlicher Kleidung ihren Ausdruck finden. So sieht man heute auch in Indonesien oder Tansania die islamische Frauenkleidung in ihrer strengen Variante, ein Bild, das noch Mitte des 20. Jahrhunderts kaum vorstellbar war und dem Betrachter eher den Eindruck der Eintönigkeit als der Einheit vermittelt.
Dahinter steht immer wieder die Vorstellung, dass die nicht maximal bedeckte Frau unter allen Umständen als Objekt der Begierde wahrgenommen werden muss, dass also der Mann seinerseits auch gar nicht anders kann. Viele muslimische Männer wehren sich längst gegen dieses Bild des testosterongesteuerten Schwerenöters.
Die islamische Kleidung der Frau hat in der aktuellen innerislamischen Debatte einen so hohen Stellenwert wie kaum ein anderes Thema. Kein Indiz wird höher bewertet, wenn es darum geht, die moralische Orientierung einer Gesellschaft zu bemessen, als die Frage, ob die Frau ihre Haare ordnungsgemäß bedeckt und ihren Körper so verhüllt, wie es die jeweilige Lesart des Islams vorschreibt. Die Schriften über die Vorzüge des Schleiers sind nicht zu zählen und betonen durchweg, dieser sei keineswegs Zeichen der Unterdrückung, sondern vielmehr ein Schutz für die Frau, der es ihr erlaube, sich freier zu bewegen und alles zu tun, was für sie vorgesehen ist. Im Konfliktfall sind die Bekleidungsvorschriften höher zu bewerten als alles andere. Eine junge Frau, die an einer Universität studiert, die die Verschleierung der Studentinnen verbietet, erhält folgende vielsagende Empfehlung: »Das Verlassen des Hauses ohne Hidschab ist der Muslima auf keinen Fall gestattet, somit ist es auch eine Pflicht, die islamkonforme Kleidung beim Besuch der Universität zu tragen. Setzen Sie Ihr Studium an einer Universität fort, die Ihnen die Verschleierung nicht verbietet. Wenn es keine Universität gibt, die die islamische Kleiderverordnung toleriert, bleiben Sie zu Hause, solange der Universitätsabschluss nicht unabdingbar und lebensnotwendig ist. Allah, der Erhabene, wird Sie am Tag der Auferstehung nicht fragen, warum Sie Ihr Studium abgebrochen haben. Er wird Sie vielmehr fragen, wieso Sie auf die islamische Kleidung verzichteten. Das Trageverbot der islamischen Kleidung an der Universität könnte eine Prüfung von Allah sein.«11