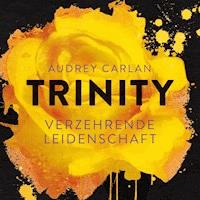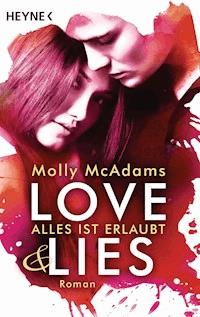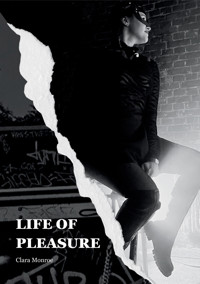
2,99 €
Mehr erfahren.
Die letzten Jahre meines Lebens waren eine Achterbahnfahrt aus emotionalen Momenten, tiefen Verlusten und mutigen Neuanfängen. Jede Erfahrung – schmerzlich oder wunderschön – hat mich auf meinem Weg begleitet, mich selbst zu finden. Das Schreiben wurde dabei zu meinem Anker, zu einer Möglichkeit, all das Chaos und die Klarheit in meinem Inneren zu ordnen. Dieses Buch ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein Stück von mir. Eine Sammlung von Erinnerungen, Gefühlen und Lektionen, die mich geprägt haben und die ich teilen möchte. Ich hatte das perfekte Leben – oder zumindest schien es so. Die perfekte Beziehung, die perfekte Familie, der perfekte Alltag. Ich war die „desperate housewife“, die alles hatte und doch nie das Gefühl, dass es genug war. Die Fassade hielt, doch tief in mir brodelte eine unstillbare Sehnsucht nach mehr – nach Freiheit, nach Erfüllung, nach mir selbst. Ich wollte nicht einfach nur die Frau an der Seite eines Mannes sein. Ich wollte ich sein. Also trat ich hinaus in die wilde, pulsierende Nacht Berlins. Eine Stadt, die niemals schläft und die sich anfühlt wie ein grenzenloser Spielplatz. Wo alles möglich ist, und nichts bleibt, wie es war. Ich verwandelte mich von der scheinbar perfekten Ehefrau in ein selbstbewusstes Citygirl auf der Jagd nach Abenteuern und Freiheit. Kinky Begegnungen, in denen der Körper spricht, wenn Worte nicht mehr ausreichen. Es war aufregend, befreiend, leidenschaftlich, und doch blieb immer diese Frage: Was kostet diese Freiheit wirklich? Die Nächte in den Clubs, das Spiel mit Masken und Verführungen, die Jagd nach Erfüllung in flüchtigen Momenten. Doch je mehr ich mich verlor, desto mehr spürte ich die Leere, die immer wieder nach mir griff. Die Suche nach mehr, nach echtem Kontakt, nach echten Gefühlen wuchs mit jeder Nacht, die ich ohne Ziel verbrachte. Der Sex, das Abenteuer, die Ekstase, sie füllten den Moment, doch was blieb danach? Was passiert, wenn all das, was man sich wünscht, plötzlich nicht mehr genug ist? Und dann traf ich die Menschen. Sie gaben mir so viel mehr, als ich erwartet hatte, und stellten gleichzeitig alles infrage, was ich über mich selbst zu wissen glaubte. Inmitten der Verlockungen und der Versuchung, in alte Muster zurückzufallen, stellt sich mir immer wieder die Frage: Kann ich mein Herz wieder öffnen, nicht nur für Lust, sondern auch für die Liebe? Zwischen den Ketten von Vergangenem und der Freiheit des Unbekannten, zwischen dem Verlangen nach Nähe und der Angst vor dem Verlust, frage ich mich: Was ist der wahre Preis der Freiheit? Und bin ich bereit, für die wahre Liebe und für mich selbst zu kämpfen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Clara Monroe
Life of Pleasure
Manchmal ist die größte Stärke, zu bleiben – und manchmal, zu gehen.
“Das Feuerwerk erleuchtet die Nacht über dem See, doch ich sehe nichts davon. Ich sehe nur ihn, nur uns, nur das, was wir einmal waren. Sein Blick durchbohrt mich, so fremd und doch vertraut, und ich frage mich: Wann hat sich alles verändert? Wie sind wir an diesen Punkt gelangt? Die Antwort ist in meinem Herz, tief vergraben unter den Schichten von Schuld, Liebe und dem Drang, loszulassen – oder zurückzuholen, was längst verloren ist.”
Die letzten Jahre meines Lebens waren eine Achterbahnfahrt aus emotionalen Momenten, tiefen Verlusten und mutigen Neuanfängen. Jede Erfahrung – schmerzlich oder wunderschön – hat mich auf meinem Weg begleitet, mich selbst zu finden. Das Schreiben wurde dabei zu meinem Anker, zu einer Möglichkeit, all das Chaos und die Klarheit in meinem Inneren zu ordnen.
Dieses Buch ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein Stück von mir. Eine Sammlung von Erinnerungen, Gefühlen und Lektionen, die mich geprägt haben und die ich teilen möchte.
Kapitel 1 I Mein Traum
Ich sitze am Küchentisch, die Hände um eine dampfende Tasse Tee gelegt, und lasse die Erinnerungen an meine Kindheit durch mich strömen. Unser Zuhause – ich sehe es vor mir, als wäre ich wieder dort: warm, vertraut, voller Liebe. Es war ein Ort, an dem ich mich immer sicher fühlte. Meine Eltern, beide aus demselben kleinen Dorf, waren ein Team, das durch Freundschaft und Liebe verbunden war. Sie kannten sich schon als Kinder, verliebten sich später als Teenager ineinander und blieben ein Leben lang zusammen.
Ihre Geschichte war wie aus einem Buch, das ich früher so gerne las: Mit 27 heirateten sie, und zwei Jahre später kam ich auf die Welt. Fünf Jahre danach wurde unsere Familie durch meine Schwester komplett – wie durch ein Wunder genau fünf Jahre und fünf Tage nach meinem Geburtstag. Eine kleine Schwester zu haben, war eine ständige Achterbahnfahrt. Ich liebte sie, manchmal hasste ich sie, aber vor allem waren wir untrennbar. Wir teilten Geheimnisse, lachten bis spät in die Nacht und stritten uns genauso leidenschaftlich wie wir uns wieder vertrugen. Diese Dynamik hat mich geprägt – in guten wie in schwierigen Zeiten.
Eine meiner liebsten Erinnerungen bringt mich zurück in den Kindergarten. Ich bin vielleicht vier oder fünf Jahre alt und renne mit meinen Freunden durch den kleinen Wald hinter dem Gebäude. Die Luft riecht nach nassem Moos, die Sonne schimmert durch die Bäume, und ich fühle mich frei. Grenzenlos frei. Unsere Eltern waren die Art von Menschen, die uns nie spüren ließen, wie schwer das Leben manchmal sein kann. Streit? Wenn es welchen gab, haben wir nichts davon mitbekommen. Mein Vater war die Ruhe selbst, der Fels in der Brandung. Wenn ich Rat brauchte, wusste ich, dass ich ihn bei ihm finden würde. Meine Mutter hingegen war das Herz unserer Familie, der Anker, der uns alle zusammenhielt. Sie war immer da, mit offenen Armen und einem Lächeln, das alles besser machte.
Es gibt eine Philosophie, die sie uns beiden – meiner Schwester und mir – immer wieder mit auf den Weg gegeben haben: „Macht, was euch glücklich macht. Lebt nicht nach den Erwartungen der anderen, sondern folgt eurem Herzen und eurem Bauchgefühl.“
Diese Worte hallen heute noch in mir nach. Sie haben mir die Freiheit gegeben, meinen eigenen Weg zu suchen, ohne Angst, andere zu enttäuschen. Schon als Kind war ich willensstark, fast stur. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, ließ ich nicht locker. Diese Entschlossenheit hat mich bis heute begleitet.
Ich war nie die Lauteste in der Klasse, aber auch nie unsichtbar. Mein Platz war immer in der Mitte – nicht im Rampenlicht, aber auch nicht am Rand. Das war in Ordnung für mich. Ich musste nicht auffallen, solange ich wusste, wer ich war. Unsere Urlaube waren nie extravagant, aber sie fühlten sich immer magisch an. Jedes Jahr verbrachten wir eine Woche auf einem Bauernhof, zusammen mit den Freunden unserer Eltern und deren Kindern. Ich sehe uns noch vor mir: eine Bande von Kindern, ich das einzige Mädchen, umgeben von Jungs. Das war mein Element. Wir angelten, spielten mit den Tieren und erkundeten jeden Winkel des Hofes. Diese Erinnerungen sind heute wie ein Schatz. Einfach, aber voller Leben. Sie haben mich gelehrt, die kleinen Dinge zu schätzen – das Lachen, die Wärme, die Abenteuer, die nicht teuer sein müssen, um unvergesslich zu bleiben.
Jetzt, Jahre später, sitze ich hier, in einer anderen Stadt, einem anderen Leben. Doch in meinem Herzen trage ich diese Momente bei mir wie einen Kompass. Sie erinnern mich daran, woher ich komme, und geben mir die Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen – frei, entschlossen und immer mit einem Blick zurück auf das, was mich geformt hat.
Neue Wege und erste Freundschaften
Die Realschule ist der erste echte Neuanfang in meinem Leben – aufregend, aber auch überwältigend. Alles ist größer, lauter, chaotischer. Neue Lehrer, neue Regeln, neue Gesichter. Und in dieser neuen Welt gibt es auch neue Typen von Menschen: Die Beliebten, die immer in der letzten Reihe sitzen, sich in Insiderwitzen verlieren und eine Selbstsicherheit ausstrahlen, die mich gleichermaßen fasziniert und verunsichert. Die Streber, die sich nie zurückhalten, jede Frage der Lehrer beantworten und in ihrer Welt aus guten Noten und ständigen Hausaufgaben zu leben scheinen. Und dann sind da noch die, die irgendwo dazwischen schweben – wie ich. Nicht unsichtbar, aber auch nicht im Rampenlicht. Irgendwo in der Mitte, ohne ein genaues Zuhause, doch trotzdem irgendwie okay damit.
Zu Beginn fühle ich mich oft alleine. Unsicher, noch auf der Suche nach meinem Platz. Aber das ändert sich, als ich sie treffe – Lisa. Es passiert zufällig, wie alles in der Schule. Wir sitzen in der Pause nebeneinander, beide mit unseren Butterbroten, ein wenig verloren in der neuen Umgebung. Es beginnt mit einem Gespräch über die nervigen Lehrer, und ehe ich mich versehe, sitzen wir nach der Schule gemeinsam im Shopping-Center und lachen über all die Kleinigkeiten, die uns in der Schule nerven. Von diesem Tag an wird sie ein fester Bestandteil meines Lebens. Lisa ist alles, was ich mir von einer besten Freundin wünsche. Lebendig, mutig, immer ansteckend – und mit einem Lachen, das die ganze Welt heller erscheinen lässt. Mit ihr fühlt sich das Leben plötzlich leichter an.
Wir verbringen Stunden damit, uns gegenseitig die Haare zu flechten, Outfits auszuprobieren, uns heimlich in Magazinen über Stars zu vertiefen und über unsere Schwärme zu sprechen. Sie ist mehr als nur eine Freundin – sie ist fast eine Schwester für mich. Meine Eltern lieben sie, und sie ist oft bei uns zu Hause, sitzt am Esstisch, lacht mit meinen Geschwistern. Bei ihr fühlt sich alles irgendwie wie zu Hause an. Die Gespräche drehen sich häufig um Jungs, wer auf wen steht, wer mit wem zusammen ist – all die üblichen Themen, die in einem Mädchenleben nie fehlen dürfen. Doch während die anderen Mädchen ihre ersten Erfahrungen machen, bleibe ich in dieser Hinsicht zurückhaltend. Schüchtern. Ich habe nie den Mut, den ersten Schritt zu wagen. Die Vorstellung, einfach jemanden anzusprechen, kommt mir fremd vor. Ich warte, dass er es tut – dieser „er“.
Meine ersten Schwärme sind heimlich. Blicke aus der Ferne, Träume von perfekten Szenen, die sich wie in einem Film abspielen. Ich beobachte, wie sich Paare finden, während ich bei der Vorstellung eines ersten Kusses schüchtern und zögerlich bleibe. Die „Beziehungen“, die ich damals habe, sind harmlos – ein paar Wochen Händchenhalten, SMS, die nach nichts klingen, weil mir die Worte fehlen. Alles wirkt wie ein Spiel, bei dem ich die Regeln nicht kenne, bei dem alles irgendwie nicht so „echt“ ist. Doch tief in mir sehne ich mich nach diesem einen Moment – dem Moment, in dem alles anders wäre. Dem Moment, in dem der erste Kuss mehr wäre als ein ungeschickter Zufall.
Und dann kommt Tom.
Erste Liebe, erste Verletzungen
Tom ist der erste Junge, bei dem ich das Gefühl habe, dass es mehr zwischen uns gibt als das oberflächliche Geplänkel, das ich bisher kenne. Er sieht mich nicht nur als das schüchterne Mädchen in der Mitte der Gruppe, sondern er scheint wirklich an mir interessiert zu sein. Es ist nicht nur die flüchtige Aufmerksamkeit, die ich oft bekomme, sondern etwas Echtes. Dieser Frühlingstag mit ihm, der erste, an dem wir allein sind, fühlt sich deshalb besonders an.
Es ist Vatertag, und die Sonne scheint warm vom Himmel. Der Duft von frisch gemähtem Gras und blühenden Blumen liegt in der Luft. Tom holt mich von der Bushaltestelle in einem Nachbardorf ab – einfach nur wir zwei, fernab der Gruppe, ohne das übliche Hin und Her. Wir laufen durch die Felder, sprechen über Schule, Freunde, unsere Zukunft – alles, was einem in dem Moment durch den Kopf geht. Ich fühle mich gleichzeitig nervös und glücklich, in seiner Nähe zu sein. Als wir schließlich an einem Kornblumenfeld ankommen, scheint die Zeit stillzustehen.
Die Blumen wiegen sich sanft im Wind, und die Sonne lässt alles in einem goldenen Licht erstrahlen. Es ist der perfekte Moment, fast so, als hätte ich ihn in meinen Tagträumen herbeigesehnt. Tom sieht mich mit seinen grünen Augen an, und seine Worte treffen mich wie ein sanfter Schlag. „Du bist schön“, sagt er leise, fast ehrfürchtig. Mein Herz schlägt schneller. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen, als ich „Danke“ flüsterte, unsicher, wohin ich meinen Blick richten soll. Und dann beugt er sich vor, langsam, als ob er sicherstellen möchte, dass ich bereit bin. Unsere Lippen treffen sich – sanft, behutsam, genau so, wie ich es mir immer erhofft habe.
Der erste Kuss. Es ist, als ob alles um uns herum verschwunden wäre. Inmitten der Kornblumen fühlt sich alles richtig an. Es ist, als ob die Welt uns für diesen Moment gehört. Aber die Magie hält nicht lange an. In den darauffolgenden Tagen merke ich, dass Tom mehr will – mehr Nähe, mehr Berührungen, mehr von mir. Doch ich fühle mich überfordert. „Ich brauche Zeit“, sage ich ihm eines Nachmittags im Park, als wir uns erneut treffen. Meine Stimme zittert, doch ich will ehrlich zu ihm sein. „Ich bin noch nicht so weit.“ Er nickt, aber in seinen Augen liegt eine Unzufriedenheit, eine Ungeduld, die ich nicht ignorieren kann. Er versucht es trotzdem – immer wieder.
Jedes Mal, wenn wir uns treffen, spüre ich den Druck, die Erwartung. Der Zauber des ersten Kusses verblasst, und an seiner Stelle bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich bin nicht mehr diejenige, die die Kontrolle über ihre Gefühle hat. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und irgendwann, nach einem weiteren Gespräch, kommt es – das, was ich befürchtet habe. „Ich glaube, das funktioniert so nicht“, sagt Tom schließlich kühl. „Vielleicht suchen wir einfach etwas anderes.“ Seine Worte treffen mich wie ein Schlag. Für ihn ist es eine einfache Feststellung, für mich das Ende von etwas, das sich bedeutungsvoll und tief angefühlt hat. Ich nicke stumm, während mein Inneres schreit. Der Schmerz ist tief, ein dumpfes Ziehen in meiner Brust, das mich tagelang begleitet. Ich fühle mich wie eine Episode in seinem Leben – bedeutungslos, leicht ersetzbar.
Aber mit der Zeit verstehe ich: Es ist eine Lektion. Ich habe gelernt, meine Grenzen zu wahren, mich selbst nicht zu verlieren. Ich habe erkannt, dass ich nicht in eine Beziehung hineinpressen sollte, nur um den Erwartungen zu entsprechen. Die Clique bleibt, auch wenn Tom und ich uns voneinander entfernen. Es könnte unangenehm werden, doch dann tritt Sara in unser Leben.
Sara ist eine Bekannte von einem der Jungs aus der Clique, und als sie zu uns stößt, zieht sie sofort alle Blicke auf sich. Sie ist wunderschön – mit langen, blonden Haaren, strahlenden Augen und einer Ausstrahlung, die Stärke und Sanftheit vereint. Doch es ist nicht nur ihr Aussehen, das sie besonders macht. Sara hat eine warme, einladende Art, die alle um sie herum einhüllt. Anfangs will ich sie nicht mögen. Wie könnte ich auch? Sie scheint perfekt zu sein. Und sie versteht sich sofort gut mit Tom. Zu gut. Ich könnte sie beneiden, ich könnte sie hassen. Aber das tue ich nicht. Es ist ihre Ehrlichkeit, ihre Freundlichkeit, die mich anzieht. Sie zeigt Interesse an mir, an meinen Gedanken und fühlt sich dabei nicht gezwungen, zu gefallen.
Mit der Zeit beginnen wir, uns nach der Schule zu unterhalten, unsere Gespräche werden länger und intensiver. Ich weiß nicht genau, wie es passiert, aber Sara wird ein fester Bestandteil meines Lebens. Sie bringt frischen Wind in die Gruppe. Sie zeigt mir, dass es nicht schwer sein muss, das einzige Mädchen in einem Freundeskreis zu sein. Wir werden Freundinnen – schnell und unerwartet. Und plötzlich ist es in Ordnung, nicht mehr die Einzige zu sein.
Unsere Freundschaft wächst zu einer tiefen Verbindung, und ich lerne, dass nicht jede Beziehung auf Schmerz enden muss. Manche führen zu neuen, unerwarteten Anfängen. Und obwohl Tom manchmal noch in meinen Gedanken auftaucht, ist der Schmerz längst nicht mehr so intensiv. Denn ich habe etwas gefunden, das ich nicht gesucht habe: eine Freundin, die mich versteht, ohne dass ich viel erklären muss.
Träume von den Sternen
Irgendwann ist Tom nur noch eine verblasste Erinnerung. Sein Name verliert an Bedeutung, seine Präsenz wird immer mehr zu einem Schatten in der Vergangenheit. Stattdessen konzentriere ich mich immer mehr auf die anderen Menschen in meinem Leben – neue Gesichter, neue Geschichten, neue Möglichkeiten.
Und dann ist da Lukas. Lukas ist anders. Still, zurückhaltend, fast unsichtbar in der lauten Welt der Cliquen und Oberflächlichkeiten. Aber genau das zieht mich an. Er sucht keine Aufmerksamkeit, drängt sich nicht in den Vordergrund. Seine Stärke liegt in der Stille, in den Momenten, die keiner sonst bemerkt. Unsere Treffen sind nie groß geplant oder besonders aufregend. Meistens sehen wir uns zufällig nach der Schule oder bei gemeinsamen Freunden. Aber es sind die stillen Augenblicke, die mich prägen.
Nach unseren Treffen fahre ich oft mit ihm nach Hause – mit dem Fahrrad durch die stillen Straßen. Ich liebe diese nächtlichen Fahrten. Es fühlt sich an, als gehöre die Welt in diesen Momenten nur uns beiden. Manchmal halten wir an einem kleinen Spielplatz an – einem dieser unscheinbaren Orte, die tagsüber von Kinderlachen erfüllt sind, aber nachts eine magische Ruhe ausstrahlen. Wir setzen uns auf die Schaukeln oder legen uns ins Gras, während der Himmel sich über uns erstreckt, übersät mit unzähligen funkelnden Sternen. „Glaubst du, dass die Sterne uns etwas sagen können?“, frage ich einmal und lasse meinen Blick nicht vom Himmel.
Lukas lächelt – dieses sanfte, ruhige Lächeln, das ich so sehr mag. „Vielleicht. Oder vielleicht sind sie einfach nur da, um uns zu zeigen, wie klein wir sind.“ Seine Worte berühren mich auf eine Weise, die ich damals noch nicht ganz verstehe. Es ist keine große Liebe, keine Leidenschaft, die uns verbindet.
Es ist etwas anderes. Etwas Tieferes. Ein Gefühl von Vertrautheit, von Geborgenheit. Mit ihm kann ich einfach sein – ohne Erwartungen, ohne Druck. Nur wir, der sternenbedeckte Himmel und die endlose Nacht, die sich wie ein stilles Versprechen anfühlt.
Doch nicht jede Geschichte braucht ein großes Finale. Unsere Verbindung ist flüchtig, zart, und wie die Sterne über uns – nur für eine begrenzte Zeit sichtbar. Irgendwann gehen wir getrennte Wege. Kein Drama, kein Schmerz. Nur ein leises Ende, das ich trotzdem immer bei mir tragen werde.
Mein Traumprinz
John. Dieser eine Name brennt sich für immer in mein Herz, unauslöschlich wie ein Tattoo. Er steht für alles, was ich damals fühle – die unbändige Freiheit eines endlosen Sommers, die prickelnde Aufregung erster Berührungen und letztendlich auch der Schmerz, der mich wachsen lässt. John ist für mich kein gewöhnlicher Junge, auch wenn ich das anfangs nicht sehe.
Die Sommerferien beginnen wie immer: lange ausschlafen und die Nachmittage mit den Jungs verbringen. Sie haben sich in den Kopf gesetzt, einen eigenen Dirtpark zu bauen, und ich bin mittendrin. Jeden Tag schwitzen wir gemeinsam in der Sonne, türmen Dreckhügel auf und verwandeln eine unscheinbare Wiese in unser kleines Paradies. Danach kehren wir zurück in den Alltag, der uns wie ein stiller, warmer Fluss durch die lauen Nächte trägt. An einem dieser Abende schlendern wir nach einem langen Tag auf der Baustelle zu einem Spielplatz im Dorf. Wir sind wieder Kinder – schrankenlos, albern, frei. Ich lasse mich auf eine Schaukel fallen, der Wind spielt mit meinen Haaren, und da ist John, der mich plötzlich anschubst und lacht.
Für einen Moment, so klein und doch so bedeutend, scheint die Zeit stillzustehen. Er trägt eine enge Jeans, ein kariertes Hemd und diese Mütze, die ihm irgendwie so gut steht, dass sie mich aus der Fassung bringt. Es ist das erste Mal, dass ich ihn wirklich wahrnehme – sein verschmitztes Lächeln, seine mühelosen Bewegungen, die dennoch voller Präsenz sind. Als es spät wird, mache ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Ich muss um 22 Uhr zu Hause sein – eine eiserne Regel, die mich oft nervt. „Ich bringe dich hin“, sagt John. Und obwohl ich ihn kaum kenne, fühlt sich das so selbstverständlich an, als hätte es immer so sein müssen.
Wir sitzen dort, unter der blassen Laterne, während die Minuten verrinnen. Die Welt um uns scheint leise zu atmen, während wir einfach nur reden. Ich hasse die Spinnen, die an den Pfeilern der Haltestelle lauern. Als ich eine sehe, erschrecke ich und setze mich wie selbstverständlich auf seinen Schoß. Er hält mich fest, und obwohl ich anfangs nur Schutz suche, spüre ich etwas anderes – eine Nähe, die ungewohnt ist und mich doch in ihren Bann zieht.
Die darauffolgenden Abende folgen demselben Muster, und es wird unser Ritual. Er wartet mit mir auf den Bus, gibt mir seinen Pulli, wenn mir kalt ist, und ich lasse ihn nie los, weil er so herrlich nach ihm riecht. Es ist fast magisch. Irgendwann küssen wir uns. Es ist eines dieser spontanen Dinge, die weder geplant noch erzwungen sind, sondern einfach passieren, weil sie sein müssen. Seine Lippen auf meinen fühlen sich wie ein Versprechen an, und der Moment könnte ewig dauern. Doch dann geschieht es: „Ich liebe dich“, flüstert er, wie aus Reflex, und meine Gedanken brechen in tausend Stücke. Ich bin überfordert, steige wortlos in den Bus und lasse ihn dort zurück.
Trotzdem geht es weiter. Wir verbringen jede freie Sekunde miteinander und erleben den Sommer unseres Lebens: lange Nächte, rote Sonnenuntergänge über dem Dirtpark, der Duft von frisch gemähtem Gras und verschwitzten Händen. Es fühlt sich an, als würde dieser Sommer niemals enden. Irgendwann entscheiden wir uns offiziell, Freund und Freundin zu sein. Ab da leben wir in unserer rosaroten Traumwelt. Doch jeder Sommer hat seinen Herbst. In der Schule holt uns der Alltag ein – Stundenpläne, Hausaufgaben, Prüfungen. Das übliche Chaos, das unser Leben bestimmt. Doch hinter all dem gibt es eine andere Welt. Eine Welt, die nur uns gehört. Eine Welt, die jedes Mal zum Leben erwacht, wenn wir allein sind.
Diese Welt finden wir in Johns Wohnung. Seine Eltern sind oft nicht da – ein typisches Szenario, das uns unzählige Möglichkeiten bietet. Keine neugierigen Blicke, keine Fragen, keine Regeln. Nur wir zwei und die endlose Freiheit der leeren Räume. An einem dieser Nachmittage ist es besonders still. Die Sonne scheint durch die halb geschlossenen Vorhänge und wirft goldene Streifen auf das alte, gemütliche Sofa im Wohnzimmer. Wir liegen nebeneinander, eng umschlungen, unsere Körper fast reglos, doch innerlich beben wir vor Spannung. Ich spüre seine Hände an meinen Oberschenkeln – langsam, zögerlich, fast wie eine stumme Frage. Meine Haut brennt unter seiner Berührung, doch es ist kein unangenehmes Brennen. Es ist neu. Ungewohnt. Aufregend. Ich weiß, was jetzt passieren könnte – was wahrscheinlich passieren wird.
Ein Teil von mir ist unsicher, fast ängstlich. Erinnerungen an frühere Momente flimmern auf, in denen ich mich nicht bereit gefühlt habe. Doch mit John ist es anders. Seine Berührungen sind weder fordernd noch ungeduldig. Sie sind sanft, fragend, als würde er mir die Kontrolle überlassen. „Geht es dir gut?“, flüstert er, seine Stimme leise, fast zerbrechlich in der Stille des Raumes. Ich nicke. Ein kleines, vorsichtiges Nicken, das ihm mehr bedeutet als Worte.
Und dann entdecken wir einander. Kein hektisches Wühlen, kein verzweifeltes Suchen nach einem Höhepunkt. Stattdessen ist es ein vorsichtiges Erkunden – ein Spiel aus Berührung und Rückzug, aus Verlangen und Zurückhaltung. Seine Finger finden ihren Weg über meine Haut, tasten sich langsam voran, während ich die Wärme seines Körpers spüre. Jeder Zentimeter fühlt sich neu an, als würde ich zum ersten Mal berührt werden – und vielleicht ist es das auch. Meine Hände zittern leicht, als ich ihn berühre.
Auch er ist unsicher, aber wir lernen schnell, was sich gut anfühlt. Was uns näherbringt. Es ist kein Film. Keine kitschige Hollywood-Szene mit perfekt choreografierten Bewegungen und dramatischer Musik. Es ist unser Moment. Zwei junge Menschen, die sich finden, die ihre Neugier nicht länger zurückhalten können.
Und als wir schließlich unser erstes Mal erleben, ist es genau das, was es sein sollte: intim, behutsam, unvollkommen und doch perfekt in seiner eigenen Weise. Ich erinnere mich an den Moment danach, als wir nebeneinander liegen, seine Arme um mich geschlungen, während mein Kopf auf seiner Brust ruht. Sein Herzschlag ist schnell, genau wie meiner. Aber es ist nicht nur die Aufregung, die uns erfasst hat – es ist die Erkenntnis, dass wir etwas geteilt haben, das uns für immer verbinden wird. Ich hebe meinen Kopf und sehe ihn an. Seine Augen sind sanft, seine Lippen bilden ein Lächeln, das mich mehr beruhigt als tausend Worte. „Ich liebe dich“, sagt er leise, fast scheu, als ob er sich nicht sicher ist, ob es der richtige Moment ist. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich weiß nicht, ob ich es schon sagen kann, ob ich es überhaupt sagen sollte. Aber ich fühle es – dieses warme, beruhigende Gefühl, das durch meinen ganzen Körper fließt. „Ich liebe dich auch“, flüstere ich zurück. Und für einen Moment ist alles perfekt.
Doch die Jugend hat ihre eigenen Gesetze. Unsere Leidenschaft verschlingt uns. Einmal ist nicht genug. Wir können nicht genug voneinander bekommen – die Nähe, die Wärme, das Gefühl, einander vollständig zu sein. Tagsüber, nachts, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Die leeren Räume seiner Wohnung werden unser geheimer Rückzugsort. Die Zeit verliert ihre Bedeutung, wenn wir zusammen sind. Jeder Kuss, jede Berührung fühlt sich wie ein neuer Anfang an. Doch mit der Leidenschaft kommt auch die Sehnsucht nach mehr. Mehr Zeit, mehr Nähe, mehr Tiefe. Es ist nicht nur die körperliche Verbindung, sondern das Bedürfnis, ganz in dieser Welt zu verschwinden, die wir uns geschaffen haben. Eine Welt, die uns gehört. Und in dieser Welt gibt es keine Zweifel, keine Unsicherheiten.
Nur uns. Wie lange kann man in einer Welt leben, die nur aus Leidenschaft besteht? Es ist ein Feuer, das uns beide in den Bann zieht. Natürlich bleibt es nicht unbemerkt. Seine Mutter erwischt uns eines Nachmittags – ein Moment, der peinlicher kaum sein könnte.
Sie stürmt herein, sieht uns und schreit uns später an, wie unverantwortlich wir seien. Wir hören zu, senken die Köpfe, doch in uns brennt dieses rebellische Feuer weiter.
Trotzdem schleichen sich mit der Zeit Schatten ein. Die Jungs werden mehr, die Abende mit der Clique lauter, fremder. Mädchen, die ich nicht kenne, lachen mit John, und ich fühle mich fehl am Platz. Während er mit ihnen unterwegs ist, liege ich oft allein zu Hause, verloren in einem Chaos aus Wut, Trauer und Sehnsucht. Es ist, als würde ich langsam verschwinden, mich selbst nicht mehr erkennen. Liebe kann so wundervoll sein, aber auch so schmerzhaft. Ich lerne, dass die wahren Verletzungen nicht auf der Haut, sondern in der Seele entstehen – ein bittersüßer Geschmack, der mir für immer bleiben wird.
Zerbrechliche Bande
Glück – es ist immer da, so selbstverständlich wie die Sonne, die am Morgen aufgeht. John und ich leben in unserer eigenen Welt, einer intensiven Blase aus Nähe, Vertrautheit und Leidenschaft. Doch irgendwann beginnt diese Blase zu bröckeln. Ich spüre es, lange bevor ich es mir eingestehe. Und vielleicht liegt ein Teil der Schuld bei mir. Denn während John seine Freunde hat, seine Jungs, seine Clique, habe ich niemanden. Niemanden außer ihm.
Zu Beginn unserer Beziehung habe ich alle, die mir etwas bedeuteten, zurückgelassen – aus Liebe, aus Naivität. Jetzt sitze ich allein in meinem Zimmer, gefangen in der Stille, während er mit seinen Freunden unterwegs ist. Unsere Zeit miteinander wird immer seltener. Die Ausbildung fordert ihren Tribut, und die Wochenenden gehören nicht mehr mir, sondern seiner Gang. Ich versuche, mich anzupassen, mich in diese Gruppe einzufügen, die ihm so wichtig ist. Doch ich bin eine Fremde in ihrer Welt. Ihre Gespräche, ihre Insider-Witze – ich kann nie wirklich dazugehören. Und John? Er scheint das nicht zu bemerken. Vielleicht will er es nicht bemerken. Unsere Beziehung ist immer von Leichtigkeit geprägt gewesen. Wir können lachen, schweigen, uns lieben, ohne je über die schwierigen Dinge zu sprechen. Doch als die Probleme kommen, fehlt uns das Handwerkszeug. Statt miteinander zu reden, schlucken wir unsere Gefühle herunter, bis sie uns von innen heraus aufzufressen beginnen.
Und dann ist da Julia. Allein ihr Name lässt meinen Magen sich jetzt noch zusammenziehen. Wenn ich daran denke, wie viel Raum sie zwischen uns eingenommen hat, wird mir übel. John ist schon immer beliebt bei Mädchen. Sie mögen seine Art, sein Lächeln, seine Ausstrahlung. Seine Freundschaften zu ihnen machen mich immer wieder eifersüchtig. Ich will ihm vertrauen, und meistens tue ich das auch. Doch bei Julia ist es mehr. Es beginnt harmlos. „Eine Neue in meiner Klasse“, hat er gesagt, als er ihren Namen zum ersten Mal erwähnt hat. Nur ein beiläufiger Satz, kaum mehr als eine Randnotiz. Doch schnell wird sie mehr als nur eine neue Klassenkameradin. Ich merke es an den kleinen Dingen. Die kurzen Nachrichten, die er auf seinem Handy lächelnd beantwortet. Die Art, wie er ihren Namen aussprechen – weich, fast vertraut. Die Art, wie seine Augen kurz aufleuchten, wenn er von ihr erzählt. Anfangs rede ich mir ein, dass ich übertreibe. Dass ich paranoid bin. Doch das Gefühl lässt mich nicht los.
„Warum schreibst du ihr ständig?“, frage ich eines Abends, als wir nebeneinander auf seinem Bett liegen. Ich habe die Worte mehrmals im Kopf gedreht, versuche, den richtigen Ton zu finden, die richtige Mischung aus Neugier und Gelassenheit. Er zögert. „Wir verstehen uns einfach gut“, sagt er schließlich, seine Stimme ruhig, fast gleichgültig. Ich spüre, wie sich mein Herz zusammenzieht. „Mehr ist da nicht“, fügt er hinzu, als ob diese Worte alles klären würden. Aber es klärt nichts. Es ist, als hätte Julia sich einen festen Platz in seinem Leben gesichert. Einen Platz, der eigentlich mir gehört.
Der Höhepunkt kommt während unseres Urlaubs in Griechenland. Es soll eine Traumreise sein – Sonne, Meer und wir. Eine Flucht aus dem Alltag, ein Neuanfang, eine Erinnerung, die uns wieder näher zusammenbringen soll. Doch stattdessen wird es der Anfang vom Ende. Wir sitzen nebeneinander in einem Strandcafé, die Wellen des Mittelmeers rauschen leise im Hintergrund. Die Sonne scheint warm auf unserer Haut, aber zwischen uns liegt eine Kälte, die keinen Sonnenstrahl durchdringen kann. Wir sprechen kaum ein Wort. Das Schweigen zwischen uns ist lauter als jede Diskussion, drückender als jeder Streit.
Ich sehe, wie er immer wieder aufs Handy schaut, ein kurzes Zucken der Mundwinkel, das verrät, dass er auf eine Nachricht wartet. Ich weiß, von wem. „Denkst du gerade an sie?“, frage ich leise, ohne ihn anzusehen. Er antwortet nicht. In diesem Moment spüre ich es deutlich: Wir entfernen uns. Meine Hand sucht nach seiner, will ihn festhalten, will ihn zurückholen. Doch ich greife ins Leere. Wir schlafen nebeneinander, Rücken an Rücken, mit einem Ozean aus unausgesprochenen Worten zwischen uns. Ich wünsche mir, ihn zu erreichen. Ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich uns liebe. Aber die Worte bleiben in mir gefangen, wie Steine, die zu schwer sind, um ans Licht zu kommen. Und dennoch – trotz all der Distanz, trotz all der Kälte – ist da dieses Band zwischen uns. Dünn. Fragil. Aber unzerreißbar. Ein Band, das uns zusammenhält, obwohl wir oft denken, es wäre besser, es loszulassen.
Und dann, eines Tages, zieht er sich von ihr zurück. Es geschieht leise, fast unbemerkt. Keine dramatische Ansage, kein großer Schlussstrich. Julia verschwindet langsam aus seinem Alltag, wie ein Schatten, der verblasst, wenn die Sonne aufgeht. Ich merke es an den kleinen Dingen – wie er das Handy seltener zur Hand nimmt, wie seine Augen nicht mehr suchen, wie sein Lächeln wieder öfter mir gilt. Doch in mir kämpfen noch immer Zweifel.
Ich will glauben, dass wir wieder das sind, was wir einmal waren. Aber etwas hat sich verändert. Wir sind wieder ein Team – zumindest nach außen hin. Doch die Risse in unserer Fassade bleiben. Wir funktionieren, weil wir es wollen, weil wir es brauchen. Aber ich weiß: Es wird nie wieder so sein wie früher. Nach allem, was geschehen ist, hätte ich gedacht, dass wir längst an diesem Punkt zerbrechen würden. Doch irgendetwas hält uns zusammen. Als ob es unausweichlich wäre. Als ob das Universum selbst beschlossen hätte, dass wir zusammengehören – ob wir es wollen oder nicht.
Bereit für den nächsten Schritt?
Unser gemeinsamer Weg ist nicht gerade einfach. Im Gegenteil. Er ist geprägt von Stolpersteinen, unausgesprochenen Worten und einer Dunkelheit, die manchmal bedrohlicher wirkt, als ich es mir eingestehen will. Aber irgendwie finden wir immer wieder einen Weg – oder besser gesagt, wir stolpern uns hindurch. Manchmal scheint es einfacher, einfach nicht darüber zu reden. Über das, was wehtut. Über das, was wir wirklich wollen.
Kommunikation ist nie unsere Stärke. Es ist immer leichter, sich in Schweigen zu hüllen und die Oberfläche glatt zu halten, anstatt in die Tiefe zu tauchen, wo es schmerzt. Es ist nicht perfekt. Nein. Aber Perfektion ist nie das, wonach wir suchen. Was wir suchen, ist etwas Echtes. Etwas, das uns erdet, auch wenn es uns gleichzeitig in den Wahnsinn treibt.
Und vielleicht, nur vielleicht, ist das genau das, was uns immer wieder zueinander führt. Wir beide sind zwei widersprüchliche Teile eines Puzzles, das nur in genau dieser Form Sinn ergibt. Und so laufen wir weiter zusammen. Die Entscheidung, von zu Hause auszuziehen, ist mein erster Schritt in die Unabhängigkeit. Die Wohnung im Nachbarort meines Heimatdorfes ist perfekt – klein, aber gemütlich. Es ist das erste Mal, dass ich ganz allein auf meinen eigenen Beinen stehe. John bleibt bei seinen Eltern, aber fast jede Nacht schläft er bei mir. Es ist, als könnten wir nicht ohne einander, obwohl unsere Beziehung längst nicht mehr so rosarot ist, wie sie am Anfang einmal war.
Unser Leben läuft perfekt – zumindest von außen. John und ich sind das, wovon viele träumen: erfolgreich, attraktiv, angesehen. Wir haben den Weg aus der Unsicherheit der Jugend in die Stabilität des Erwachsenenlebens gefunden.
Die erste eigene Wohnung, die wir gemeinsam mit Bedacht eingerichtet haben – stilvoll, aber wohnlich. Die Wochenenden sind gefüllt mit Golfspielen, Dinnerpartys und kleinen Kurztrips, die wir uns ohne weiteres leisten können. Freunde beneiden uns um das, was wir haben. Unsere Beziehung scheint mühelos, fast wie ein Stückchen Perfektion, das wir uns selbst geschaffen haben. Und doch ist da diese leise Unruhe in mir, ein Klopfen an die Tür meines Bewusstseins, das sich nicht ignorieren lässt. Inmitten all der routinierten Abläufe, der Dinnerpartys und der gemeinsamen Urlaubspläne beginne ich mich zu fragen, ob ich nicht in einer perfekt inszenierten Geschichte lebe. Einer Geschichte, die ich mir selbst seit meiner Kindheit geschrieben habe.
Die kleine Version von mir hat sich immer gewünscht, eines Tages diesen Traum zu leben: Haus, Kinder, ein liebevoller Mann, der für Stabilität sorgt. Jetzt bin ich so nah dran. Und dennoch fühlt es sich nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe.
Und dann kam Berlin
Es ist, als hätte die Stadt auf mich gewartet. Es beginnt mit einer dieser Gelegenheiten, die sich im Leben nur einmal bieten – wenn überhaupt. Ich bin beruflich erfolgreich, habe mich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet, und ich will mehr. Mehr Verantwortung, mehr Herausforderungen, mehr von diesem Gefühl, das Leben nicht einfach nur zu verwalten, sondern aktiv zu gestalten.
Eines Nachmittags, als ich mich gerade mit den üblichen Aufgaben beschäftige, klopft es an meiner Bürotür. Mein Chef steht dort, mit einem Ausdruck im Gesicht, den ich sofort als ungewöhnlich erkenne. „Hast du kurz Zeit?“, fragt er, bevor er eintritt und die Tür hinter sich schließt. „Wie du weißt, ist der Standortleiter in Berlin unerwartet gegangen.“ Er macht eine kurze Pause, als würde er mir Raum geben, die Tragweite seiner nächsten Worte zu erfassen. „Wir brauchen jemanden, der kurzfristig einspringt. Jemanden, der die Situation stabilisieren und das Team neu ausrichten kann. Ich habe an dich gedacht.“
Berlin. Die Hauptstadt. Ein neues Umfeld, eine größere Verantwortung. Ein Sprung, der alles verändern könnte. Mein Herz schlägt schneller, eine Mischung aus Aufregung und Nervosität breitet sich in mir aus. Natürlich habe ich in anderen Städten gearbeitet, aber Berlin ist anders. Es ist nicht irgendeine Stadt. Es ist die Stadt. „Was sagst du?“, fragt mein Chef schließlich, seine Augen prüfend auf mich gerichtet. Ich muss nicht lange überlegen. Die Entscheidung fällt fast instinktiv. „Ja. Ich mache es.“ In diesem Moment weiß ich, dass ich diese Chance nicht ablehnen kann. Sie ist zu groß, zu wichtig, um sie vorbeiziehen zu lassen.
Noch am selben Abend mache ich mich auf den Weg nach Hause, um John die Neuigkeit zu erzählen. Er hört mir zu, lächelt sanft, als ich ihm von der Möglichkeit erzähle, von der Herausforderung, die vor mir liegt. Ich sehe das Verständnis in seinen Augen – aber auch die Sorge.
Wir wissen beide, dass diese Veränderung etwas ist, das wir noch nie zuvor durchgemacht haben. Wochenlange räumliche Trennung, eine neue Dynamik in unserer Beziehung. Doch John ist mein Fels. „Ich verstehe, dass du das tun musst“, sagt er schließlich und zieht mich in seine Arme. „Und ich bin hier, wenn du zurückkommst.“ Seine Unterstützung ist beruhigend, aber tief in mir weiß ich, dass uns eine Herausforderung bevorsteht, die größer ist als jede zuvor.
Ein paar Tage später sitze ich im Auto, vollgepackt mit dem Nötigsten für die kommenden Monate. Die Fahrt nach Berlin zieht sich, die Kilometer verschwinden unter den Reifen, bis schließlich die Skyline der Stadt in Sicht kommt. Es ist spät in der Nacht, als ich die letzten Meter auf der Autobahn vor Berlin fahre. Die Stadt empfängt mich mit ihrem vertrauten Chaos: hupende Autos, Menschen in Gruppen auf den Gehwegen, Stimmen, Lachen, Musik. Selbst um diese Uhrzeit ist Berlin lebendig – laut, pulsierend, als würde es keinen Schlaf kennen.
Als ich vor meinem neuen Apartment anhalte und den Schlüssel ins Schloss drehte, spürte ich eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Anspannung. Das ist der Beginn von etwas Neuem. Etwas, das mich fordern wird – beruflich, aber vielleicht auch privat. Ich stelle meine Koffer ab, schaue mich kurz in der kleinen Wohnung um und ziehe mir dann eine Jacke über. Schlafen kann ich nicht. Nicht hier, nicht jetzt. Ich muss hinaus, die Stadt spüren. Die kalte Nachtluft empfängt mich, als ich die Treppe hinuntergehe und mich auf die Straßen Berlins treiben lasse. Die Stadt vibriert unter meinen Füßen, als wäre sie lebendig. Ein unaufhörliches Summen liegt in der Luft, eine Energie, die sich kaum greifen lässt. Berlin ist keine Stadt, die dich sanft umarmt. Sie ist hart, direkt, und sie lässt dich nicht los.
Ich weiß, dass Berlin für viele eine Chance ist – ein Neuanfang, eine Möglichkeit, alles hinter sich zu lassen und neu zu beginnen. Aber genauso ist es auch eine Stadt, die Menschen verschlucken kann. Ein Strudel, aus dem man nicht immer unversehrt hervorgeht. Die ersten Tage vergehen wie im Flug. Die Arbeit fordert mich heraus und zieht mich sofort in ihren Bann. Meetings, neue Kollegen, Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen. Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden – wirklich gebraucht. Dieses Gefühl, nach dem ich mich so lange gesehnt habe, ist plötzlich Realität. Jeder Tag ist ein Abenteuer, jede Nacht ein Geheimnis. Ich lerne neue Menschen kennen, entdecke Seiten an mir, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren.
John und ich telefonieren jeden Abend. „Wie läuft es?“, fragt er jedes Mal, und ich erzähle ihm von den Herausforderungen, von den kleinen Siegen, die ich bereits in den ersten Tagen errungen habe. „Ich bin so stolz auf dich“, sagt er leise. Ich lächle. Aber tief in mir spüre ich etwas, das ich nicht benennen kann. Etwas, das nicht verschwinden will, egal wie perfekt alles zu laufen scheint. In den Nächten, wenn die Arbeit getan ist und die Stadt unter mir weiterlebt, spüre ich, wie sich Berlin langsam in mir ausbreitet. Es lässt mich alles infrage stellen. Meine Träume. Meine Wünsche. Und schließlich auch meine Liebe.
Wieder zurück in meiner Heimat finde ich mich inmitten meines alten Lebens wieder. Nach dem Brunch mit meiner besten Freundin hallt ihre Frage wie ein Echo in meinem Kopf wider: „Bist du wirklich in John verliebt? Oder bist du nur in den Traum verliebt, dem du hinterherjagst?“ Natürlich bin ich es. Oder? John ist perfekt. Er ist klug, charmant, sieht gut aus und hat diese beruhigende Art, die mich immer wieder geerdet hat. Er ist der Mann, den man sich wünscht, wenn man an Sicherheit und Zukunft denkt. Und doch merke ich, dass sich mein Herz nicht mehr so heftig regt wie früher, wenn er den Raum betritt.
Dass ich manchmal seine Nähe suche – aber manchmal auch diese Leere spüre, die ich nicht benennen kann. Ich beginne, ihn zu beobachten. In den kleinen Momenten des Alltags. Wie er morgens Kaffee macht, konzentriert und effizient, während ich gedankenverloren am Küchentisch sitze. Wie er sich über die kleinen Siege im Job freut, und ich lächle, obwohl ich mich in diesem Moment seltsam distanziert fühle. Wir haben alles. Und doch frage ich mich, ob wir uns nicht irgendwo auf diesem Weg verloren haben. Oder ob ich mich verloren habe. In den nächsten Wochen lässt mich dieser Gedanke nicht los.
Ich klammere mich an Routinen, versuche, die nagende Unruhe zu übertönen – doch sie wird lauter. Sie ist da, wenn ich abends im Bett liege und er sich an mich schmiegt, seine Atmung gleichmäßig und friedlich. Und ich starre an die Decke, während mein Herz schlägt – nicht schnell, nicht langsam, sondern in einem Rhythmus, der zu fragen scheint: Ist das alles?
Ich spüre, dass ich an einem Scheideweg stehe. Der Traum, den ich mir immer gewünscht habe, steht direkt vor mir – greifbar, real. Aber ich muss mich fragen, ob ich bereit bin, ihn zu leben. Oder ob ich den Mut habe, einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg, der nicht perfekt ist, nicht sicher, aber vielleicht … echter. Noch habe ich keine Antworten. Nur Fragen. Und ein Herz, das langsam begreift, dass Träume manchmal nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Und dass Perfektion nicht immer Glück bedeutet. Mit diesen Gedanken beginnt plötzlich alles zu bröckeln. Nicht sichtbar, nicht sofort. Aber ich spüre es – wie einen feinen Haarriss in einem scheinbar makellosen Spiegel, der sich langsam ausbreitet. Eine Frage, einmal gestellt, hat die Macht, alles infrage zu stellen. Und diese Frage? Sie bleibt. Sie verfolgt mich. Sie nistet sich in meinem Kopf ein, in meinem Herzen, in den stillen Momenten, in denen ich allein bin. Bin ich wirklich glücklich?
Berlin hat eine seltsame Magie. Eine, die dich langsam, fast unmerklich umhüllt, bis du nicht mehr weißt, ob du dich in ihr wohlfühlst oder in ihr verloren gehst. Ich lebe plötzlich in zwei Welten – zwei Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite gibt es mein Desperate Housewife-Leben: Das perfekt geplante Leben mit John. Ein Leben, das ich mir immer gewünscht habe. Wir sprechen oft darüber, wie unser gemeinsames Haus aussehen würde, die Sommerabende im Garten, die Wochenenden mit den Kindern. John ist der perfekte Partner für diesen Traum. Verlässlich, liebevoll, der Mann, der mich immer auffängt, wenn das Leben mich herausfordert. Mit ihm habe ich mir eine Zukunft aufgebaut, die stabil, sicher und vor allem berechenbar ist. Doch dann ist da die andere Seite: Das Berlin Citygirl. Je mehr Zeit ich in dieser Stadt verbringe, desto mehr werde ich ein Teil von ihr – und sie ein Teil von mir. Ich fühle mich immer wohler in dieser neuen Rolle. Tagsüber bin ich die erfolgreiche Geschäftsfrau, die sich in einem neuen Umfeld beweisen muss, und abends wandere ich durch die Straßen der Stadt, als würde ich dazugehören. Ich finde neue Lieblingscafés, in denen die Bedienung mich irgendwann mit einem Lächeln begrüßt.
Ich entdecke Bars, die nie zu schließen scheinen, kleine Kunstgalerien, die mich mit ihrer Unvollkommenheit faszinieren, und Menschen, die so anders sind als die Freunde, die ich zu Hause zurückgelassen habe. Berlin ist laut, chaotisch, unvorhersehbar – genau das Gegenteil meines alten Lebens. Und genau deshalb fühle ich mich von diesem Ort angezogen. Es ist, als hätte die Stadt eine andere Version von mir zum Vorschein gebracht. Eine, die ich noch nicht richtig entdeckt habe. Ich merke, wie ich beginne, mich zu verändern. Die sorgfältig geplanten Wochenenden, die ich mit John verbringe, fühlen sich plötzlich wie ein fremder Traum an. Jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, um ihn zu sehen, bemerke ich, wie ich mich immer ein bisschen fremder fühle. Die Routine, die mir einst Sicherheit gegeben hatte, kommt mir nun erdrückend vor.
John bemerkt nichts davon – oder er will es nicht bemerken. Er ist noch immer derselbe. Lächelnd, geduldig, voller Pläne für unsere Zukunft. Doch während er von gemeinsamen Projekten spricht, von einem Urlaub, den wir im nächsten Sommer planen könnten, driften meine Gedanken immer öfter zurück nach Berlin. Ich frage mich, wie es sein kann, dass ich an zwei Orten gleichzeitig lebe, aber nur an einem wirklich lebendig bin. Eines Abends, als ich wieder in Berlin bin, sitze ich allein in meinem Apartment und lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Die Wände sind kahl, der Raum spartanisch eingerichtet – nichts im Vergleich zu der gemütlichen, perfekt abgestimmten Einrichtung, die John und ich gemeinsam für unsere Wohnung zu Hause ausgewählt haben. Aber genau das macht es aus. Hier in Berlin ist nichts perfekt. Und genau das fühlt sich plötzlich richtig an. Ich beginne, mich selbst zu hinterfragen. War das Leben, das ich mit John geplant habe, wirklich mein Traum? Oder war es nur die Erfüllung eines Bildes, das ich mir als Kind ausgemalt habe? In Berlin habe ich keine festen Strukturen, keine vorgefertigten Erwartungen. Hier kann ich mich neu definieren – oder vielleicht sogar neu erfinden.
Ich bemerke, wie ich John immer seltener anrufe, wie die Gespräche kürzer und routinierter werden. Wo früher Sehnsucht war, spüre ich jetzt eine Art Distanz. Eine Distanz, die ich nicht erklären kann, aber die immer präsenter wird. Natürlich bemerkt er es. „Du bist anders, seit du in Berlin bist“, sagt er eines Abends, seine Stimme ruhig, aber mit einem Hauch von Unsicherheit. „Ich kann es nicht genau beschreiben, aber du bist nicht mehr dieselbe.“ Ich will ihm widersprechen. Ihm sagen, dass das nicht stimmt. Aber die Worte bleiben mir im Hals stecken.
Er hat recht. Ich bin anders. Berlin hat mich verändert. Mit jeder Woche, die ich in dieser Stadt verbringe, wird mir mein Zuhause fremder. Das Leben, das ich mir mit John aufgebaut habe, das wir gemeinsam geplant haben – es fühlt sich an wie eine Erinnerung an jemanden anderen. Ich weiß, dass ich an einem Punkt angekommen bin, an dem ich eine Entscheidung treffen muss. Ich kann nicht ewig zwischen diesen beiden Welten hin- und herpendeln. Irgendwann muss ich mich entscheiden. Für die Sicherheit oder für die Freiheit.
Für das, was ich immer wollte – oder für das, was ich jetzt brauche. Und tief in mir weiß ich: Egal, wie sehr ich es hinauszögere, dieser Moment wird kommen. Und er wird alles verändern.
Ich sitze in der Bahn, auf dem Weg zurück zum Flughafen in meine Heimat, und mein Herz ist schwer. Es fühlt sich an, als würde ich ein Stück von mir selbst zurücklassen. Berlin ist nicht nur eine Stadt – es ist ein Gefühl, eine Sehnsucht nach mehr. Die Stadt, die Menschen, sie faszinieren mich, fordern mich heraus, ziehen mich an. Doch ich weiß, dass mir diese Stadt nicht die Zukunft bieten kann, die ich mir früher gewünscht habe. Vielleicht ist es das, was ich brauche – Freiheit, Abenteuer, ein Leben, das nicht von Erwartungen und Verpflichtungen bestimmt wird. Als ich am anderen Flughafen sitze und durch die Bilder der letzten Wochen blättere, sehe ich mein Lächeln auf den Fotos. Es ist echt, strahlend, voller Leben. Es ist, als hätte ich einen Teil von mir wiedergefunden, der lange verschüttet war. Doch in meinem Herzen brennt eine Frage: Wohin führt mich dieser Weg?