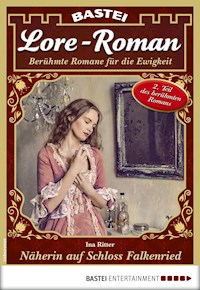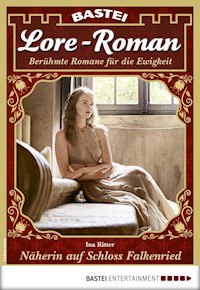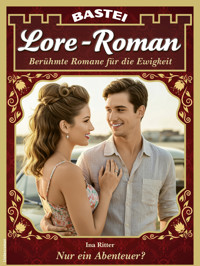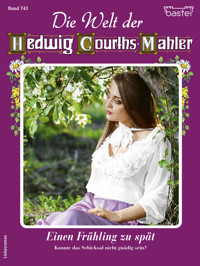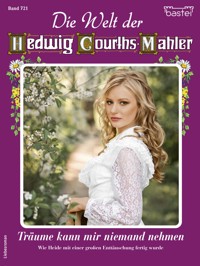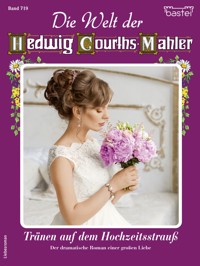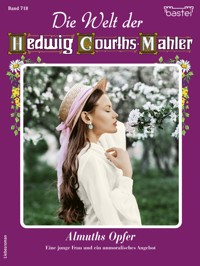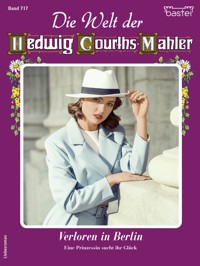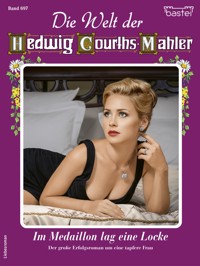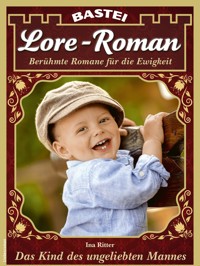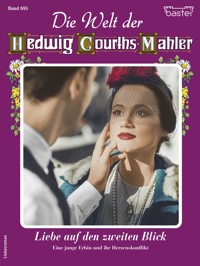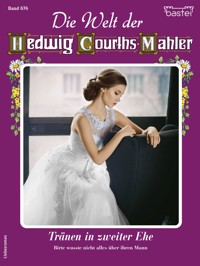1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lore-Roman
- Sprache: Deutsch
Linda Komtess von Wussow ist in einem goldenen Käfig aufgewachsen. Monatlich erhält sie einen Geldbetrag, mit dem sie in der Universitätsstadt leben und studieren kann. Reich, verwöhnt und ahnungslos, so bezeichnet ihre Mitbewohnerin Jenny Schoenau ihre Freundin. Der jungen Frau ist nichts in den Schoß gefallen, sie hat um alles kämpfen müssen. Wie in jeden Sommersemesterferien geht sie ihrer Beschäftigung als Reiseleiterin nach, um ihr Studium zu finanzieren. Linda beneidet die Mitbewohnerin: Sie wünscht sich auch nichts sehnlicher, als eine Aufgabe zu haben, an der man sich bewähren muss.
Als Jenny an einer Blinddarmentzündung erkrankt und operiert werden muss, kann sie ihre Stelle als Reiseleiterin nicht antreten. Linda sieht ihre Chance gekommen, endlich mal ein Abenteuer zu erleben, indem sie Jenny vertritt. Ohne ihre Eltern zu informieren, springt sie für ihre Freundin ein. Sie tut ja schließlich nichts Verbotenes. Linda ist aufgeregt, sie hat noch nie eine Pauschalreise mitgemacht. Ein Fräulein von Wussow pflegt im eigenen Wagen zu fahren und im besten Hotel abzusteigen. Aber gerade das ist es ja, was sie so sehr reizt, das Neue, das ganz andere ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Reich, verwöhnt – und ahnungslos
Vorschau
Impressum
Reich, verwöhnt – und ahnungslos
Komtess Linda bricht mit ihrem Elternhaus
Von Ina Ritter
Linda Komtess von Wussow ist in einem goldenen Käfig aufgewachsen. Monatlich erhält sie einen Geldbetrag, mit dem sie in der Universitätsstadt leben und studieren kann. Reich, verwöhnt und ahnungslos, so bezeichnet ihre Mitbewohnerin Jenny Schoenau ihre Freundin. Der jungen Frau ist nichts in den Schoß gefallen, sie hat um alles kämpfen müssen. Wie in jeden Sommersemesterferien geht sie ihrer Beschäftigung als Reiseleiterin nach, um ihr Studium zu finanzieren. Linda beneidet die Mitbewohnerin: Sie wünscht sich auch nichts sehnlicher, als eine Aufgabe zu haben, an der man sich bewähren muss.
Als Jenny an einer Blinddarmentzündung erkrankt und operiert werden muss, kann sie ihre Stelle als Reiseleiterin nicht antreten. Linda sieht ihre Chance gekommen, endlich mal ein Abenteuer zu erleben, indem sie Jenny vertritt. Ohne ihre Eltern zu informieren, springt sie für ihre Freundin ein. Sie tut ja schließlich nichts Verbotenes. Linda ist aufgeregt, sie hat noch nie eine Pauschalreise mitgemacht. Ein Fräulein von Wussow pflegt im eigenen Wagen zu fahren und im besten Hotel abzusteigen. Aber gerade das ist es ja, was sie so sehr reizt, das Neue, das ganz andere ...
»In vierzehn Tagen muss ich nach Hause fahren«, sagte Linda Komtess von Wussow und machte ein Gesicht, als sei diese Aussicht sehr betrüblich.
Ihre Freundin Jenny schaute sie an und lachte.
»Du Arme«, bedauerte sie heuchlerisch, »was geht es dir auch schlecht! Es muss ja schrecklich sein, in den Semesterferien nach Hause fahren zu müssen, wenn dort ein bescheidenes Schloss mit dreißig Zimmern und einem Reitstall und eine Segeljacht auf eigenem See auf einen wartet. Ich hätte auch keine Lust, dorthin zu fahren.«
Linda hatte Sinn für Humor und stimmte in Jennys Lachen ein. Sie bewohnten zusammen ein sehr hübsches Zimmer in der Großstadt, in der sich ihre Universität befand.
»Es ist so langweilig bei uns«, begründete die Komtess ihren Seufzer. »Und außerdem will meine Mutter mich partout verheiraten.«
»Wozu die junge, an Selbstständigkeit gewöhnte Dame natürlich keine Lust hat«, fiel Jenny ihr ins Wort. »Und womöglich hat dein Zukünftiger auch Grundbesitz und unheimlich viel Geld.«
»Einen anderen würde Mutter für mich gar nicht aussuchen.«
Lindas Sinn für Humor hatte endgültig die Oberhand gewonnen.
»Weißt du, manchmal beneide ich dich ein bisschen.«
»Mich?«, fragte Jenny Schoenau in ungespieltem Erstaunen. »Warum wohl? Um mein armseliges Dasein? Mir ist nichts in den Schoß gefallen, ich habe um alles kämpfen müssen. Und was es mich kostet, das Studium hier zu bestreiten, das weißt du ja. Ich habe übrigens die Nachricht bekommen, dass das Reisebüro mich wieder als Reiseleiterin haben will.«
»Ich stelle es mir schön vor, so eine Aufgabe zu haben, an der man sich bewähren muss.«
»Wenn man genug Geld im Hintergrund hat, mag das sein, aber wenn ein Scheitern heißt, dass all deine Zukunftspläne ins Wasser fallen, dann verliert diese sogenannte Bewährung an Reiz. Du bist wirklich reich, verwöhnt und ahnungslos, Kleines.«
»Warum kommst du nicht mit zu uns?«
Jenny senkte den Blick. Oft schon hatte sie ihrer Freundin diese Bitte abgeschlagen.
»Weil ich mich nicht zur Almosenempfängerin eigne«, fasste sie in einem Wort zusammen, worum es ging. »Außerdem muss ich Geld für das nächste Semester verdienen. Ich kann meiner Mutter nicht auf der Tasche liegen, und Lüder ist in einem Alter, in dem er gewisse Ansprüche stellt.«
»Geld könntest du doch von mir bekommen. Ich brauchte Vater nur zu sagen, dass er meinen Monatswechsel erhöhen soll. Er tut es bestimmt.«
»Ruhe! Ich werde Reiseleiterin. Hoffentlich sind die Leute diesmal wieder so nett wie letztes Jahr. Aber man ist am Ende der Saison ziemlich erschossen. Die einen erholen sich, und wir müssen dafür sorgen, dass sie es auch schaffen. Was für Wünsche die manchmal haben.« Jenny schmunzelte in der Erinnerung an einige Episoden, die ihr durch den Kopf gingen.
»Was hast du?«, fragte Linda, als Jenny sich plötzlich zusammenkrümmte und das Gesicht verzog.
»Nichts. Nur ein plötzlicher Schmerz, der wohl nichts zu bedeuten hat. Lässt es sich mit deinen Prinzipien vereinbaren, deiner armen Freundin ein Gläschen Kognak anzubieten? Irgendetwas mit meinem Magen ist wohl nicht in Ordnung.«
»Wenn du meinst, dass Kognak helfen wird ...«
Linda war schon aufgestanden und an den Schrank getreten, in dem sie eine ganze Batterie von Flaschen vorrätig hielt. Sie und ihre Freundin tranken kaum etwas, aber die Studienkollegen hatten dafür umso größeren Durst.
»Hoffentlich hilft er dir«, wünschte Linda, als sie Jenny das Glas reichte. »Du siehst ein bisschen schmal aus.«
»Am Schluss des Semesters kein Wunder. Ich bin froh, dass der Zirkus hier vorbei ist. Noch ein Jahr, dann kann ich ins Examen steigen und anschließend auf wehrlose Kinder losgelassen werden. Die Bälger tun mir jetzt schon leid.«
»Du wirst bestimmt eine gute Lehrerin«, meinte Linda voller Überzeugung.
»Was das bloß sein mag?« Jenny hatte sich auf die Couch gelegt und drückte jetzt mit der rechten Hand auf die Bauchdecke. »Wäre ich jetzt zu Hause, müsste ich Kamillentee trinken«, sagte sie.
»Ob ich nicht lieber einen Arzt anrufe?«, schlug Linda zögernd vor. »Vielleicht ist es etwas Schlimmes?«
»Unsinn, an mir verdient kein Arzt etwas. Eine Schoenau wird nicht krank. Und schon gar nicht ein paar Tage vor Semesterschluss. In vier Tagen, das weißt du ja, fahre ich nach Spanien, und da werde ich mich doch nicht hier ins Bett legen.«
»Ich weiß nicht, aber wenn man sich nicht wohlfühlt, sollte man einen Arzt kommen lassen.«
« ... sprach die reiche Dame. Wir armen Leute gehen zum Arzt, wenn uns etwas fehlt, das ist nämlich billiger. Ach, Linda, wie schön muss es sich in deiner Welt leben lassen.«
Das Seltene und ungeheuer Sympathische an Jenny Schoenau war, dass sie ihre Freundin nicht um ihren Reichtum beneidete. Sie kannte keinen Neid, obwohl es ihr im Leben bestimmt schon schlecht genug gegangen war.
Fahrig fuhr sich Jenny mit der Hand über die Stirn. Sie war mit kaltem Schweiß bedeckt, und kalt war ihr auch sonst, obwohl draußen eine hochsommerliche Hitze herrschte. Sie zog die wollene Decke fest um sich, aber warm wurde ihr trotzdem nicht.
»Du hast Fieber«, stellte Linda fest. »Deine Haut ist ganz heiß und fleckig, und deine Augen glänzen so seltsam!«
»Wirklich Zeit für den Kamillentee«, stimmte Jenny ihr zu. »Ich könnte etwas Heißes im Magen vertragen. Macht es dir etwas aus, barmherzige Samariterin zu spielen? Ein Päckchen Kamillentee muss noch in meinem Koffer liegen. Die eiserne Ration, die Mutter mir immer mitgibt.«
Aber auch der Tee half Jenny nicht, das Fieber stieg noch immer, bis es Linda schließlich zu dumm wurde.
»Ich rufe einen Arzt an, ganz egal, was du sagst! Kranke haben keinen eigenen Willen.«
»Schimpf doch nicht so mit mir, Linda. Aber rufe einen billigen ...«
»Im Telefonbuch stehen leider keine Preise.« Linda von Wussow wurde unwirsch. »Er will in etwa einer Stunde hereinschauen«, richtete sie Jenny aus, als sie den Hörer auf die Gabel zurückgelegt hatte. »Wahrscheinlich wirst du morgen gar nicht in die Universität können.«
»Das ist auch egal. So ein paar Tage vor Semesterschluss ist doch nichts mehr los. Ich werde anfangen, meine Sachen zu packen. Wie gut, dass sie mich im Reisebüro wiederhaben wollen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Absage bekommen hätte ...«
***
»Blinddarm«, sagte der Arzt nach kurzer Untersuchung. »Darf ich von hier aus telefonieren?« Er wartete Lindas Antwort gar nicht ab. »Schicken Sie sofort einen Krankenwagen. Wie ist noch die Adresse?«, fragte er die junge Dame.
Linda nannte erstickt Straße und Hausnummer.
»Muss sie operiert werden?«, wollte die Komtess besorgt wissen.
»Selbstverständlich. Und zwar recht bald. Sie hätten mich früher anrufen sollen. Ich dachte, jedes Kind in Deutschland kennt die Symptome einer Blinddarmentzündung. In zehn Minuten ist der Krankenwagen da. Packen Sie Zahnbürste und was Ihre Freundin sonst noch braucht ein.«
»Und – was wird das kosten?«, fragte Jenny, die dem Gespräch mit angstvoll geweiteten Augen gefolgt war.
»Geld«, erwiderte der Arzt grob. »Um Himmels willen, machen Sie sich jetzt keine Gedanken um die Kosten. Es wird höchste Zeit, dass man Ihnen den Blinddarm herausnimmt, das ist wichtig. Irgendjemand wird die Sache schon bezahlen.«
»Der Irgendjemand bin ich. Sie haben gut reden, Doktor.« Jenny schloss erschöpft die Augen. »Und in vier Tagen spätestens muss ich abfahren.«
»Darf ich mitkommen?«, fragte Linda den Arzt, als die Türklingel anschlug und zeigte, dass der Krankenwagen eingetroffen war.
»Nötig ist es nicht. Eine Blinddarmoperation ist keine Sache auf Leben und Tod.«
Eine halbe Stunde später aber saß Linda im Wartezimmer des Krankenhauses, während Jenny operiert wurde.
***
»Dass man sich so elend fühlen kann«, stöhnte Jenny, als Linda später an ihrem Bett saß. Sie war aus der Narkose erwacht, und ihr Gesicht hatte einen Farbton zwischen Gelb und Grün.
»Morgen wird es dir besser gehen«, tröstete Linda. »Wie fühlt man sich ohne Blinddarm?«
»Wie mit Blinddarm. Dass das verdammte Ding sich gerade jetzt rühren musste. Ich habe schon alle Unterlagen für die Reiseleitung, es ist unmöglich, dass ich absage. Aber ich kann doch nicht in meinem Bett fahren. Ich bin ein geborener Pechvogel, so etwas kann auch nur mir passieren.«
»Dann fährst du eben vierzehn Tage oder drei Wochen später. Länger brauchst du nicht im Krankenhaus zu bleiben.«
»Ich habe eine Liste der ersten Gäste. Über vierzig Leute, die ich betreuen muss. Was meinst du, was für einen Spektakel die machen, wenn am Zielort niemand ist, der sie an die Hand nimmt und in ihre Zimmer führt. Das ist ja alles im Reisepreis inbegriffen. Das Büro wird mich hinauswerfen wie die Amerikaner ihre Raketen in den Weltraum. Aber die kommen wenigstens zurück.«
»Weißt du was?« Linda, die bequem neben dem Bett gesessen hatte, richtete sich mit einem Ruck kerzengerade auf. »Ich fahre für dich nach Spanien, und sobald du dich erholt hast, kommst du nach. Wir brauchen deinem Büro überhaupt nichts zu erzählen, dass du krank bist.«
»Du bist verrückt«, entgegnete Jenny schlicht und hielt sich ihr Taschentuch vor den Mund. »Haben sie dich aus Versehen auch mit narkotisiert?«
»Aber warum soll das nicht gehen? Du erzählst mir ganz genau, was ich tun muss. Und so dumm bin ich schließlich nicht, dass ich dich nicht ein paar Wochen lang vertreten könnte.«
»Du sagst das, als meintest du das ernst.«
Jenny schloss die Augen. »Lass uns morgen darüber sprechen, heute kann ich noch nicht klar denken. Diese Narkose ...« Das Zimmer roch noch süßlich nach dem Narkosemittel, und Linda verabschiedete sich gern.
Die Benommenheit, die sich auch bei ihr eingestellt hatte, verflog erst draußen vor dem Krankenhaus, als sie ein paarmal tief Luft geholt hatte.
»Warum soll ich nicht an Jennys Stelle Reiseleiterin spielen?«, fragte sie sich.
Je länger sie über ihre Absicht nachdachte, desto besser gefiel sie ihr. Und eigentlich konnte ja auch nichts schiefgehen. Sie tat ja nichts Verbotenes, wenn sie für ihre erkrankte Freundin einsprang; im Gegenteil, auch den Leuten vom Reisebüro war doch nur damit geholfen.
In der Nacht schlief Linda unruhig, weil ihre Fantasie ihr lockende Abenteuer vorgaukelte. Sie hatte noch nie eine Pauschalreise mitgemacht. Ein Fräulein von Wussow pflegte im eigenen Wagen zu fahren und im besten Hotel des Ortes abzusteigen. Aber gerade das war es ja, was sie so sehr reizte, das Neue, das ganz andere ...
***
»Wie wohltuend, dich hier zu sehen«, empfing Jenny am nächsten Morgen ihre Freundin. Sie sah sehr viel besser aus als gestern. Ihr Gesicht hatte frische Farben, und in ihren braunen Augen funkelte schon wieder der gewohnte Humor.
Nach den üblichen Fragen des Ergehens kam Linda sofort auf das Gespräch des gestrigen Abends zurück.
»Du musst mir jetzt alles über deine Tätigkeit erzählen«, verlangte sie. »Und für ein paar Tipps wäre ich dir auch dankbar.«
»Das geht nicht gut.« Jenny schüttelte bekümmert den Kopf. »Ich habe böse Vorahnungen. Ja, wärst du ein Mädchen wie ich, ich würde keine Sekunde zögern, aber so, wie du aufgewachsen bist ...«
»Warum willst du dich nicht von mir vertreten lassen?«, fragte Linda ein wenig erbost. »Da muss doch irgendein Haken dabei sein.«
Jenny legte ihr impulsiv die Rechte auf den Unterarm.
»Ich denke nur an dich. Ich möchte nicht, dass du – dass du so gedemütigt wirst, wie es mir manchmal passiert ist. Warum willst du dir die Semesterferien verderben? Irgendwie komme ich auch schon durch, ich hatte gestern Abend nur meine pessimistischen fünf Minuten, als ich so stöhnte. Nimm das alles nicht so ernst. Ich werde dem Büro telegrafieren, dass mein Blinddarm gestern hier im Krankenhaus Anker geworfen hat, und die werden irgendeine Vertreterin losschicken müssen. Und wenn sie mich dann später nicht mehr haben wollen ...«
»Du bist ein verdammt feiner Kerl, Jenny«, sagte Linda gerührt. »Die erste wirkliche Freundin. Und deshalb fahre ich auch. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir es zusammen nicht schaffen würden, deine Stellung zu retten!«
Jenny fuhr sich verstohlen über die Augen.
»Also wenn du so fest entschlossen bist, ich werde es dir nie vergessen, Linda.«
Den Rest des Vormittags sprach fast ausschließlich Jenny Schoenau. Sie erzählte eingehend von den Hotels und Pensionen, die vom Reisebüro belegt wurden, machte sie mit den Besitzern bekannt, erwähnte die Eigenarten, und einmal lächelte sie sogar strahlend.
»Ich schaff das schon. Ich werde recht nett lächeln«, versicherte Linda.
»Lächle nur nicht zu nett, das könnte missverstanden werden. Ach, Linda ...« Jenny seufzte, aber gar so traurig wie gestern Abend klang es nicht mehr.
Ihr lag wirklich sehr viel daran, die Stellung als Reiseleiterin zu behalten. Und ein paar Tage hatte sie ja noch Zeit, Linda auf die Strapazen ihrer Aushilfstätigkeit vorzubereiten.
***
»Diesen Brief öffne bitte erst, wenn ich abgefahren bin«, bat Linda am Vormittag des Tages, an dem sie den Zug besteigen würde, der sie in den heißen Süden bringen sollte. »Nein, besser ist es wohl, ich gebe ihn der Schwester, damit sie ihn dir nach dem Abendessen aushändigt.«
Linda wusste nämlich, dass ihre Freundin Jenny ein wenig neugierig war, wobei wenig eine arge Untertreibung war.
»Traust du mir so wenig zu?«, fragte Jenny anklagend und hielt das Kuvert fest. Sie machte große unschuldige Augen. »Ich bin doch kein Kind mehr und kann warten.«
»Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich den Brief der Schwester gebe«, wiederholte Linda lachend, denn trotz allen Bemühens war es Jenny nicht gelungen, die Neugierde zu verbergen.
»Du bist ein richtiges Scheusal«, klagte die Patientin. »Jetzt ist es erst neun Uhr, und bis heute Abend ... Was steht denn in dem Brief drin? Gib mir doch wenigstens einen Tipp. Ich weiß sowieso nicht, was du mir schreiben könntest. Irgendwelche Verhaltungsmaßregeln, falls deine Eltern sich mit mir in Verbindung setzen wollen? Oder dreht es sich vielleicht um Karl-August?«
Das war ein Student, der Linda seit Langem hoffnungslos, aber ausdauernd verehrte.
Die junge Dame lächelte geheimnisvoll.
»Also nochmals alles Gute, Jenny, und wenn irgendetwas Unvorhergesehenes eintreten sollte, weißt du ja, wo du mich erreichen kannst.«
»Die Adresse kenne ich.« Jenny Schoenau seufzte abgrundtief, als Linda den Brief in ihre Handtasche zurücksteckte und das Krankenzimmer verließ.
Und als sie dann abends im Sonderwagen des Reiseunternehmens saß, schmunzelte sie still vergnügt vor sich hin. Der Brief enthielt Geldscheine im Wert von tausend Mark. Sie wusste, dass Jenny das Geld nicht von ihr angenommen hätte, aber wenn sie die knisternden Scheine erst einmal in der Hand hatte, dann würde sie der Versuchung wohl kaum widerstehen können, sie zu behalten.
Und was waren tausend Mark für Linda von Wussow? Sie brauchte ja nur ihren Vater anzurufen, dann schickte er ihr so viel sie wollte ...
***
Erst spät am Abend des nächsten Tages erreichte sie mit dem Zug der spanischen Staatsbahn ihren Zielort.
Jenny wohnte privat, und ihr Hotelzimmer, das ihr zustand, vermietete sie unter der Hand an Autotouristen. »Man muss mitnehmen, was man kriegen kann«, hatte sie Linda diesen kleinen Schwindel erklärt.
Die Wirtin überschüttete Linda mit einem Wortschwall, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie ihr Anliegen vortragen konnte. Und noch länger dauerte es, bis die füllige Spanierin ihr glaubte. Es war gut, dass Jenny ihr einen Brief an sie mitgegeben hatte, den sie, jede Silbe buchstabierend, im trüben Licht der Flurbeleuchtung las. Ihr Zeigefinger glitt dabei die Zeilen entlang und verharrte lange bei schwierigen Wörtern.
»Also, wenn das so ist ...«, sagte sie dann schließlich und schaute Linda von oben bis unten an, »dann heiße ich Sie herzlich willkommen in unserem Heim. Ich bin Frau Rodrigo. Und Sie sind wohl Fräulein Linda! Sie bekommen dieselbe Kammer wie letztes Jahr Fräulein Jenny. Und wenn Sie essen wollen, kommen Sie einfach nach unten.«
Linda war froh, als die Frau sie allein ließ. Sie packte den Koffer aus und hängte ihre Sachen in den Schrank. Sie hatte selbstverständlich nur ihre schlichtesten Kleider mitgenommen bis auf zwei oder drei schöne Stücke. Vielleicht ergab sich eine Gelegenheit, sie zu tragen.
Als Linda später ins Wohnzimmer der Rodrigos trat, wurde sie von sieben oder acht Kindern, so schnell konnte sie die Kleinen nicht zählen, neugierig und erwartungsvoll angeschaut. Keines sagte ein Wort. Es lag eine Stille im Raum, die Linda herausforderte, etwas zu sagen. Aber was sagte man zu Kindern, zu fremden noch dazu?
Also schaute Linda genauso stumm in die neugierigen Gesichter.
»Wollt ihr hier wohl ›raus!« Frau Rodrigo klatschte in die Hände, und es war, als hätte sie ein Hühnervolk verscheucht, so stoben die Kinder davon. Entrüstet schüttelte die stolze Mutter den Kopf. »Das dürfen Sie ihnen nicht übelnehmen«, wandte sie sich an Linda. »Unser Fräulein Jenny hat ihnen nämlich immer etwas mitgebracht.«
»Das habe ich vergessen.« Linda erinnerte sich, dass Jenny die reizenden Kinder der Familie Rodrigo erwähnt hatte. »Ich gehe gleich in den Ort und kaufe ihnen etwas. Was mögen sie denn gern?«
Die Tür, hinter der ein Teil der Kleinen verschwunden war, wurde aufgerissen.
»Eis!«, schrie jemand, und bevor die empörte Mutter erkennen konnte, wer es gewesen war, knallte die Tür auch schon wieder zu.
»Schrecklich«, behauptete die füllige Frau, aber es klang nicht echt. Linda merkte, wie sehr sie ihre Kinder liebte. Eigentlich doch eine nette Frau, dachte sie, als diese ihr einen Teller mit Suppe füllte und daneben ein Stückchen Weißbrot legte. »Trinken Sie auch roten Wein oder lieber weißen?«
»Roten, wenn ich bitten darf.« Linda merkte erst jetzt, dass sie trotz der anstrengenden Fahrt Hunger hatte, und solch eine Suppe rutschte am besten.
Aber als Frau Rodrigo ihr nachfüllen wollte, wehrte sie entsetzt ab.
»Unmöglich, ich bin satt bis obenhin«, beteuerte sie.
Die Matrone schüttelte den Kopf.
»Sie sind viel zu dünn, Fräulein Linda. Wie wollen Sie denn da einen Mann finden?«
Und irgendwie fühlte sich Linda jetzt sogar schuldbewusst.
»Ich bin vielleicht ein bisschen abgespannt; morgen werde ich mehr essen können«, meinte sie. »Jetzt möchte ich mich hier im Ort umschauen. Wenn Sie gestatten, darf ich Ihre Kinder zu Eis einladen?«
»Sag Ja!«, ertönte es hinter der Tür.
Im Geiste sah Linda die Kinder dort übereinander sitzen und hocken, die Ohren ans Holz gepresst, um sich nur ja kein Wort entgehen zu lassen.
»Dann kommt mit!« Linda lächelte schüchtern auf die Gesichter hinab, die sich um sie drängten. Das kleinste Kind konnte kaum laufen, aber es schien selbstverständlich, dass es sich von der Einladung betroffen fühlte.