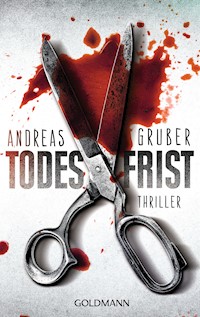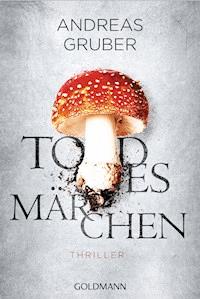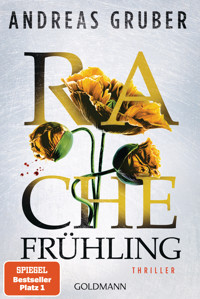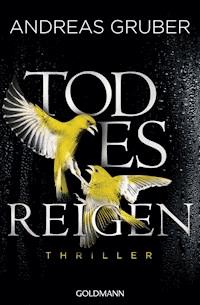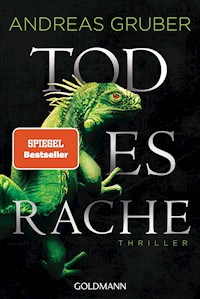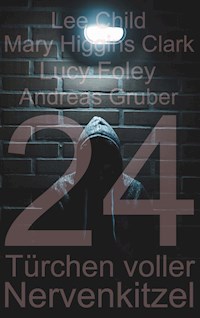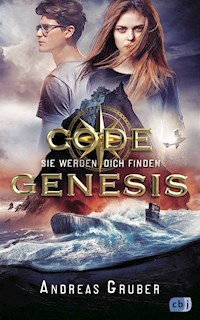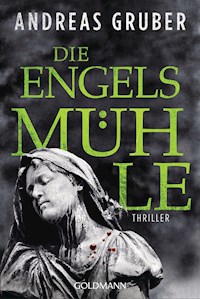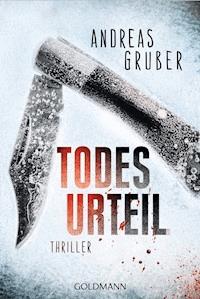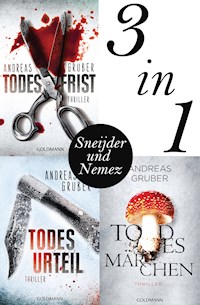
Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez: Todesfrist / Todesurteil / Todesmärchen E-Book
Andreas Gruber
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Todesfrist
»Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum ich diese Frau entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht – stirbt sie.« Mit dieser Botschaft beginnt das perverse Spiel eines Serienmörders.
Todesurteil
In Wien verschwindet die zehnjährige Clara. Ein Jahr später taucht sie völlig verstört am nahen Waldrand wieder auf. Ihr gesamter Rücken ist mit Motiven aus Dantes "Inferno" tätowiert – und sie spricht kein Wort.
Todesmärchen
In Bern wird die kunstvoll drapierte Leiche einer Frau gefunden, in deren Haut der Mörder ein geheimnisvolles Zeichen geritzt hat. Sie bleibt nicht sein einziges Opfer. Der niederländische Profiler Maarten S. Sneijder und BKA-Kommissarin Sabine Nemez lassen sich auf eine blutige Schnitzeljagd ein – doch der Killer scheint ihnen immer einen Schritt voraus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1832
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Andreas Gruber
TodesfristTodesurteilTodesmärchen
Drei Thriller
Goldmann
Todesfrist
»Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum ich diese Frau entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht – stirbt sie.« Mit dieser Botschaft beginnt das perverse Spiel eines Serienmörders. Er lässt seine Opfer verhungern, ertränkt sie in Tinte oder umhüllt sie bei lebendigem Leib mit Beton. Verzweifelt sucht Kommissarin Sabine Nemez nach, einem Motiv. Erst als sie den niederländischen Profiler Maarten S. Sneijder hinzuzieht, entdecken sie zumindest ein Muster: Ein altes Kinderbuch dient dem Täter als grausame Inspiration – und das birgt noch viele Ideen ...
Todesurteil
In Wien verschwindet die zehnjährige Clara. Ein Jahr später taucht sie völlig verstört wieder auf. Ihr gesamter Rücken ist mit Motiven aus Dantes »Inferno« tätowiert – und sie spricht kein Wort. Indessen nimmt der Maarten S. Sneijder an der Akademie des BKA für hochbegabten Nachwuchs mit seinen Studenten ungelöste Mordfälle durch. Seine beste Schülerin Sabine Nemez entdeckt einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen. Und das Werk dieses Killers ist noch nicht beendet. Seine Spur führt nach Wien – wo Clara die einzige ist, die ihn je zu Gesicht bekommen hat …
Todesmärchen
In Bern wird die kunstvoll drapierte Leiche einer Frau gefunden, in deren Haut der Mörder ein geheimnisvolles Zeichen geritzt hat. Sie bleibt nicht sein einziges Opfer. Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez lassen sich auf eine blutige Schnitzeljagd ein – doch der Killer scheint ihnen immer einen Schritt voraus. Währenddessen trifft die junge Psychologin Hannah im norddeutschen Steinfels ein, einem Gefängnis für geistig abnorme Rechtsbrecher. Sie soll eine Therapiegruppe leiten, ist jedoch nur an einem einzelnen Häftling interessiert: Piet van Loon. Der wurde einst von Sneijder hinter Gitter gebracht. Und wird jetzt zur Schlüsselfigur in einem teuflischen Spiel ...
Weitere Informationen zu Andreas Gruber sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Todesfrist: Copyright © 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Todesurteil: Copyright © 2015 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Todesmärchen: Copyright © 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle drei Werke wurden vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur.
www.ava-international.de/www.agruber.com
Gestaltung der Umschläge: UNO Werbeagentur München
Todesfrist: Umschlagfoto: FinePic®, München
Todesurteil: Umschlagfoto: Reilika Landen/Arcangel Images; FinePic®, München
Todesmärchen: Umschlagfoto: FinePic®, München
Redaktion Todesfrist: Verlagsbüro Oliver Neumann
Redaktion Todesurteil/Todesmärchen: Vera Thielenhaus
TH • Herstellung: mw
ISBN: 978-3-641-27797-0V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Andreas Gruber
Todesfrist
Thriller
FürHeidemarie, Veronika und Günter,vielen Dank, ihr Lieben
Prolog
Der Fahrstuhl fuhr mit einem gleichmäßig surrenden Geräusch in die Tiefe. Die Tür glitt auf, und blasses Neonlicht fiel in die Kabine.
Carmen lief durch die menschenleere Tiefgarage. Wie sie den grauen Beton und das sterile Licht hier unten hasste! Immer wenn ihre Nachtschicht am Montagmorgen um fünf Uhr endete, lag das zweite Untergeschoss in bedrückender Stille. Die Autos hockten wie lauernde Kreaturen im Schatten der Säulen, nur die Motorhauben ragten ins Licht. Kein Mensch weit und breit. Manchmal trieben sich im Keller des Instituts für Pathologie der Wiener Universität Verrückte herum. Sie fragte sich, ob sie eine siebenundvierzigjährige Frau überfallen würden. Stiegen ihre Chancen, in Ruhe gelassen zu werden, mit zunehmendem Alter, oder sanken sie?
Carmen fröstelte in der weißen Schwesterntracht, während sie zu ihrem Wagen lief. Stellplatz U2-P58. Seit drei Jahren dieselbe Nummer. Damenparkplätze. Die sonst flackernde Beleuchtung in dieser Ecke war komplett ausgefallen, und ein Müllsack von den Maler- und Renovierungsarbeiten verdeckte die Kamera wieder mal. Letzte Weihnachten hätten die Arbeiten fertig gestellt werden sollen – und jetzt war fast Ende März. Gingen dem Krankenhaus die Subventionen aus?
Carmen erreichte ihren VW Golf und betätigte den Knopf für die Zentralverriegelung. Die gelben Blinker zuckten zweimal auf. In diesem Moment bemerkte sie aus dem Augenwinkel den Schatten einer hoch gewachsenen Gestalt. Rasch trat der Kerl hinter der Säule hervor. Noch bevor sie sich wegdrehen und den Arm hochreißen konnte, spürte sie einen kurzen Einstich im Nacken.
Als Carmen die Augen aufschlug, umgab sie schwerfällige Dunkelheit. Sie war nicht in ihrem Schlafzimmer, ja nicht einmal in ihrer Wohnung. Sie vermisste das Ticken der Uhr, den Duft der frischen Bettwäsche und das rote Blinklicht des Videorekorders. Stattdessen roch es nach Feuchtigkeit, Holz und Zement.
Eine Baustelle?
Instinktiv wusste sie, dass sie nicht lag, sondern aufrecht stand. Woher? Sie hatte keine Ahnung. Vermutlich, weil ihr eine Träne über die Wange nach unten lief. Unwillkürlich wollte sie sie aus dem Gesicht wischen, doch ihre Arme hingen bleischwer und bewegungslos an ihr herunter. Augenblicklich wurde sie von Panik erfasst.
Was ist mit mir geschehen?
Sie wollte sich bewegen, den Kopf zur Seite drehen, doch sie war völlig erstarrt. Ihre Beine fühlten sich taub an. Sie konnte nicht einmal die große Zehe bewegen, als besäße sie keine Gliedmaßen mehr.
»Hallo?«, krächzte sie.
Ihre Stimme hallte von den Wänden wider. Es klang wie das Echo in einer Gruft. Trotzdem hörte sich der Ton merkwürdig gedämpft an und wurde vom Rauschen ihres Blutes überlagert. Wie im Urlaub am Strand von Kroatien, wo sie als junges Mädchen eine Muschel ans Ohr gepresst hatte, um der Brandung zu lauschen.
Sie schloss die Augen. Dieser merkwürdige Geruch! Zwischen dem steinigen und erdigen Mief lag eine Spur von Weihrauch. Verrückt!
Ihre Zunge tastete über die Lippen. Körniger Staub. Sie schluckte. Was für ein säuerlicher Geschmack! Plötzlich kam der Brechreiz. Sie musste würgen und spie bitteren Gallensaft aus, der ihr übers Kinn lief.
Was ist bloß passiert?
Sie konnte nicht richtig ausspucken und den Kopf weder drehen noch senken. Eine harte, scharfe Kante umrahmte ihr Gesicht. Auch das Atmen fiel ihr schwer, als schnürte ein eng anliegendes, eisernes Korsett ihre Brust ein.
»Hallo?«
Verdammt! Hoffentlich war es bloß ein Albtraum. Wie oft war sie nachts ans Bett ihrer Kinder gelaufen, um die beiden zu trösten, wenn sie schrien? Schlaf weiter, Kleines, es war nur ein böser Traum! Mami ist da. Mittlerweile lebte sie allein in ihrer Wohnung.
Aber das hier passierte wirklich. Zu real waren der Geschmack in ihrem Mund und das Kratzen in ihrer Kehle. Zu deutlich trommelten die pochenden Kopfschmerzen von innen an ihre Schädeldecke, immer heftiger, je mehr sie sich zu bewegen versuchte.
Welcher Tag ist heute?
Sie wollte ihre Schläfen massieren. Meistens half das beim Denken. Warum konnte sie die Hände nicht bewegen? Ihre Finger waren so taub, als hätte ihr jemand sämtliche Nerven durchtrennt.
Konzentrier dich! Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Plötzlich kam die Erkenntnis. Die Tiefgarage! Der Kerl hinter der Säule! Der Stich in den Nacken! Danach war ihre Erinnerung verblasst.
»Hilfe!« Mit rasendem Herzen bemerkte Carmen, dass sie nicht mehr bloß Hallo, sondern um Hilfe rief. Immer lauter, bis sie keine Puste mehr hatte und wegen des Drucks auf ihrer Brust nur noch flach atmen konnte.
Endlich hörte sie jemand.
In unmittelbarer Nähe tauchte ein Lichtstrahl unter einem Türschlitz auf. Allerdings war der Schein zu schwach, um in dem Raum etwas zu erkennen. Schritte kamen auf die Tür zu. Langsam und desinteressiert. Es klang, als stiege jemand eine Treppe herunter.
Instinktiv zählte Carmen mit. Sechzehn Stufen. Dieser Raum lag also ein Stockwerk tiefer.
Tiefer als was?
»Hilfe!«, rief sie erneut.
Da erklang das metallene Schaben eines Schlüssels im Schloss. Eine Kette rasselte.
War es eine gute Idee gewesen, ausgerechnet jetzt um Hilfe zu rufen? Sie hätte damit warten sollen, bis die Lähmung verflogen war. Dann hätte sie den Raum zuvor nach einer Fluchtmöglichkeit oder zumindest einer Waffe durchsuchen können. Carmens Herz raste. Bestimmt kam da der Mistkerl, der ihr die Injektion verpasst hatte!
Die massive Metalltür wurde aufgedrückt. Der Lichtstrahl tanzte in den Raum und blendete sie für einen Moment. Der Mann trug eine Stirnlampe. Carmen kniff die Augen zusammen, sah aber nur seinen schlanken Körper von der Hüfte an abwärts. Er trug eine graue Hose und Arbeitsschuhe. War es überhaupt ein Mann?
»Wer sind Sie?«, keuchte sie.
Was für eine blöde Frage, dachte sie im selben Moment. Der Mistkerl würde ihr keine Antwort geben. Er ging auf sie zu. Schutt und Kieselsteine knirschten unter seinen Schuhsohlen. Unwillkürlich musste Carmen an den Geruch nach Baustelle denken. Befand sie sich im Keller eines Rohbaus? Oder noch in der Tiefgarage der Pathologie? Nein, im Krankenhaus war sie definitiv nicht. Dort hatte sie noch nie den Geruch von Weihrauch bemerkt.
»Was wollen Sie von mir?«
Auch diesmal gab er keine Antwort. Bestimmt würde sie es früh genug erfahren. Allerdings konnte er sie nicht ewig hier festhalten. Bald würde sie Arme und Beine wieder bewegen können, und dann gnade ihm Gott. Was immer er mit ihr vorhatte – er würde sein Ziel nicht erreichen. Der Gedanke, dass er sie feige von hinten mit einer Spritze überwältigt hatte, machte sie so wütend, dass sie ihm den nächstbesten Gegenstand, den sie in die Finger kriegen würde, an den Schädel schlagen wollte.
Da öffnete der Kerl den Mund. Seine Stimme klang verzerrt, als hätte er einen defekten Kehlkopf oder einen Schnitt in der Luftröhre.
»Ich habe dir ein Anästhetikum injiziert …«
Bursche, du hast keine Ahnung, was ich mit dir anstelle, sobald du mir für einen Augenblick den Rücken zuwendest. Du hast dir die Falsche ausgesucht!
»… und ein Muskelrelaxans.«
Er verzichtete auf weitere Erklärungen. Sie waren nicht notwendig. Aufgrund ihrer Kleidung wusste er, dass sie Krankenschwester war. Der Ausweis an ihrer Bluse wies sie als Mitarbeiterin der Gynäkopathologie aus.
»Allerdings habe ich auf ein Analgetikum verzichtet.« Seine Stimme klang so emotionslos, als langweilte ihn die Erklärung. Die Stirnlampe blendete sie wieder. Diesmal länger. Offensichtlich beobachtete er ihre Reaktion.
Von den Dutzenden Fragen, die ihr gleichzeitig durch den Kopf schossen, beschäftigte sie eine am meisten: Warum verbarg er sein Gesicht vor ihr? Kannte sie ihn? Möglicherweise hatte er nicht vor, sie zu töten. Der Gedanke entspannte sie. Doch irgendetwas hatte er mit ihr vor. Was immer es war, sie würde die erste Möglichkeit nutzen, ihn zu töten, bevor er ihr etwas antun konnte. War sie dazu überhaupt in der Lage? Sie zweifelte keinen Moment daran. Ob sie nun ihrem Chefarzt beim Sezieren assistierte und das Skalpell beim Brustbein eines Toten ansetzte und bis zum Nabel hinunterzog oder diesem Kerl einen Nagel oder stumpfen Bleistift in die Niere oder Lunge stieß … wo lag da der Unterschied? Wenn er röchelnd vor ihr kauerte, würde sie nicht einmal ein schlechtes Gewissen plagen.
Du hast dir die Falsche ausgesucht! Besser wäre die junge Blondine aus dem Sekretariat gewesen.
»Hörst du mir zu?« Die blecherne Stimme klang herablassend, was Carmen noch mehr ärgerte.
Sie antwortete nicht. Natürlich hatte sie ihm zugehört. Jedes einzelne, verdammte Wort hatte sie mitbekommen. Anästhetikum, Muskelrelaxans und Analgetikum wurden normalerweise vor Operationen verwendet, um die Patienten bewusstlos, bewegungsunfähig und schmerzunempfindlich zu machen. Meist wurde das Analgetikum nachdosiert – doch darauf hatte dieser Mistkerl verzichtet, wie er behauptete. Allerdings hatte sie bis auf rasende Migräne keine Schmerzen. Was zum Teufel hatte er mit ihr vor?
Als hätte er ihre Frage erraten, trat er einen Schritt näher. Ein greller Lichtring blendete sie. »Brandopfer sterben meistens, weil die Zellatmung versagt, sobald mehr als zwei Drittel der Haut zerstört sind. Damit dir nicht das Gleiche passiert, sind deine Hände und Füße in Müllsäcke gewickelt. Du trägst einen Regenmantel und eine alte Seglerhose.«
In Carmens Kopf stoppten alle Gedanken. Schlagartig hatte der Unbekannte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Die Kleider sind zwar nicht atmungsaktiv, aber zumindest Wasser abweisend. Das verhindert die Verätzung der Haut durch den scharfen Zement.« Er machte eine Pause. »Jedenfalls an den wichtigsten Stellen.«
Wovon zum Teufel sprach der Kerl? Carmen versuchte, die Finger zu bewegen, den Kopf zu drehen und in den Nacken zu legen, doch ohne Erfolg.
»Im Lauf der Zeit tritt allerdings ein gewisser Juckreiz auf, wenn sich Schweiß sammelt, Pilze und Parasiten bilden. Ich hoffe, du verfügst über ein gutes Immunsystem und benötigst kein regelmäßiges Medikament – denn das wirst du hier unten nicht bekommen. Du hast keinen freien Venenzugang mehr.«
Carmen nahm täglich Blutdrucktabletten, etwas anderes jedoch nicht. Sie schluckte den galligen Geschmack runter und merkte, wie ihr Brustkorb zusehends eingeengt wurde. »Was …?«, krächzte sie.
Seine Stimme klang gefühllos. »Habe ich endlich dein Interesse geweckt?«
Sie antwortete nicht. Das alles ergab keinen Sinn. Doch er ließ ihr keine Zeit, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Ich werde dafür sorgen, dass du nicht an einer Nierenintoxikation stirbst.«
Warum sollte sie an einer Nierenvergiftung sterben? Der Kerl nahm Begriffe in den Mund, die sonst nur Ärzte oder Krankenpfleger verwendeten. Kannte sie ihn aus der Pathologie oder einem anderen Institut? Es gab immer wieder Berührungspunkte mit anderen Abteilungen. Womöglich war er einer der knapp zehntausend Angestellten des Allgemeinen Krankenhauses Wien und ihr dort schon einmal über den Weg gelaufen.
Wie viel Zeit war verstrichen, seit er ihr das Anästhetikum injiziert hatte? Acht Stunden? Bestimmt wurde im Krankenhaus bereits nach ihr gesucht.
»Siehst du …« Er machte einen weiteren Schritt auf sie zu und senkte den Kopf. Das Licht fiel zu Boden. »Diese beiden Schläuche sorgen dafür, dass es zu keinem Rückstau kommt. Jeden zweiten Tag werde ich dir etwas zu essen und zu trinken bringen.«
Ihr Herz tat einen Satz. Sie wollte den Kopf senken, doch das ging nicht. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er einen dünnen Kunststoffschlauch aus den Fingern gleiten ließ, dessen Ende in einen Metalleimer plumpste.
»Einen Schmerz kann ich dir allerdings nicht nehmen.« Er atmete tief ein. Carmen bemerkte die Erregung in seiner verzerrten Stimme, als hätte er lange auf diesen Augenblick gewartet. »Ich weiß nicht, wann die Ankylose einsetzt, aber ich denke, schon bald werden sich deine Gelenke versteifen. Deine Wirbelsäule wird verknöchern, und deine Fingernägel werden in den Körper zurück wachsen. Doch davon wirst du nichts mehr mitbekommen.« Die Stimme klang, als lächelte er. »Platzangst und die psychische Belastung werden dich vorher in den Wahnsinn treiben.«
Sie brachte kein Wort heraus. Ihr Gedanke, ihn zu töten, war wie wegradiert. Er war gefährlich und verrückt. Langsam kroch Panik in ihr hoch. Vielleicht war doch alles nur ein Albtraum, dachte sie. Einer von der schlimmen Sorte, bei der man Gott dankt, dass er nicht real ist, sobald man erwacht.
»Ich brauche Wasser«, krächzte sie. Ihr Mund war vollkommen trocken.
»Morgen«, antwortete er.
»Was haben Sie mit mir vor?«
Er stand unmittelbar vor ihr und studierte ihre Gesichtszüge. Sie roch seinen Atem. »Hast du es noch nicht begriffen?«
Er trat einige Schritte zurück und langte nach oben. Sie sah nicht, was er herunterholte, hörte nur das Klirren einer Kette. Offensichtlich zog er an einem Flaschenzug.
»Der Mörtel war erst nach acht Stunden trocken. Danach habe ich den Block mit diesem Flaschenzug aufgestellt.«
Er ließ die Kette los und trat hinter Carmen. Das Licht seiner Stirnlampe fiel auf einen Spiegel, der am Ende der Kette baumelte. Der Schimmer wurde reflektiert und tanzte über die Wände. Rote Backsteinziegel. Kein Verputz. Das Gewölbe war leer und reichte nicht weit nach hinten – wie ein kleiner Weinkeller. Carmen glaubte Haken an der Steindecke zu erkennen.
»Ich hoffe, du gerätst bei deinem Anblick nicht in Panik. Denk immer daran: Dein Brustkorb ist eingeengt. Du kannst nur flach atmen! Je ruhiger du reagierst, desto besser. Sobald du hyperventilierst, erstickst du.«
Der Spiegel drehte sich, sodass sie für einen Augenblick ihr Gesicht sehen konnte.
Und sie sah … nur ihr Gesicht!
Angst, Panik und Wahnsinn stiegen zugleich in ihr hoch.
»Nein!«, rief sie. »Nein, bitte nicht … Gott, nein …!«
Ihre Gedanken überschlugen sich. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Seine Erklärungen über die Haut, die Niere, die Wirbelsäule, die Platzangst und den Venenzugang. Sie besaß tatsächlich keinen freien Venenzugang mehr.
In dem vor ihr baumelnden Spiegel sah sie eine zwei Meter hohe und etwa sechzig Zentimeter breite Betonsäule in einer zur Hälfte abgeschlagenen Holzverschalung. Nur ihr Gesicht, von der Stirn bis zum Kinn, ragte aus der grauen Oberfläche … und zwei Schläuche in Hüfthöhe.
»Nein!«, rief sie. »Nein, bitte nicht!«
Sie begann zu weinen. Unwillkürlich spannten sich ihre Muskeln an, als könnte sie damit den Beton sprengen, doch je mehr sie versuchte, sich zu bewegen, desto weniger Luft bekam sie. Sie konnte ihren Brustkorb nicht heben.
Bitte, helft mir!
Jemand musste kommen und den Betonblock mit einem Hammer zerschlagen, bevor sie wahnsinnig wurde.
»Hilfe!«, kreischte sie, so laut sie konnte, und japste nach Luft. »Bitte lassen Sie mich frei«, bettelte sie. »Bitte!«
Sie würde ihm nichts tun. Sie versprach, wenn er sie jetzt aus dem Beton befreite, würde sie nicht einmal Anzeige gegen ihn erstatten. Sie würde alles verzeihen und vergessen.
»Bitte!«
Er trat wieder nach vorne. An der Stirnlampe merkte sie, wie er unmerklich den Kopf schüttelte.
»Ich habe dir vorsorglich ein Breitband-Antibiotikum injiziert. Außerdem werde ich dich gelegentlich mit Vitamintabletten versorgen, aber du wirst dennoch an Rachitis erkranken.« Er leuchtete ihr ins Gesicht. »Und deine Augen werden unter Fotophobie zu leiden beginnen.«
Zunächst begriff sie nicht, worauf er hinauswollte, da sie nur ihr Keuchen hörte und in Gedanken immer noch ihr entsetztes Gesicht sah. Doch er wiederholte seine Worte.
Vitaminmangel und Lichtempfindlichkeit? Diese Effekte würden sich erst nach Wochen einstellen. Wie lange wollte er sie in diesem Block gefangen halten?
Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie spürte den salzigen Geschmack auf den Lippen. »Wann lassen Sie mich hier raus?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich werde beobachten, wie du die nächsten Monate überlebst.«
Monate? Sechzig oder neunzig Tage? Ein halbes Jahr vielleicht! Sie war wie paralysiert. Dennoch blieb ein winziges Detail in ihrem Bewusstsein hängen.
Er hatte nicht gesagt, ob sie die nächsten Monate überlebte, sondern wie.
Wie?
In Angst und Wahnsinn!
»Bitte nicht! Sie müssen das nicht tun!«
»Oh!« Er neigte den Kopf. »Ich habe es schon getan.«
»Warum ausgerechnet ich?«
»Vielleicht kommst du von selbst drauf.«
»Warum, um Himmels willen?«
Plötzlich veränderte sich seine Stimme. Sie wurde heller, wie die eines Mädchens, das einen Kinderreim aufsagte.
Nein, das konnte alles nicht wahr sein. Carmen schloss die Augen und betete in Gedanken, endlich aufzuwachen, flehte immer intensiver, um die Stimme dieses Mannes nicht mehr hören zu müssen.
Bitte, lieber Gott. Mach, dass dieser Block umfällt und zerspringt! Mach, dass ich in meinem Bett aufwache und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen darf. Bitte!
Doch Gott erhörte sie nicht.
Stattdessen nahm sie wahr, wie der Mann sich von ihr entfernte, die Metalltür schloss, die Kette durch den Griff zog und die Treppe hochstieg.
Der Kinderreim begleitete ihn, Stufe um Stufe …
Ob der Philipp heute still,wohl bei Tische sitzen will?Also sprach in ernstem Ton,der Papa zu seinem Sohn.
1. Teil
Zwei Monate später
Sonntag, 22. Mai, bis Montag, 23. Mai
»Die Welt ist genau genommenein ziemlich riskanter Ort.Jede Menge schlimmer Dinge könneneinem da draußen zustoßen,und oft tun sie das auch.«
ANNA SALTER
1
Kerstin, Connie und Fiona richteten sich gleichzeitig im Bett auf. Die Kopfkissen und Teddybären flogen zur Seite.
»Was erzählst du uns morgen für eine Geschichte, Tante Bine?«, rief Kerstin aufgeregt.
Sabine hasste es, »Tante« genannt zu werden. Das machte sie alt, und mit sechsundzwanzig Jahren war sie das bei Gott nicht. »Morgen habe ich keinen Nachtdienst. Da bin ich zu Hause und erhole mich von euch Gören«, antwortete sie.
»Übermorgen!«, riefen die drei wie aus einem Mund.
Die Töchter ihrer Schwester – vier, fünf und sieben Jahre – sahen mit den blonden Mähnen nicht nur wie drei Orgelpfeifen aus, sondern konnten auch richtige Nervensägen sein.
»Übermorgen, Tante Bine, was erzählst du uns da?«, ließen sie nicht locker.
Sabine ging zum Fenster. Der Horizont lag bereits im orange-blauen Dämmerlicht. Bald würde ihr Dienst beginnen. Die Münchner Frauenkirche war beleuchtet. Die Hauben der beiden kraftvollen Türme ragten in weiter Ferne über die Hausdächer. Plötzlich erfasste sie ein dumpfes Gefühl im Magen, als stürbe ein Teil von ihr ab. Sabine schluckte den bitteren Geschmack runter. Sie wusste nicht, warum, aber der Anblick der Kirche erinnerte sie an den Tod. Rasch zog sie den gelben Spongebob-Vorhang zu. »Nächstes Mal bekommen wir einen Auftrag vom Vatikan.«
»Vom Papst?«, rief Fiona, die Älteste. »Warum?«
Sabine wusste nicht, was mit ihr los war. Sie versuchte sich selbst aufzuheitern. »Bald ist Pfingsten. Der Papst reist viel herum und braucht unser Team für einen besonders schwierigen Security-Auftrag.«
»Wo fahren wir hin?«
»Fahren?« Sabine hob die Augenbrauen. »Wir fliegen! Und zwar mit den schnellsten Helikoptern, die wir haben. Neu entwickelt, in unserem Geheimlabor.«
»Ist ja krass! Warum hat der Papst gerade uns gefragt?«
Fiona stieß ihrer Schwester den Ellenbogen in die Seite. »Weil wir die beste Ausrüstung haben!«
»Genau«, bestätigte Sabine. »Nachtsichtgeräte, Schutzwesten, Mikro-Funkgeräte.«
»Wow!«, rief Fiona. Kerstin machte große Augen. Connies Mund stand offen.
Es klopfte an der Tür, und Sabines Schwester lugte ins Kinderzimmer. »Schlafenszeit. Sagt gute Nacht zu Sabine.«
»Übermorgen arbeiten wir für den Sabst!«, rief Connie, die Kleinste, aufgeregt.
»Psst!« Sabine schüttelte unmerklich den Kopf. »Ein Geheimauftrag«, flüsterte sie. »Kein Wort zu eurer Mutter, sonst ist sie in Gefahr.«
»Oh, krass!«, riefen die Mädchen.
Sabine umarmte ihre Nichten und gab jeder einen Kuss. Dann schaltete sie das Licht aus, ließ die Tür einen Spaltbreit offen und ging zu ihrer Schwester in den Vorraum.
Monika schüttelte mit gespielter Empörung den Kopf. »Was erzählst du denen nur immer für Geschichten?«
»Sie lieben solche Storys.«
»Ich weiß«, seufzte Monika. »Mit meinen Feen-, Elfen- und Prinzessinnen-Geschichten kann ich einpacken. Aber übertreib es nicht!«
Obwohl Sabines um drei Jahre ältere Schwester schief am Türstock lehnte, war sie immer noch einen halben Kopf größer als sie. Kaum zu glauben, dass sie Schwestern waren. Sabine war zwar nur einen Meter sechzig groß, aber zum Glück hatte Gott sie mit einem trainierten, drahtigen Körper gesegnet. Sie nannte es ausgleichende Gerechtigkeit. Während ihre Schwester die Lehre als Verkäuferin abgebrochen hatte und nun halbtags Audioguide-Kopfhörer an die Besucher des Stadtmuseums verteilte, war Sabine in ein Sportgymnasium gegangen und hatte bis heute nicht aufgehört zu trainieren. Joggen, Pilates und Mountainbiken. Einige Kollegen neckten sie – ob sie damit ihre Größe kompensieren wolle. Pfeif drauf! Sie musste in ihrem Job fit bleiben.
Monika strich Sabine über die dunkelbraunen Haare und ließ eine gefärbte Strähne durch die Finger fließen. »Der silberne Streifen steht dir gut.«
»Ich weiß, danke. Aus Marokko, von unserem letzten Einsatz mit dem Security-Team. Kerstin will auch eine.«
»Oh Gott.« Als Monikas Blick auf das goldene Herz-Medaillon an Sabines Hals fiel, wurde sie ernst.
Vaters Geschenk. Sabine trug es seit der Trennung ihrer Eltern vor zehn Jahren, als sie mit Mutter von Köln zurück nach München gezogen waren. Sie wusste, was in ihrer Schwester vorging. Seit der Scheidung ihrer Eltern hatte Monika kein gutes Haar an Vater gelassen und alles aus ihrem Leben verbannt, was sie an ihn erinnerte. Sie wollte einfach nicht verstehen, dass Sabine noch an ihrem Vater hing. Dabei war es so einfach: An einer Trennung trug nie einer allein die Schuld. Gerade Monika hätte das am besten begreifen müssen.
»Hast du den Unterhalt für diesen Monat schon bekommen?«, fragte Sabine.
Monika ließ ihr Haar los. »Er ist drei Monate im Rückstand.«
»Kuhscheiße!«, fluchte Sabine. Ihr Exschwager war ein Arschloch.
»Leise!« Monika schmunzelte und deutete zur angelehnten Kinderzimmertür. »Die Gören sagen das auch schon.«
»Uh …« Sabine verzog das Gesicht. Dann wurde sie wieder ernst. »Soll ich was unternehmen?«
»Nein, Gabriel wird schon zahlen.«
Sabine nickte. Sie nahm ihre Dienstwaffe von der Kommode und steckte sie ins Holster. Am liebsten würde sie Gabriel einen Besuch abstatten. Ihre Schwester kämpfte sich als alleinerziehende Mutter mit den drei Mädchen gerade mal so durchs Leben – mit einem Teilzeitjob im Museum und einer fünfzig Quadratmeter großen Wohnung. Sie schlief auf der Wohnzimmercouch, während sich die Mädchen das Schlafzimmer teilten. Aber der Herr Anwalt rückte keinen Cent raus.
Sabine stopfte ihren Geldbeutel in die Jackentasche und schnürte die Schuhe zu. »Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an – ich habe Nachtdienst und bin auf dem Revier zu erreichen.« Sie steckte die Dienstmarke an den Hosenbund und zog die Jacke zu. Der Saum verbarg die Walther und das Reservemagazin am Hosengürtel.
»Ich weiß, Kleine.« Monika umarmte sie und drückte sie länger als sonst. »Danke. Ohne dich würde ich wahnsinnig werden.«
»Es wird schon. Morgen kommt Mutter zu Besuch und passt auf die Mädchen auf, nicht wahr?«
Monika nickte. »Wie geht’s Mutter übrigens? Du warst doch Freitagabend mit ihr wieder bei diesem komischen Kurs?«
Der Pilateskurs war nicht komisch, bloß die Vortragende. Eine fünfzigjährige Bohnenstange. Da spürte Sabine erneut dieses merkwürdige Gefühl im Magen. »Ich musste absagen. Hatte viel um die Ohren und fühlte mich nicht besonders.«
»Ups.« Monika hob die Augenbrauen. »Wie hat der alte Drachen reagiert? Ist er allein hingegangen?«
»Du weißt doch, wie Mutter ist. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich eine Parkemedtablette nehme und mich im Bett verkrieche. Seither habe ich nichts von ihr gehört.«
»Sie hat dich nicht mal zurückgerufen? Untypisch für Mutter.«
Wie wahr! Seit Tagen plagte Sabine das schlechte Gewissen, weil sie im Pyjama auf der Couch eine Doppelfolge der Tricks der großen Magier gesehen hatte und eingepennt war, statt zum Turnen zu gehen. Andererseits war ihre Mutter eine selbstständige Frau, um die sie sich nicht kümmern musste. »Wenn sie morgen kommt, gib ihr einen Kuss von mir. Wir holen Pilates diesen Freitag nach.«
»Okay, mach ich – und jetzt Abmarsch!« Monika gab ihr einen Klaps auf den Po. »Nimm die Schurken fest … im Polizeigriff!« Monika schnitt eine böse Grimasse und krümmte die Finger zu Krallen.
Sabine fuhr mit dem Fahrstuhl hinunter und verließ das Mietshaus, in dem ihre Schwester wohnte. Abends war die Gegend um den Ostbahnhof nicht so prickelnd. Ihr Wagen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter einer flackernden Straßenlaterne. Als sie die Autotür öffnen wollte, stürzte aus dem Schatten der Bäume ein Mann auf sie zu.
»Eichhörnchen!«
Sabine nahm die Hand von der Dienstwaffe. »Vater?« Was machte er in München?
Ihr Vater sah schrecklich aus. Der Schatten eines Dreitagebarts verdunkelte sein Gesicht. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen.
»Ich bin zu deiner Wohnung gefahren, aber du warst nicht da. Auf dem Revier haben sie gesagt, dass dein Dienst bald beginnt – ich dachte mir, dass du bei Monika bist.«
Sabine blickte auf die Uhr. Es war kurz nach acht. Sie musste auf ihre Dienststelle. »Warum bist du nicht in mein Büro gekommen?«
Tränen liefen ihm über die Wangen.
»Vater, um Himmels willen, was ist passiert?«
Er schloss sie in die Arme und drückte sie an sich. »Es tut mir leid, Eichhörnchen!«
Seit ihrem dritten Lebensjahr nannte er sie wegen ihrer vollen braunen Haare und großen braunen Augen »Eichhörnchen«. Als Teenager war ihr das peinlich gewesen, heute, als einer erwachsenen Frau, noch viel mehr.
»Die Silbersträhne steht dir gut«, krächzte er, dann liefen ihm wieder Tränen übers Gesicht.
»Danke.« Sie strich ihm über die Schulter. »Beruhige dich, was kann so schlimm sein, dass du …?«
»Deine Mutter wurde vor zwei Tagen entführt.«
»Was?« Sie befreite sich aus seiner Umarmung. »Woher weißt du das?«
Er wischte sich über die Bartstoppeln. Seine Hände zitterten. Er hatte nichts mehr mit dem rüstigen Sechzigjährigen zu tun, der in seiner Freizeit immer noch an alten Zügen herumschraubte, sondern wirkte um Jahre gealtert.
Entführt? Wer zum Teufel sollte Mutter entführen?
Die Situation kam ihr bizarr vor. Vor zwei Tagen hatte sie mit ihrer Mutter zum Pilateskurs gehen wollen und ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und plötzlich stand ihr Vater, der fünfhundert Kilometer entfernt in Köln wohnte, vor ihr.
Sabine zog das Diensthandy aus der Tasche und wählte die Nummer ihrer Mutter. Die Mobilbox sprang an. Sie wählte die nächste Nummer. Auf dem Festnetzanschluss aktivierte sich nach dem achten Klingelton der Anrufbeantworter.
»Seit wann weißt du, dass Mutter entführt worden ist?«
»Er hat mich vor achtundvierzig Stunden angerufen.«
Er? Ungläubig sah sie ihren Vater an. »Du hattest Kontakt zu dem Entführer?« Sie steckte das Handy weg. »Hast du die Kölner Kripo informiert?«
»Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.«
»Bist du wahnsinnig?«, entfuhr es Sabine. Sie durfte jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Von ihrem Job beim Kriminaldauerdienst wusste sie, dass Zeugen die einfachsten Fakten durcheinanderbrachten, sobald eine Flut von Fragen auf sie einprasselte. Trotzdem musste sie sich zusammenreißen, um nicht wild draufloszufragen.
»Du steigst jetzt in den Wagen und erzählst mir alles der Reihe nach. Wir fahren auf meine Dienststelle.«
»Nein! Er hat gesagt, er tötet sie, falls ich die Polizei einschalte.«
Töten? Sabine sah sich auf der Straße um. Einige Autos fuhren an ihnen vorbei, nur wenige Passanten gingen auf dem Bürgersteig. Sie senkte die Stimme. »Glaubst du, dass er uns beobachtet?«
»Ich weiß nicht … wahrscheinlich nicht mehr.«
Nicht mehr!
»Vater, bitte! Steig jetzt in den Wagen. Auf der Fahrt zum Revier erzählst du mir alles.«
Widerwillig stieg er ein. Als sie losfuhr, schaltete sich automatisch der CD-Player ein. Eine sonore Erzählstimme drang aus den Boxen. Ein Hörbuch von David Safier, Jesus liebt mich. Sabine knipste das Gerät aus.
Sie befanden sich schon auf der Rosenheimer Straße Richtung Isar, als sie kurz zu ihrem Vater rüberblickte. »Schnall dich bitte an.«
Mit zittrigen Fingern zog er den Gurt aus der Rolle. »Der Mann hat mich vor zwei Tagen zu Hause angerufen. Er hat seine Stimme irgendwie elektronisch verstellt und gesagt: Herr Nemez, wenn Sie innerhalb von achtundvierzig Stunden herausfinden, warum Ihre Exfrau entführt wurde, bleibt sie am Leben. Wenn nicht, stirbt sie.«
»Das waren seine Worte?« Es musste sich um ein Missverständnis handeln.
Vater nickte. »Als einzigen Hinweis habe ich eine Schachtel vor meiner Wohnungstür gefunden. Darin lag ein kleines, schwarzes Tintenfässchen.«
»Du hast es doch nicht angefasst?«
»Natürlich schon. Ich habe es geöffnet. Es ist schwarze Tinte drin.«
»Du hättest nichts berühren dürfen und mich sofort anrufen müssen. Wir hätten eine umfangreiche Suche eingeleitet.«
Hätte, hätte, hätte …
»Er hat gesagt, er tötet sie!«
»Vielleicht stimmt das gar nicht, und jemand …«
»Sabine!«, unterbrach er sie. »Ich habe ihre Stimme am Telefon gehört. Sie hat um Hilfe gefleht. Dann hat er sie weggezerrt.«
Sabine schnürte es die Kehle zusammen. Das sah nicht gut aus. Mutter hätte Vater nie um Hilfe gebeten. »Versuch, dich zu erinnern. Wann genau laufen die achtundvierzig Stunden ab?«
»Sie sind schon abgelaufen«, antwortete er leise.
Sabine sah, dass er die Digitaluhr im Armaturenbrett suchte. »Er hat mich vor knapp fünfzig Minuten wieder angerufen und mir noch mal dieselbe Frage gestellt. Dann sagte er, die Frist wäre abgelaufen, und hat aufgelegt.«
Sabine fuhr auf der Ludwigsbrücke über die Isar. Der Sonntagabendverkehr war nicht so zäh wie sonst, trotzdem nervten sie die langsam dahinzuckelnden Autos. Sie griff zum Walkie-Talkie und funkte ihr Revier an. Kolonowicz, der Nachtschichtleiter vom Kriminaldauerdienst, meldete sich mit sonorer Stimme.
»Hallo Walter, Sabine Nemez hier«, unterbrach sie ihn. »Vor knapp neunundvierzig Stunden wurde eine Frau entführt. Hanna Nemez, sechsundfünfzig Jahre alt, wohnte bis vor zehn Jahren in Köln, seither wohnhaft in der Winzererstraße, Schwabing-West, ehemalige Grundschuldirektorin, jetzt im Ruhestand. Wir müssen sofort nach ihr fahnden.«
Der Mann am anderen Ende sagte einen Moment lang nichts. Offensichtlich notierte er die Daten. Dann räusperte er sich. »Bine, sprichst du von deiner Mutter?«
»Ja. Ich bin auf dem Weg ins Dezernat.«
Er räusperte sich wieder, als überlegte er. »Ich will dich nicht beunruhigen, aber vor einigen Minuten kam eine Meldung herein. Der Priester des Doms und sein Mesner haben die Leiche einer älteren Frau im Hauptschiff gefunden.«
»Oh nein!« Ihr Vater presste die Hände auf den Mund. Wieder liefen ihm Tränen übers Gesicht.
2
Jung blieb man dann, wenn man an der Zukunft zumindest genauso viel Freude hatte wie an der Vergangenheit – dieser Spruch traf auf Sabines Vater mehr zu als auf jeden anderen Menschen, den sie kannte. Doch nun sah sie in seinen verquollenen Augen die Schmerzen der letzten Tage. Ihre Eltern hatten sich nach einem hitzigen Geld- und Sorgerechtsstreit scheiden lassen. Seither hatte Sabine gedacht, ihr Vater wäre über die Trennung hinweggekommen, hätte seine Exfrau vergessen können – doch in diesen Minuten merkte sie, dass er sie maßlos vermisste.
Sabine parkte in zweiter Reihe am Beginn der Fußgängerzone und legte die grüne Plastikhülle mit dem Ausweis des Kriminaldauerdienstes auf die Armaturenablage.
»Warte hier«, sagte sie und stieg aus.
»Darfst du da überhaupt rein, Eichhörnchen?«, rief er ihr nach.
»Papa, ich bin Kommissarin.« Mit sechsundzwanzig Jahren war sie die jüngste Kommissarin vom Münchner Kriminaldauerdienst. Als Bindeglied zur Kripo wurden sie oft »die Feuerwehr der Polizei« genannt. Noch bevor ein Kripobeamter zum Tatort kam, hatten sie bereits sämtliche Spuren gesichert, die Todesursache festgestellt und die Zeugen befragt.
Sie lief über den Platz zum Hauptportal der Frauenkirche. Die von Scheinwerfern beleuchtete Vorderfront aus Backsteinen strahlte in einem düsteren Orangeton. Die beiden massiven Türme waren so mächtig, dass Sabine auf dem Platz vor dem Hauptportal nicht einmal die Zeiger der beiden Uhren sehen konnte. Weiter oben leuchteten die zwei Hauben in einem merkwürdigen blaugrünen Farbton in der Dämmerung.
Nur eine Handvoll Jugendliche stand auf dem Platz. Ein paar Straßenmusikanten spielten unter einer Laterne. Sie umringten einen großen Werbeständer, der eine Papstmesse in der Kathedralkirche eine Woche vor Pfingsten ankündigte. Der »Sabst«, wie Connie ihn bezeichnet hatte, kam also tatsächlich nach Bayern. Sabine dachte an die Geschichte des Security-Auftrags, von dem sie ihren Nichten das nächste Mal erzählen wollte.
Sabine lief am Wagen der Kripo vorbei, der mitten auf dem Platz stand, und schob die schwere Pforte mit dem Ellenbogen auf, um keine Spuren zu verwischen. Ihre Kollegen hatten sie nicht mit dem Dietrich öffnen müssen. Das Schloss war mit einem großen Stemmeisen aufgebrochen worden. Späne lagen auf dem Boden. Die etwa drei Zentimeter breiten Abdrücke im Holzrahmen waren nicht zu übersehen. Hoffentlich ist die tote Frau nicht Mutter … Der Gedanke war so irreal. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tote und die Entführung ihrer Mutter in einem Zusammenhang standen, war extrem gering. Es durfte einfach nicht sein. Aber gerade deswegen, weil es nicht sein sollte, spürte sie diese dumpfe Gewissheit im Magen.
Das Hauptschiff war menschenleer und lag im Dunkel. Die Kronleuchter schwebten wie finstere Kugeln über den Bänken. Lediglich ein paar Kerzen brannten. Das Dämmerlicht von den Straßen fiel durch die schmal geschlitzten bunten Fenster. Es roch nach Weihrauch, Wachs und dem Holz der alten Bänke. Zu ihrer Schande musste Sabine sich eingestehen, dass sie die Kirche das letzte Mal vor drei Jahren betreten hatte, aber selbst da nur, um Spuren von Vandalismus und Sachbeschädigung zu sichern.
Durch die zahlreichen weißen Pfeiler wirkte das Innere des Doms wie ein zu hoch geratenes Labyrinth. Sabine lief den breiten Mittelgang entlang zum Altar. Ihre Schritte hallten über den Marmorboden. Wie sollte sie in den zahlreichen Kapellen, dem Chorraum, der Sakristei und der Krypta ihre Kollegen finden? Da flackerte ein Blitzlicht hinter ihr auf, und sie fuhr herum. Über dem Rundbogen des Hauptportals lag die Westempore wie ein breiter Balkon. Darauf befanden sich die hoch aufragenden Silberpfeifen der Hauptorgel. Ein weiteres Blitzlicht flammte auf. Ihre Kollegen standen um die Orgel herum. Sabine suchte nach der Treppe, die zur Empore führte.
Simon und Wallner hatten Dienst. Etwas abseits warteten ein Priester in einer schwarzen Soutane und ein alter, glatzköpfiger Mann mit Strickweste und grauer Bundfaltenhose. Aufgeregt rang der Greis, der wohl der Mesner sein musste, die gichtkranken Hände. Obwohl sich sonst niemand hier oben befand, war der Bereich abgesperrt. Zwei Scheinwerfer erhellten das Podium. In einer Wölbung unter den Orgelpfeifen standen die Stühle für den Chor auf den Stufen. Dort hatte Wallner den Inhalt seines Koffers ausgebreitet. Schon damals, als Sabine beim Dauerdienst begonnen hatte, war er ein Urgestein der Münchner Kripo gewesen. Auf einem Sessel lag seine Checkliste. An der Anzahl der Häkchen erkannte Sabine, dass er gerade erst mit der Arbeit begonnen hatte. Wie immer hatte er seine grauen Haare quer über den Kopf gekämmt, um die Halbglatze zu verdecken. Es war vergebliche Liebesmüh. In ein paar Jahren würden sie so dünn wie Seidenpapier sein, und dann sähe es lächerlich aus. Allerdings war er ein pfundiger Kerl und netter Kollege.
»Hallo, Bine.« Wallner blickte kurz hoch und strich mit dem Pinsel weißes Pulver auf die Sessellehnen. Aussichtslos. Er würde Dutzende verschiedene Fingerabdrücke und doppelt so viele Fragmente finden.
Simon, der Jüngere der beiden, sah ebenfalls kurz auf. »Hat Kolonowicz dich hergeschickt?«
Sie gab keine Antwort. Simon war Mitte dreißig, etwa zehn Jahre beim Dauerdienst und Wallners Partner, so lange sie zurückdenken konnte. Er sah als Einziger von ihren Kollegen wirklich gut aus. Früher waren sie öfter nach Dienstschluss in das Irish Pub am Beethovenplatz gegangen und zweimal danach zu ihr in die Wohnung. Sie wusste, es war nicht die große Liebe, trotzdem hatte sie sich anbaggern lassen. Doch dann hatte er plötzlich eine andere geheiratet. Natürlich hatte sie mit ihm Schluss gemacht. Sie hatte nicht gewusst, was in seinem Kopf vorgegangen war, und auch nie gefragt.
Simon beugte sich über eine Leiche, die unter dem Spieltisch der Orgel lag. Nur die Beine ragten hervor. Die Frau trug einen cremefarbenen Rock, aber weder Schuhe noch Strümpfe. Ihre nackten Füße waren an die metallenen Beine des Spieltisches gekettet.
»Wer ist die Tote?«, fragte Sabine.
Simon schaltete das Diktiergerät aus. »Sie hat keinen Ausweis bei sich. Bisher wissen wir nur, dass sie nicht in der Kirche gearbeitet hat.«
»Soll ich in Überzieher schlüpfen?«
»Nicht nötig.« Simon blickte kurz hoch. »Aber wenn du näher kommst, pass auf, dass du nicht in die Tinte trittst.«
Tinte! Erst jetzt sah sie die schwarzen Spritzer auf dem Boden. Sie dachte an das Tintenfass, das ihr Vater erwähnt hatte. Ihre Brust zog sich zusammen, und plötzlich hatte sie das Gefühl, ihr Herz würde zerspringen.
»Was ist passiert?«, krächzte sie.
»Ich habe gerade die Bänke im Seitentrakt gereinigt«, brummte der Hausmeister hinter ihr. »Plötzlich hörte ich Orgelspiel. Ich holte den Pfarrer, und als wir nach oben liefen, verstummte das Spiel. Niemand war da. Nur die tote Frau.«
Sabine kam näher. Das Manual der monströsen Orgel ähnelte einem Cockpit. Tastaturen auf vier übereinander liegenden Ebenen sowie zwei halbrunde Seitenteile mit zahlreichen Knöpfen und Schaltern. Die Sitzbank war zur Seite geschoben. Die Leiche lag auf dem Rücken. Auch die Hände waren an die Tischbeine gekettet. Die Tote trug eine moderne violette Bluse. Sabine kannte das Kleidungsstück. Sie kniete nieder, um einen Blick auf das Gesicht der Frau zu werfen.
»Ein Blick reicht, um zu sehen, dass das kein gewöhnlicher Mord ist.« Wallner machte eine Pause. »Viel eher eine Hinrichtung, die …«
Mehr hörte Sabine nicht. Sie starrte in die vor Schreck geweiteten Augen ihrer Mutter. Das Gesicht war gespenstisch bleich. Aus dem Mund ragte ein daumendicker Schlauch, an dessen Ende ein Trichter hing. Daneben stand ein schwarzer Kanister. Ihre Mutter lag leblos auf dem kalten Boden. Dieselbe dumpfe Kälte senkte sich um Sabine. Das durfte nicht sein! Wie war es möglich, dass ihre Mutter hier lag? Seltsamerweise ging ihr nur ein einziger Gedanke durch den Kopf: Kerstin, Connie und Fiona! Wie sollte sie ihnen beibringen, dass ihre Großmutter hier lag und Simon Fotos von ihrem Gesicht schoss?
Sabine konnte den Blick nicht vom Antlitz ihrer Mutter nehmen. Ihr wurde schwindelig. Die Kälte des Doms und der Geruch von Wachs und Weihrauch drehten sich in immer schnelleren Kreisen um sie. Sie stützte sich mit der Hand auf dem Boden ab. Sie wollte, dass ihre Mutter sich bewegte, die Augenlider schloss, wiederöffnete und sich aufsetzte. Steh auf! Unwillkürlich hielt Sabine den Atem an. Sie konnte nicht Luft holen. Sie würgte, schmeckte Magensäure im Mund und salzige Tränen auf den Lippen.
Der Priester stand überraschend neben ihr und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Was ist mit Ihnen? Kennen Sie diese Frau?«
Wallner und Simon kamen näher.
»Bine!«
3
Sabine saß nachts in ihrem Büro bei einer Tasse heißen Kaffee. Nichts hätte sie darauf vorbereiten können, ihre Mutter einmal so vorfinden zu müssen – weder die Zeit an der Polizeischule noch die Einsätze beim Kriminaldauerdienst. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – fragte sie sich, ob ihre Kollegen den Mörder je finden würden. Vielleicht wurde der Mord an ihrer Mutter nie aufgeklärt.
Im Moment beschäftigte sie sich mit Dingen, die vollkommen irrelevant waren, doch sie wollte sich ablenken, und so liefen ihre Gedanken wie ein Hamster im Rad. Apathisch dachte sie an die Testamentseröffnung und die Vorbereitung der Beerdigung. Sollte Mutter in Köln oder München bestattet werden? Sabine und ihre Schwester waren in Bayern auf Großmutters Bauernhof aufgewachsen und nur wegen Vaters Job als Restaurator alter Eisenbahnen nach Köln gezogen. Dort hatte Mutter zunächst als Lehrerin und später als Direktorin unterrichtet. Aber im Grunde ihres Herzens war sie immer Bayerin geblieben … bis zu ihrem Tod. Tränen stiegen Sabine in die Augen.
Monika würde zusammenbrechen, wenn sie von Mutters Tod erfuhr. Wie sollten sie Kerstin, Connie und Fiona beibringen, dass ihre Oma nicht mehr zu Besuch kommen würde? Es hatte keinen Sinn, die Sache länger rauszuzögern. Sie wählte Monikas Nummer. An deren Stimme erkannte sie, dass sie noch nicht geschlafen hatte. Sabine erzählte ihrer Schwester, was sich ereignet hatte.
»Ermordet?«, rief Monika beinahe hysterisch.
»Ja. Soll ich vorbeikommen?«
»Nein …« Monika brach in Tränen aus. »Du hast sicher jede Menge zu tun.«
»Vor allem muss ich nach Vater sehen.«
»Er ist hier?«
Sabine erzählte den Rest der Geschichte und hasste sich dafür, die Überbringerin der Hiobsbotschaft zu sein. »Versuch zu schlafen«, sagte sie schließlich und legte auf.
Lange Zeit starrte sie auf den Telefonhörer. Ihr Vater saß am Ende des Korridors im Warteraum. Wallner hatte sie nach ihrem Zusammenbruch mit dem Dienstfahrzeug aufs Revier gebracht und ihr ein Beruhigungsmittel angeboten, das sie aber nicht genommen hatte. Währenddessen hatte ein Streifenbeamter ihren Vater ins Präsidium gebracht. Sabine wusste, dass ihn die Nachricht vom Tod seiner Exfrau genauso hart getroffen hatte wie sie. Aber im Moment war ihr das egal. Sie konnte immer noch nicht fassen, dass er achtundvierzig Stunden lang nichts von der Entführung gesagt hatte. Du hättest mich anrufen müssen! Sie ließ ihn absichtlich allein im Warteraum schmoren, da sie nicht wusste, wie sie reagieren würde, wenn sie ihn sah. Jedenfalls hätte sie gute Lust, auf ihn einzuschlagen … achtundvierzig Stunden lang.
Sie stand auf und blickte zur Wanduhr. 23.05 Uhr. Die Nachricht vom Mord im Dom würde frühestens am Morgen im Radio zu hören und erst in der Abendausgabe der Zeitung zu lesen sein.
Im Warteraum roch es nach frischem Kaffee, doch ihr Vater hatte die Tasse nicht angerührt. Im Mülleimer lagen einige Taschentücher. Er saß mit rot geäderten Augen auf der Holzbank und starrte an die Wand. Seine Finger trommelten auf der Armlehne. Als er Sabine bemerkte, sprang er auf.
»Stimmt es, was mir deine Kollegen erzählt haben?«
Sabine nickte.
»Oh Gott, Eichhörnchen!« Weinend drückte er Sabine an sich, und im nächsten Moment waren ihre Wut und ihr Hass auf ihn verflogen. »Es tut mir so leid«, schluchzte er. »Deine Kollegen wollen mich verhören.«
Sie ließ ihn los. »Papa, das ist kein Verhör … nur eine Befragung.«
»Was soll ich denen erzählen?«
War das zu glauben? Was für eine dämliche Frage! So hilflos kannte sie ihren Vater gar nicht. »Die Wahrheit natürlich«, sagte sie.
»Die Wahrheit? Ich weiß doch, wie das abläuft«, fauchte er. »Sobald ich erwähne, dass ich seit zwei Tagen von der Entführung deiner Mutter weiß, nageln die mich wegen Beihilfe zum Mord fest, weil ich nichts unternommen habe. Es ist kein Geheimnis, dass wir zwei Jahre lang einen Rosenkrieg geführt haben und seither im Streit leben. Aus der Sache komme ich nicht raus.«
»Vater!« Leise Panik kroch in ihr hoch. »Du musst die Wahrheit sagen. Verschweige nichts, die kommen sowieso dahinter.« Sie stutzte. »Du hast doch ein Alibi für diesen Abend, oder?«
Er hob die Schultern. »Ich bin heute Morgen nach München gefahren, in der Hoffnung, dass der Kerl noch mal anruft. Aber er hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet, erst abends, und die Wohnung deiner Mutter war aufgebrochen.«
Sabine packte ihren Vater am Arm. »Du warst dort? Du hast doch nichts angefasst!«
»Ich … ich weiß nicht.« Er wischte mit der Hand durch die Luft. In diesem Moment wurde die Tür geöffnet. Wallner kam herein. »Herr Nemez?«
Sabines Vater atmete tief durch und richtete sich stramm auf, als versuchte er, Haltung zu bewahren.
»Wir müssen Ihnen die Fingerabdrücke abnehmen – nur eine Standardprozedur«, erklärte Wallner. »Und dann haben wir noch ein paar Fragen.«
Sabine merkte, wie ihr Vater versteinerte und sein Blick kalt wurde.
Während ihr Vater befragt wurde, suchte Sabine das Büro ihres Vorgesetzten auf. Kolonowicz war Ende vierzig und ein Hüne mit breiten Schultern, senffarbenem Haar und Schnauzbart. Aufgrund seiner Fältchen und Augenringe sah er älter aus, als er war. An manchen Tagen – so auch heute – erinnerte er sie mit seiner Statur und der sonoren Stimme an den Göttervater Zeus. Durch die Lesebrille betrachtete er einen Stapel Fotos. Seine Zigarre qualmte im Aschenbecher. Simon saß neben ihm am Schreibtisch. Sie besprachen den Fall.
Als Sabine sich räusperte, erhob sich Kolonowicz und ging auf sie zu. Mit seinen Pranken umfasste er ihre Hände. »Bine, tut mir leid. Wenn du möchtest, bringt dich einer der Kollegen nach Hause. Ich gebe dir zwei Tage Sonderurlaub.«
»Danke, aber ich muss mich jetzt beschäftigen, sonst drehe ich durch.«
Kolonowicz nickte. »Okay, aber es ist eine ruhige Nacht. Simon sieht sich als Nächstes die Wohnung deiner Mutter an.« Er warf seinem Kollegen einen kurzen Blick zu. »Bine, woher wusstest du eigentlich, dass deine Mutter entführt wurde?«
Das war die entscheidende Frage, die im Moment wohl jeden beschäftigte. Sie hoffte inständig, dass ihr Vater bei seiner Aussage nichts verheimlichte oder zu beschönigen versuchte. »Mein Vater hat mich darüber informiert.«
Offensichtlich wollte Kolonowicz sie nicht länger quälen. »Okay«, murmelte er. »Bald wissen wir mehr.«
»Ich begleite Simon zur Wohnung«, sagte sie rasch.
»Nein, das erledigt er allein.«
»Es würde mich ablenken«, widersprach sie.
»Bine, ich sagte nein – und jetzt raus!«
Mit verschränkten Armen wartete Sabine vor Simons Wagen. Kurz vor ein Uhr morgens lag die Temperatur bei fünf Grad über null.
Simon stellte die Koffer neben das Auto und fuhr sich durch das kurze blonde Haar. »War ja klar, dass du hier aufkreuzt.«
»Das Haus ist nie abgesperrt, aber Mutters Wohnungstür hat ein Sicherheitsschloss.« Von ihrem Vater wusste Sabine, dass die Tür aufgebrochen worden war. Trotzdem klimperte sie mit dem Schlüsselbund. »Du müsstest den Hausverwalter rausläuten, aber um die Uhrzeit schaffst du das nie.«
Er nickte. »Von mir aus, steig ein, aber kein Wort zum Chef.« Er konnte sich darauf verlassen, dass sie nichts verraten würde.
Zwanzig Minuten später kamen sie in der Winzererstraße in Schwabing-West an. Simon parkte vor dem vierstöckigen Wohnhaus aus gelbem Backstein mit kunstvollen Stuckarbeiten. Mondlicht fiel durch die Laubbäume, der schmiedeeiserne Zaun warf kurze Schatten auf den Bürgersteig. Sabines Brust wurde eng, als Simon und sie, jeweils mit einem schweren Koffer bepackt, das Eisengatter aufschoben und zum Haustor gingen. Alles war wie bei einem üblichen Tatorteinsatz – trotzdem kam es ihr so vor, als besuchte sie ihre Mutter. Der Weg war so vertraut. Die Mülleimer in der Nische, das rostige Fahrrad unter dem Dachvorsprung, die Namensschilder an der Gegensprechanlage. Sabine drückte gegen die Tür, die sich mit einem Schnappen öffnete.
Simon folgte ihr durch das Treppenhaus ins Dachgeschoss. Der abgestandene Geruch von Frittieröl hing in der Luft. Aus einer Wohnung drangen die gedämpften Geräusche eines Fernsehgeräts. Morgen früh würde Simon die Hausbewohner befragen müssen, von denen Sabine die meisten persönlich kannte.
Mutters Wohnung lag als einzige im obersten Stockwerk. Der Rest des Dachstuhls war unverbaut. Im Sommer hingen hier oft Kleider an Wäscheleinen. Aufgrund der zahlreichen Dachschrägen waren die meisten Schränke, Kommoden und Regalsysteme in Mutters Wohnung maßgefertigt – bezahlt von Vaters Unterhalt nach der Scheidung. Denk nicht an deine Eltern! Für diese Nacht ist es ein Tatort wie jeder andere.
»Alles okay?«, fragte Simon.
»Ja.« Sabine hatte noch gar nicht richtig realisiert, dass ihre Mutter nicht mehr lebte. Bestimmt würden diese Gefühle später in geballter Form kommen. Im Moment jedenfalls wollte sie sich wie in Trance in die Ermittlung stürzen.
»Was hast du bei der Orgel sicherstellen können?«, fragte sie.
Simon keuchte neben ihr die Treppe hinauf. »Keine Fingerabdrücke an Eimer, Schlauch, Trichter oder Ketten. Ich bin sicher, der Mörder hat auch an der Orgel und der aufgebrochenen Pforte keine hinterlassen.«
»Möglicherweise an der Leiche.«
»Bine, du weißt, was ein Verdampfungsverfahren kostet, und dass wir bisher so gut wie nie Abdrücke auf der Haut gefunden haben.«
»Aber wir könnten es versuchen.«
»Sprich mit dem Gerichtsmediziner«, schlug Simon vor. »Die Leiche ist auf dem Weg in die Pathologie. Doktor Hirnschall hat Nachtdienst.«
Oh Gott! Dieser alte Knauser würde nie ein Verdampfungsverfahren machen, nicht einmal wenn seine eigene Mutter auf dem Autopsietisch läge. Er hinkte mit der Arbeit immer tagelang hinterher. Die Kollegen von der Mordgruppe warteten seit einer Woche auf den Obduktionsbefund von drei tschechischen Gastarbeitern, die auf der Autobahn in einem Kastenwagen verbrannt waren. Sabine hatte nur eine Chance: Sie musste mit dem Staatsanwalt sprechen. Doch die vorläufigen Unterlagen des Falls würden frühestens heute Morgen an die Staatsanwaltschaft gehen. Wer immer dafür zuständig war – sie würde sich wie eine Klette an dessen Fersen heften.
Sie blickte zu Simon. »Weißt du, welches Stück auf der Orgel gespielt wurde? Klang es professionell oder dilettantisch?«
Simon warf ihr einen scharfen Blick zu. »Willst du die Zeugen noch mal befragen? Bine, wir werden schon auf etwas stoßen, das uns weiterhilft.«
Auf den Anruf eines Entführers, dachte Sabine. Seine elektronisch verzerrte Stimme, die Rätselspiele und ein Tintenfässchen, das er meinem Vater als Geschenk hinterlassen hatte und das Vater angefasst hat. So ein Idiot!
Sie kamen zur Tür.
»Der Rahmen wurde aufgebrochen«, stellte Sabine fest.
Das Schloss war verbogen. Der Abdruck des Brecheisens im Holz war etwa so breit wie der an der Dompforte. An der Klinke hing eine Plastiktüte mit Broschüren. Der Einbrecher musste sich die Mühe gemacht haben, die Tür wieder so ins Schloss zu drücken, dass sie nicht von allein aufging, denn dem Werbeausträger schien nichts aufgefallen zu sein. Ihr Vater hatte sie nach seinem Besuch offenbar genauso verschlossen.
»Wieso habe ich bloß den Eindruck, dass du das schon wusstest?« , fragte Simon. Er lehnte den Zollstock neben die Tür, fotografierte die Einbruchspuren und nahm die Fingerabdrücke von der Klinke. Danach schlüpften sie mit den Schuhen in Überzieher, zogen Latexhandschuhe an und betraten die Wohnung. Es roch nach Tee. Der Heizkörper im Vorzimmer gluckste. Sabine schaltete das Licht an. Sie hatte mit umgeworfenen Vasen, verschobenen Möbelstücken, geöffneten Schränken oder auf dem Boden verstreuten Kleidern gerechnet. Doch nichts dergleichen war zu sehen. Der Raum wirkte wie immer. Mutters Schuhe standen auf der Ablage, ihre neuen Blazer hingen an den Kleiderhaken. Nur ihre Handtasche fehlte, die für gewöhnlich neben dem Spiegel stand. Keine Kampfspuren! Bloß schwarze Schlieren an der weißen Wand, wie mit einem Kohlenstift gezogen.
»Falls deine Mutter hier entführt wurde«, sinnierte Simon, »hat der Mörder bereits in der Wohnung auf sie gewartet.«
Sabine sah das auch so. Andernfalls hätte das Knacken des Türstocks ihre Mutter alarmiert. Aber warum hatte sie die aufgebrochene Tür nicht bemerkt? Sabine ging ins Wohnzimmer. Auch hier sah alles so aus wie immer. Auf dem Anrufbeantworter des Festnetzanschlusses war nur eine Nachricht. Sabine spielte sie ab und hörte ihre eigene Stimme, die den Pilateskurs am Freitag absagte. Plötzlich regte sich ihr schlechtes Gewissen wieder. Diese verdammte Magier-Doppelfolge! Wäre sie stattdessen zu ihrer Mutter gefahren, hätte sie die Entführung vielleicht verhindern können. Wenigstens wäre sie früher auf die Einbruchspuren gestoßen, und die Kripo hätte mit den Ermittlungen beginnen können. Bestimmt hätte sie ihren Vater angerufen und von dem mysteriösen Anrufer und dem Tintenfässchen erfahren. Wenn, wenn, wenn … verdammte Kuhscheiße!
Simons Stimme riss sie aus den Gedanken. »Du machst Pilates? Wusste ich gar nicht.«
Und du warst verlobt? Wusste ich auch nicht!
Irgendwie hatte sie kein Glück mit den Männern. Ihre Jugendliebe Erik arbeitete in Wiesbaden, und Simon hatte nie ernsthaft etwas von ihr gewollt.
»Ja, seit drei Monaten.« Sie drückte auf die Wahlwiederholungstaste. Das Display zeigte ihre Handynummer. Im selben Moment vibrierte ihr Mobiltelefon in der Jackentasche. Sie legte auf. Es wäre ja auch zu dilettantisch gewesen, wenn der Entführer von diesem Apparat aus telefoniert hätte.
Sie hörte, wie Simon in der Küche mit den Schränken und Schubladen hantierte. Bei dem Gedanken, dass er die Intimsphäre ihrer Mutter durchwühlte, zog sich ihr Magen zusammen. Aber das war nun mal sein Job – und Simon wusste, was er tat. Zumindest beruflich.
»Wenn er hier auf deine Mutter gewartet hat, musste er möglicherweise Zeit totschlagen«, sagte Simon aus der Küche.
Sabine untersuchte Fernsehgerät und Sat-Receiver und nahm Fingerabdrücke von der Fernbedienung. Zuletzt war ARTE gelaufen, Mutters Lieblingssender. Sie hatte gern Filmklassiker und Werkschauen französischer und italienischer Regisseure angeschaut. Während ihrer Zeit als Grundschuldirektorin hatte sie ihre kleinen Schützlinge bereits mit Texten von Marie von Ebner-Eschenbach und Sagen der griechischen Antike gequält. Völlig überzogen. Aber so war sie nun einmal gewesen. Bei Monika und ihr hatte Mutter es ebenfalls versucht – mit dem Resultat, dass weder Sabine noch ihre Schwester Bücher lasen. Sabine hörte während der Autofahrt wenigstens Hörbücher von David Safier und Tommy Jaud. Nicht gerade die hohe Weltliteratur, aber das munterte sie auf. Nervenkitzel und Spannung hatte sie während des Jobs genug. Zum Ausgleich brauchte sie etwas Humorvolles, wollte sie nicht so desillusioniert enden wie ihre Kollegen Simon, Wallner und Kolonowicz.
Sie hatte ohnehin nicht vor, ewig bei diesem Haufen von Zynikern zu bleiben, da sie eines Tages zum Bundeskriminalamt in Wiesbaden wechseln wollte. Ihre Chancen standen nicht schlecht, immerhin lag der Frauenanteil beim BKA bei einem Drittel. Allerdings hatte sie schon drei Bewerbungen für eine Ausbildung zum Profiler verfasst, die allesamt kommentarlos abgelehnt worden waren.
»Ich glaube nicht, dass der Kerl ferngesehen hat«, rief Sabine in die Küche. Ein Blick auf die Couch bestätigte ihr, dass die Kissen in der Art und Weise aufgeschüttelt waren, wie ihre pedantische Mutter es immer getan hatte. Neben dem Fernsehgerät lagen einige Hörbücher, die Sabine ihrer Mutter vor einigen Wochen geborgt hatte, damit sie mal etwas anderes hörte als Sagen der griechischen Antike. Wie in Trance starrte sie auf die CD-Hüllen. Hera Lind und Ephraim Kishon. Ein merkwürdiges Gefühl erfasste sie bei dem Gedanken, dass ihre Mutter keine dieser CDs jemals hören würde.
Im Schrank unter dem TV-Gerät bewahrte ihre Mutter Uhren, Ringe und Ketten in einer Schmuckschatulle auf. Sabine öffnete die Box. Auf den ersten Blick fehlte nichts. Weiter hinten im Schrank lag ein in Geschenkpapier gewickeltes Paket. Sabine zog es hervor. Ein schwerer Bildband? Blaues Papier, gelbe Schleife. Eine Karte hing daran. Sabine hielt sie ins Licht. Für meine Kleine – alles Gute, Mama. Der Anblick versetzte ihr einen Stich. Ihre Mutter war eine vorausschauende Frau gewesen. Die Karte war mehr als zwei Wochen vordatiert, auf Donnerstag, den 9. Juni – Sabines Geburtstag. Vor der Geburtstagsfeier würde es nun ein Begräbnis geben.
»Trank deine Mutter ihren Kaffee schwarz?«
Sabine schob das Geschenk nach hinten und schloss den Schrank. Trank, Vergangenheitsform. Sie spürte Tränen in den Augenwinkeln und blickte zur Zimmerdecke. »Nur Tee, meistens Twinings … warum?«
»Hier steht eine halb volle Tasse schwarzer Kaffee.«
Sabine ging in die Küche. Das rote Lämpchen der Kaffeemaschine, die Mutter nur dann benötigte, wenn Monika und sie zu Besuch kamen, leuchtete. Auf der Arbeitsfläche stand eine Tasse mit Löffel, daneben die Zuckerdose.
»Er hat Kaffee gekocht und wurde beim Trinken von deiner Mutter überrascht«, folgerte Simon. Er schüttete den Kaffee weg und steckte die Tasse in eine Plastiktüte. »Möglicherweise hilft uns eine Untersuchung im DNS-Labor weiter.«
Sabine stellte sich vor, wie der Kerl auf ihre Mutter gewartet hatte. Obwohl sie den Gedanken verdrängen wollte, tauchten die Bilder vor ihrem geistigen Auge auf. Er musste ihre Schritte im Treppenhaus gehört haben und war zur Tür gelaufen. Bestimmt waren ihr die Einbruchspuren aufgefallen, aber der Mistkerl hatte sie entweder mit einer Waffe bedroht und in die Wohnung gezerrt oder sie mit einem Betäubungsmittel oder einem Schlag auf den Kopf außer Gefecht gesetzt.
»Bine, das solltest du dir ansehen.«
Auf dem Boden lag Mutters schwarze Handtasche. An den Plastikfüßchen der Tasche hafteten weiße Spuren von der Wand. Die Schlieren aus dem Vorraum! Offensichtlich war Mutter bei einem Kampf an die Wand gedrückt worden.
Der Tascheninhalt lag verstreut auf der Kommode. Simon stocherte mit seinem Leuchtkugelschreiber durch Zigarettenschachtel, Feuerzeug, Geldbeutel, Ausweisetui, Lidschatten, Lippenstift und ein zerlesenes Exemplar von Zweigs Schachnovelle, das zahlreiche Eselsohren aufwies.
»In der Brieftasche sind knapp zweihundert Euro«, erklärte er. »Unser Mörder hat Geld nicht nötig.«
Ebenso wenig wie Ohrringe oder Perlenketten. Unwillkürlich dachte Sabine an die Lebensversicherung ihrer Mutter und den ganzen bürokratischen Kram. Oh Gott, konzentriere dich! Simon schob eine Packung Kaugummis beiseite. Beim Anblick eines in Folie geschweißten Kondoms schoss Sabine die Hitze in den Kopf. Hatten sie das Recht, in die Intimsphäre ihrer Mutter einzudringen?
»Fehlt was?«, fragte Simon.
»Handy und Adressbuch«, erwiderte Sabine.
Damit hatte er ihren Vater kontaktiert.
4
Mit einem Ruck setzte sich Helen Berger im Bett aufrecht hin. Ihr Herz raste. Draußen glänzte ein silberner Streifen am Horizont. Wo stand der verdammte Wecker? Sie tastete über den Nachtschrank und stieß gegen ein loses Manuskript. Der Papierstapel rutschte auf den Teppichboden. Ein Sachbuch über dissoziative Persönlichkeitsstörung, das sie seit zwei Wochen abends Korrektur las, wenn Frank neben ihr schlief. Bestimmt war das Lesezeichen rausgefallen … Das Rascheln hatte Frank nicht geweckt. Typisch! Er schnarchte leise neben ihr. Endlich fand sie den Wecker und drückte auf die Leuchttaste. 04:58 Uhr. Zu früh für den Zeitungsjungen. Außerdem klang Dustys Bellen anders als sonst.
Helen hob die Beine aus dem Bett und lauschte. Dustys Knurren nahm einen bedrohlichen Ton an. Normalerweise lief er nachts nie durch die Hundeklappe nach draußen. Doch jetzt musste er am Rand des Grundstücks sitzen und irgendetwas auf der Straße oder dem Feld ankläffen. Zumindest hörte es sich durch das gekippte Fenster so an. Dabei war gar nicht Vollmond.
Helen schlüpfte in den kurzen Morgenrock und schlich aus dem Schlafzimmer. Wolken zogen übers Haus. Für einen Moment fiel Mondlicht durch das schräge Dachfenster und beleuchtete den Gang und die Treppe, die ins untere Stockwerk führte. Helen lief auf Zehenspitzen nach unten. Irgendwie kam ihr das absurd vor. Weshalb schlich sie durch ihr eigenes Haus? Frank schlief wie ein Murmeltier, und Dusty saß ohnehin draußen und kläffte sich die Seele aus dem Leib.