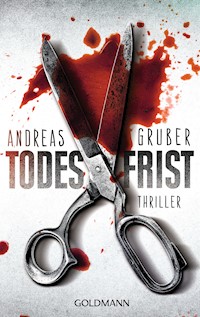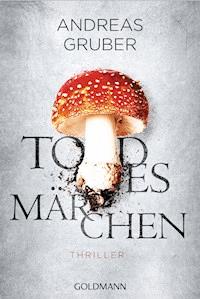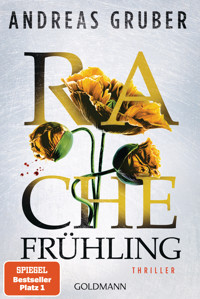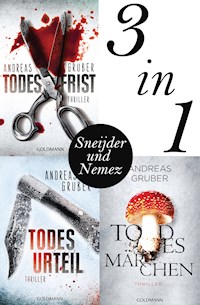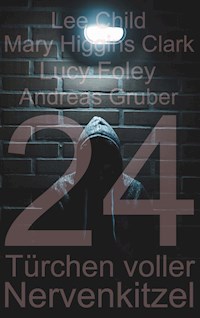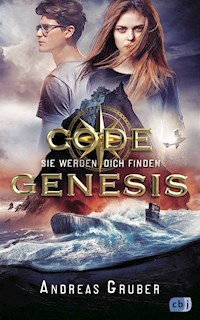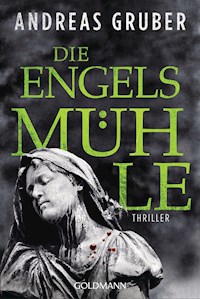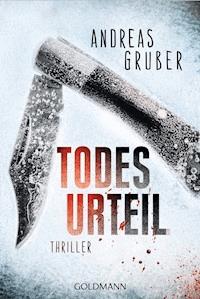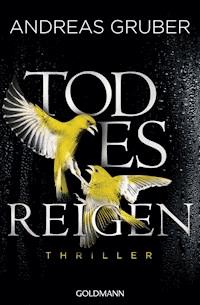
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez
- Sprache: Deutsch
Sneijder und Nemez ermitteln wieder.
Nachdem eine Reihe von Kollegen auf brutale Art Selbstmord begangen haben, wird Sabine Nemez – Kommissarin und Ausbilderin beim BKA – misstrauisch. Vieles weist auf eine jahrzehntealte Verschwörung und deren von Rache getriebenes Opfer hin. Sabine bittet ihren ehemaligen Kollegen, den vom Dienst suspendierten Profiler Maarten S. Sneijder, um Hilfe. Doch der verweigert die Zusammenarbeit, mit der dringenden Warnung, die Finger von dem Fall zu lassen. Dann verschwindet Sabine spurlos, und Sneijder greift selbst ein. Womit er nicht nur einem hasserfüllten Mörder in die Quere kommt, sondern auch seinen einstigen Freunden und Kollegen, die alles tun würden, um die Sünden ihrer Vergangenheit endgültig auzulöschen ...
Der vierte Fall für Sneijder und Nemez.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Buch
BKA-Ermittler und Profiler Maarten S. Sneijder ist bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert. Seine ehemalige Partnerin Sabine Nemez, die Sneijder selbst ausgebildet hat, arbeitet nun allein. Doch schon bald ist sie auf Sneijders Hilfe angewiesen, denn mehrere altgediente Kollegen begehen unter mysteriösen Umständen auf brutale Art Selbstmord – nachdem es kurz zuvor in ihren Familien zu ungewöhnlichen Todesfällen gekommen ist.
Sabine wird misstrauisch. Als sie zusammen mit ihrer Kollegin Tina Martinelli versucht, einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen herzustellen, führt die Spur in die Vergangenheit und weist auf eine jahrzehntealte Verschwörung hin. Beide wissen, ihre beste Chance, mehr herauszufinden, liegt in einem Gespräch mit Sneijder. Doch der verweigert die Zusammenarbeit – mit der dringenden Warnung, die Finger von dem Fall zu lassen.
Erst als weitere Menschenleben auf dem Spiel stehen, schlägt Sneijder seine eigene Warnung in den Wind und greift selbst ein. Womit er nicht nur seinen einstigen Freunden und Kollegen in die Quere kommt, sondern auch einem hasserfüllten Mörder, der sich auf einem blutigen Rachefeldzug befindet …
Weitere Informationen zu Andreas Gruber sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Andreas Gruber
Todesreigen
Thriller
für Daniel,
vielleicht liest du dieses Buch eines Tages,
wenn du alt genug bist
»Der einzig einfache Tag war gestern.«
– MAARTEN S. SNEIJDER–
PROLOG
Die Autobahn verlor sich jenseits der Scheinwerferkegel in der Dunkelheit und lag vor Benno Marx wie eine endlose Gerade.
Vier Uhr früh! Die Morgendämmerung setzte bereits zögerlich ein. In etwas mehr als einer Stunde würde die Sonne aufgehen. Diesmal ging die Reise nach Hamburg. Benno Marx würde die nächsten vier Stunden durchfahren, erst danach auf einem LKW-Rastplatz halten und die erste Pause einlegen. Genau dreißig Minuten. Danach ging es weiter, und bis dahin würde er nur ein oder zwei Becher Kaffee aus der Thermoskanne trinken und es sich verkneifen, aufs Klo zu gehen. So wie immer.
Er fuhr konstant achtzig. Der Motor röhrte, und die Fotos von seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern, die im Rahmen des Rückspiegels steckten, wackelten bei jeder Bodenwelle, über die der Truck donnerte. Er war voll beladen. Mit der Zugmaschine und dem Aufleger war er mit dreißig Tonnen unterwegs. Benno war bereits in aller Herrgottsfrühe beim Kühltank der Molkerei gewesen, denn je früher er in Hamburg ankam, umso besser. Den Tankwagen mit Milch abliefern, danach einen neuen Anhänger mit Lebensmitteln ankoppeln und zurück nach Frankfurt. Immerhin würde er dieses Wochenende seine Kinder sehen. Die beiden Mädchen hatten ihm verraten, dass sie später ebenfalls LKW-Fahrer werden wollten, weil sie so gern Joghurt und Müsli aßen. Diese Flausen würde er ihnen noch austreiben. Der Job war alles andere als erstrebenswert, aber er konnte eben nichts anderes.
Benno schaltete das Radio ein. Die Verkehrsnachrichten liefen. Aber es war immer das Gleiche – wenn der Sprecher mal einen Stau meldete, war meist keine Zeit mehr, um darauf zu reagieren. Da vertraute er besser auf CB-Funk.
Benno blickte hoch. Das Gerät hing in der Halterung, und das Kabel tanzte hin und her. Es schwieg. Ein gutes Zeichen. Sollte er über Funk nachfragen, ob ein anderer Fahrer auf der Strecke war? Um diese Zeit? Schon möglich.
»…kommen wir nun zu den Verkehrsmeldungen im Raum Frankfurt. Auf dem Abschnitt zwischen Frankfurt und Butzbach kommt Ihnen auf der A5 in Fahrtrichtung Norden ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht.«
Das war seine Strecke! Benno lief ein Schauder über den Rücken. In den sieben Jahren als LKW-Fahrer war ihm noch nie ein Geisterfahrer begegnet. Er stierte geradeaus, konnte aber nichts erkennen. Einige PKWs überholten ihn und rasten mit hoher Geschwindigkeit Richtung Norden.
»He, ihr Idioten!«, schimpfte er. »Hört ihr denn keine Nachrichten?«
Er betätigte die Lichthupe, doch die Fahrer blieben auf dem Gaspedal und preschten davon.
Benno sah in den Seitenspiegel. Langsam erwachte die Autobahn zum Leben. Immer mehr PKWs fuhren auf die Straße auf. Entweder Reiselustige, die noch keine schulpflichtigen Kinder hatten und in den Norden fuhren, oder Frühaufsteher auf dem Weg zur Arbeit.
»Scheiße!« Hastig griff er zum Funkgerät. »Hier spricht Benno, fahre einen weißen Scania. Bin auf Kanal sechs. Hört ihr mich, Kollegen? Bin auf der A5 nach Norden Richtung Butzbach unterwegs. Soeben kam eine Geisterfahrermeldung im Radio. Ist jemand auf meiner Strecke?«
Es knackte. Dann hörte er eine tiefe, brummige Stimme. »Hier Oskar, fahre einen blauen MAN. Kanal sechs rauscht, geh auf Kanal neunzehn.«
Benno schaltete auf Kanal neunzehn. »Hörst du mich jetzt besser?«
»Ja, wo bist du?«
»Habe gerade das Nordwestkreuz Frankfurt hinter mir.« Benno sah auf sein Navi und gab den genauen Kilometerstand durch.
»Bin etwa drei Kilometer vor dir und gerade an der Raststätte Taunusblick vorbeigefahren«, antwortete Oskar. »Sind ziemlich viele Familien unterwegs.«
»Ich sehe es«, bestätigte Benno.
»Bis jetzt ist mir der Wagen noch nicht begegnet. Blockade?«
Eine kalte Gänsehaut überzog Bennos Unterarme. Er umklammerte das knirschende Leder des Lenkrads. Blockade! Jahrelang hatte er sich vor diesem Moment gefürchtet. Aber wer sollte es sonst machen, wenn nicht Oskar und er? Zumindest waren er und sein Wagen voll versichert.
»Klar«, antwortete er mit trockener Kehle.
»Gut, vielleicht ist es auch nur einer, der versehentlich falsch aufgefahren ist und schon längst auf dem Standstreifen steht.«
»Und wenn nicht?«
»Dann stoppen wir ihn.« Oskar klang, als hätte er bereits Erfahrung mit Verrückten, die absichtlich falsch auffuhren. »Tritt aufs Gas, Kumpel. Ich fahre langsamer. In vier Minuten sehen wir uns. Over and out.«
»Over and out«, flüsterte Benno. Dieser Teil der Autobahn war dreispurig. Nur zwei LKWs waren zu wenig. Er starrte auf das Funkgerät. Der Lautsprecher schwieg.
Instinktiv hatte Benno bereits beschleunigt. Nun fuhr er knapp unter hundert, wechselte auf die zweite Spur und überholte einen Citroën mit Wohnwagen. Durch die Scheibe sah er, dass auf der Rückbank zwei Kinder schliefen. Wenigstens würde der Verrückte nicht in dieses Auto krachen und das Leben der Familie zerstören.
Einige Hundert Meter vor sich sah er das Hinweisschild auf die Raststätte, die Oskar gerade eben passiert hatte. Dort müssten doch noch mehr LKW-Fahrer sein. Er griff wieder zum Funkgerät, als gerade auf Kanal 19 eine Meldung durchkam.
»Benno, Oskar, hier spricht Kathie. Habe euer Gespräch gehört. Fahre einen schwarzen Mack. Braucht ihr noch eine Dritte? Bin auf der Taunusblick-Raststätte und fahre gerade auf.«
»Herzlich willkommen, Kathie. Die Luft riecht nach Metall, Öl und Benzin«, rief Oskar.
»Nichts Neues für mich.«
»Morgen Kathie«, sagte Benno. Dieses coole Gerede soll in Wahrheit doch nur eure Nerven beruhigen. »Ich fahre gerade auf die Raststätte zu.« Er blickte durch die Scheibe der Fahrerseite. Das Restaurant und der dahinterliegende Aussichtsturm mit dem Glasfahrstuhl waren hell beleuchtet, lagen aber auf der anderen Fahrbahnseite. Allerdings führte eine Brücke über die Autobahn. Und darauf sah er einen metallicschwarzen US-Truck mit Festbeleuchtung, eine siebeneinhalb Tonnen schwere Zugmaschine ohne Aufleger, die beschleunigte und soeben über die Zufahrt auf die Autobahn raste.
Benno betätigte die Lichthupe. »Ich sehe dich«, gab er durch.
»Ich sehe dich, Kumpel!«, rief Kathie. »Mach Platz!« Sie betätigte das Hupenhorn ihres Trucks. Der Mack dröhnte zweimal wie ein Kreuzfahrtschiff, das aus dem Hafen auslief.
Benno blieb auf der mittleren Spur. Vor ihm fuhr Kathie, kam auf dem Zubringer immer näher heran und rollte auf die rechte Spur. Ihr schwarzer Truck hatte deutlich mehr PS unter der Haube als seiner.
»Willkommen im Team«, krächzte Benno. Mit einem Mal wurde ihm schlecht.
»Na, wenn das kein freudiger Empfang ist.« Es klang zynisch.
Benno erreichte nun ihre Höhe, nahm etwas Gas weg, und kurz darauf fuhren sie nebeneinander her. Gleichzeitig hatten sie dieselbe Idee gehabt und schalteten ihre Warnblinkanlagen ein. Trotzdem hupten hinter ihnen einige Fahrer und blendeten auf.
»Die Arschgeigen sollen überholen, die können gerne unseren Job übernehmen«, schimpfte Kathie.
Benno sah durch seine Beifahrerseite in Kathies Kabine. Soviel er im Licht ihrer Armaturen erkennen konnte, hatte sie kurzes, dunkles Haar, trug eine schwarze Schirmkappe, passend zur Farbe ihres Trucks, und hatte ein Tattoo am Hals.
»Ist das dein Truck?«, fragte Benno.
»Yep.«
»Und trotzdem machst du bei der Blockade mit?«
»Aus Erfahrung weiß ich, dass Geisterfahrer die mittlere Spur bevorzugen – bin also aus dem Schneider.«
»Kann ich bestätigen«, mischte sich Oskar in das Gespräch.
»Wo bist du?«, fragte Kathie.
Es knackte im Funkgerät. Oskar nannte ihnen seine Position.
Benno blickte auf die Uhr. Seit seinem ersten Funkkontakt mit Oskar waren vier Minuten vergangen. Sie mussten ihn jeden Moment einholen.
»Seid mal still!«, rief Kathie.
Soeben wurde die Falschfahrermeldung im Radio wiederholt.
»Keine Entwarnung– fahren Sie weiterhin in beiden Richtungen vorsichtig.«
Kurz darauf drang wieder ein Song aus dem Radio. Stairway to Heaven.
»Idioten«, fluchte Benno und drehte das Radio leiser, damit er den Refrain nicht hörte.
»Ich sehe euch im Seitenspiegel«, meldete sich Oskar schließlich über Funk. »Macht mir ein Plätzchen frei. Ich lasse mich zurückfallen.«
Benno sah die Bremslichter eines Trucks vor sich. Der LKW wechselte auf die dritte Spur. Wie Oskar gesagt hatte: ein blauer MAN. Der Motorwagen zog noch einen Jumboanhänger.
»Was hast du geladen?«, fragte Benno.
»Baumaschinen.«
Insgesamt war das Gefährt bestimmt achtzehn Meter lang, und Benno schätzte es auf ein Gesamtgewicht von vierzig Tonnen. Kathie und er beschleunigten, und nach wenigen Hundert Metern hatten sie Oskar erreicht.
Nun fuhren sie nebeneinander. Das Dröhnen der Motoren klang jetzt doppelt so laut wie vorher. Im Seitenspiegel sah Benno, dass sich hinter ihnen bereits eine Wagenkolonne gebildet hatte. Die meisten hatten wohl begriffen, was sie planten, doch einige Klugscheißer hupten und blinkten sie trotzdem an.
»Kümmert euch nicht darum«, erklärte Oskar.
Benno sah in sein Führerhaus hinüber. Oskar saß in seinem Truck etwas höher als er. Er war etwa sechzig Jahre alt, hatte einen grauen Haarkranz, einen Schnauzer und ein paar Kilo zu viel. Seine Hemdsärmel waren aufgerollt, und am Handgelenk trug er jede Menge Freundschaftsbänder, die im Licht der Armaturen glänzten. Irgendwie erinnerte Oskar ihn an seinen Vater.
Schweigend fuhren sie nebeneinander her, drosselten die Geschwindigkeit auf siebzig Stundenkilometer und warteten ab. Vor ihnen lag die leere Autobahn. Nur ihre drei Abblendlichter schnitten Lichtsäulen in die Dunkelheit.
Sechzig km/h.
Die Geisterfahrermeldung kam ein drittes Mal im Radio. Auch diesmal gab es keine Entwarnung. Bennos Puls beschleunigte. Er schaltete das Radio aus und nahm einen Schluck aus der Thermoskanne. Vielleicht seinen letzten. Erst jetzt merkte er, wie trocken seine Kehle war.
Sie wurden noch langsamer.
Fünfzig km/h.
»Leck mich … da vorn ist er«, drang Oskars Stimme plötzlich aus dem Funkgerät. »Kommt auf der mittleren Spur auf uns zu.«
Wie Kathie gesagt hat.
Fast gleichzeitig schalteten sie ihr Fernlicht ein und begannen zu hupen. Nun sah auch Benno die Lichter des Wagens, der auf sie zuraste. Dann machte der Mistkerl plötzlich das Licht aus.
»Der wird nicht langsamer!«, stellte Kathie fest.
»Bremsen wir auf vierzig runter«, schlug Oskar vor.
Benno nahm den Fuß vom Gas. Links und rechts sah er, wie die LKWs zurückfielen, dann stieg auch er auf die Bremse, um die Höhe zu halten.
»Benno, es wird ernst«, sagte Oskar. »Er beschleunigt und fährt frontal auf dich zu.«
»Hast du einen Airbag?«, fragte Kathie.
»Ja«, krächzte Benno. Er sah aus dem Augenwinkel, wie Oskar durch sein Führerhaus in seine Fahrerkabine blickte.
Irgendwie hatte er ein Gefühl im Bauch, als kannte er Oskar und Kathie schon ewig. Vielleicht, weil es guttat, wenn man in einem Moment wie diesem Freunde in seiner Nähe hatte.
»Stemm dich beim Aufprall nicht mit den Armen gegen das Lenkrad, verstanden?«, sagte Kathie.
»So ein Quatsch!«, brüllte Oskar. »Mach deinen Gurt auf!«
»Was soll ich?«, rief Benno.
»Lass das Lenkrad los, öffne den Gurt, und klettere hinter den Sitz! In deiner Schlafkoje hast du einen Meter mehr Knautschzone!«
Benno starrte auf das auf ihn zurasende Auto. Er griff zum Verschluss des Gurts. Und wenn die Zeit nicht reicht? Seine Beine waren schwer wie Blei.
»Mach schon!«, brüllte Oskar.
»Das schaffst du nicht mehr«, rief Kathie.
Benno blieb wie versteinert sitzen. Instinktiv starrte er auf das Bild seiner Töchter. Scheiße! Was für eine blöde Idee! Wärst du doch nicht schon um vier, sondern erst um fünf losgefahren.
Dann war das Auto da. Dunkel und schnell. Kam wie aus der Hölle herangerast, knallte unter Bennos Stoßstange und verkeilte sich unter der Achse. Benno streckte die Arme durch und wurde nach vorn in den Airbag geschleudert, hörte die Windschutzscheibe knacken und das Quietschen und Kreischen von Metall. Alles, was nicht festgemacht war, flog durchs Führerhaus.
Die Frontscheibe, jetzt ein einziges Spinnennetz, fiel aus dem Rahmen und flog davon, während die gesplitterte Seitenscheibe auf Benno knallte. Zugleich wirbelte der Fahrtwind in den Wagen und riss die Fotos vom Rückspiegel. Automatisch wollte Benno danach greifen, wurde aber zur Seite geschleudert.
Funken schlugen. Der LKW schlingerte.
»Brems doch! Halt den Wagen in der Mitte!«, brüllte Kathie.
Instinktiv war Benno aufs Gas gestiegen. Er schob den zusammengequetschten PKW vor sich her über den Asphalt, wagte aber nicht hinunterzusehen, denn was er aus dem Augenwinkel sah, genügte. Von dem Wagen konnte nicht mehr viel übrig sein – ein verzogenes Gebilde aus Metall, Kunststoff, brennendem Benzin und etwas, das aussah wie ein menschlicher Körper.
1. TEIL
– S U I Z I D –
MITTWOCH, 1. JUNI
1. KAPITEL
Alexandra Meixner klemmte sich ihr Funkgerät an den Gürtel und ging quer über die Autobahn. Der nasse Asphalt reflektierte das Blinklicht des Rettungswagens. Daneben flatterte das rot-weiße Absperrband im Wind. Der ganze Straßenabschnitt sah aus wie ein Schlachtfeld.
»Meixner, Autobahnpolizei«, erklärte sie dem Feuerwehrmann, der den Einsatz leitete. »Und?«
»Nichts zu machen«, brüllte er gegen das Dröhnen des Krans an, der sich gerade in Position brachte. »Wir müssen die Leiche aus dem Wrack schneiden.«
Meixner sah zum Ambulanzwagen auf dem Standstreifen. Die Hecktür war offen, und drinnen lag ein junger Mann. Gut aussehend, breit gebaut, blondes Haar. Er hatte Abschürfungen, sein Kopf war bandagiert. Laut seinen Papieren hieß er Benno Marx. Er hatte den Geisterfahrer gestoppt und stand noch unter Schock. Der Notarzt würde ihn zu Ende untersuchen, und danach wollte Meixner noch kurz mit Benno sprechen, bevor ihn der Wagen ins Krankenhaus brachte.
Während sie wartete, ging sie zur Unfallstelle. Mein Gott, sieht das aus! Der schwarze Audi war frontal unter die Vorderachse des Tankwagens gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls war der Einfüllstutzen an der Seitenwand des Lasters leck geworden, und Milch hatte sich über die Autobahn ergossen. Aber am schlimmsten war, dass das Dach des PKWs wegrasiert und der Wagen wie eine Ziehharmonika zusammengequetscht worden war. Nur falsch aufgefahren? Niemals! Und wenn das stimmte, was die anderen beiden LKW-Fahrer behauptet hatten, hatte der Fahrer des Audi sein Licht ausgeschaltet und beschleunigt. Du wolltest also sterben!
Meixner kennzeichnete die Position der Räder auf der Fahrbahn mit einem Markierungsspray, dann zerrten die Feuerwehrleute das Wrack mit einer Stahlseilwinde unter dem Laster hervor. Sie schnitten das Blech mit einer Hydraulikschere auf und zogen die Leiche eines Mannes heraus – oder was davon übrig war. Ach du Scheiße! Ein junger Feuerwehrmann übergab sich. Meixner konnte nicht sagen, wie alt der Selbstmörder war. Nach der Bekleidung zu schließen war es jedenfalls ein Mann. Was von seinem Kopf übrig war, steckte eingedrückt zwischen den Schultern.
Falls es irgendwo Führerschein oder Personalausweis gab, war da im Moment nicht heranzukommen. Also rief Meixner die Zentrale an und gab das Wiesbadener Kennzeichen des Audi für eine Kfz-Halteranfrage durch. Wenn der Tote der Halter des Wagens war, wäre er vorerst nur auf diese Weise zu identifizieren – und sie musste so rasch wie möglich seinen Namen herausfinden.
Meixner zog die Taschenlampe vom Gürtel ab. Neugierig leuchtete sie in den verzogenen Innenraum des Wagens. Alles war voller Glasscherben und Blut. Zwischen den Pedalen klemmte ein Smartphone. Vielleicht hatte der Mann während der Fahrt telefoniert, das Handy war ihm hinuntergefallen, er wollte es aufheben, nahm dabei die falsche Auffahrt und geriet in die falsche Richtung. Völlig unmöglich war das nicht, aber es klang sehr unwahrscheinlich.
Meixner fasste das Telefon mit Latexhandschuhen an und packte es in einen Klarsichtbeutel. Auf dem Display klebten Blut und Scherben, es hatte einen Sprung, war aber noch intakt. Diese Dinger waren unverwüstlich. Durch die Plastikfolie wollte Meixner die Kontaktadressen und letzten Verbindungen checken, doch das Telefon war gesperrt.
Mist, Fingerabdruck!
Sie blickte sich um und sah den Leichensack auf einer Bahre am Straßenrand liegen. Der Notarzt warf soeben einen Blick auf die Armbanduhr und schrieb etwas auf ein Blatt Papier.
Meixner ging zur Bahre und zog den Reißverschluss auf. Der Arm des Toten fiel heraus, Scherben rieselten zu Boden.
»Kann ich Ihnen helfen?«, murmelte der Arzt desinteressiert, ohne aufzublicken.
»Ich brauche nur seinen Fingerabdruck«, krächzte sie, schob den Zeigefinger der rechten Hand des Toten in die Klarsichtfolie und presste die Fingerkuppe auf das Smartphone.
Auch wenn der Mann tot war, würden seine Fingerabdrucklinien Strom leiten. Und tatsächlich – der Scanner entsperrte das Gerät, und nun war der Inhalt des Handys frei zugänglich. Meixner wandte sich ab.
»Und wer macht den Leichensack zu?«, rief der Arzt.
»Sie!« Meixner würde sich den Anblick nicht noch einmal antun und den Arm anfassen. Stattdessen sah sie sich die letzten Einträge auf dem Gerät an.
Der Mann hatte wenige Minuten vor dem Unfall noch eine SMS verschickt. Hoffentlich war es keine Nachricht an seine Frau in der Art: Liebling, schalt schon mal die Kaffeemaschine ein und gib den Kindern einen Gutenmorgenkuss von mir, bin gleich bei euch.
Da sie selbst eine Tochter hatte, würde ihr so etwas aufs Gemüt schlagen. Sie öffnete die SMS und scrollte durch die wenigen Sätze. Was sie las, klang völlig anders als erwartet.
Du hattest recht.
Die Vergangenheit holt uns ein.
Der 1. Juni wird uns alle ins Verderben stürzen.
Leb wohl!
Da läutete ihr eigenes Handy, und sie ging sofort ran: die Zentrale.
»Wir haben das Kennzeichen überprüft. Es ist ein Dienstfahrzeug. Ein Kollege von uns, vom BKA Wiesbaden.«
»Vom Bundeskriminalamt?«, fragte Meixner entgeistert nach.
»Ja. Kriminalhauptkommissar Gerald Rohrbeck.«
Diesen Namen hatte Meixner zwar noch nie gehört, aber sie kannte das BKA gut genug. Immerhin war sie knapp drei Semester lang an der Akademie ausgebildet worden, ehe sie das Handtuch geworfen hatte. Mittlerweile hätte sie schon seit einem Jahr fertige Profilerin sein können, aber sie war mit ihrem Ausbilder nicht klargekommen. Fast keiner aus ihrem Modul war das. Darum hatten Schönfeld, Gomez und sie die Ausbildung abgebrochen, und nur Sabine Nemez und Tina Martinelli hatten die Akademie für hochbegabten Nachwuchs bis zum Schluss durchgezogen. Ausgerechnet die beiden – von denen sie es am wenigsten erwartet hätte. Mein Gott, was war ihr Ausbilder doch für ein Kotzbrocken gewesen. Maarten Sneijder, dachte sie zynisch, nein, falsch: Maarten S. Sneijder. Das S war ihm ja so verdammt wichtig gewesen.
»Sind Sie noch dran?«
»Ja, danke für die Info«, sagte Meixner. »Hatte Rohrbeck Angehörige?« Sie hörte, wie die Kollegin in der Zentrale in die Tastatur hämmerte.
»Seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Er hat einen Sohn, fünf Jahre alt.«
O Kacke!
»Danke.« Meixner beendete das Gespräch.
Ein Kollege also! Und nun ist sein Sohn Waise! Sie blickte zum Leichensack auf der Bahre und hatte wieder das schreckliche Bild von vorhin vor Augen. Die Hose war zerfetzt, die Beine mehrfach gebrochen, der Oberkörper nur noch ein Trümmerhaufen.
Da drückte ihr ein flaues Gefühl den Magen zusammen. Sie trat noch einmal an das Wrack heran und leuchtete mit der Taschenlampe erneut ins Wageninnere. Nichts! Also ging sie nach hinten und leuchtete die Rückbank aus. Instinktiv war sie darauf gefasst, die zerquetschte Leiche eines Kindes zu sehen. Doch zum Glück war auch die Rückbank leer.
»He, Sie!«, rief sie einem der Feuerwehrmänner zu. »Können Sie den Kofferraum aufbrechen?«
»Jetzt?«
»Nein, nach dem Frühstück. Natürlich jetzt, es ist dringend!«
Meixner wartete eine Minute, bis zwei Männer den Deckel mit einer Hydraulikschere aufgeschnitten hatten.
Die Vergangenheit holt uns ein… Leb wohl!
Die Männer traten zur Seite, und Meixner blickte in den Kofferraum.
Nichts! Keine Kinderleiche.
Meixner atmete erleichtert auf. »Okay, danke.« Sie blickte auf die Anzeige des Handydisplays und las den Text noch einmal – er ergab genauso wenig Sinn wie vorher. Abgesehen von dem kryptischen Inhalt machte sie aber noch eine andere Sache stutzig: Der erste Juni, das ist doch heute!
Schlagartig wurde ihr bewusst, dass sie auf dem Handy des Toten gar nicht nachgesehen hatte, an wen die SMS gegangen war. Nun betrachtete sie die Nummer des Empfängers. Jemand, der als SNEIJ abgespeichert war.
»O nein!«, entfuhr es ihr. Ich kenne diese Nummer! Und ich kenne diesen Namen!
Die rätselhafte SMS war an ihren ehemaligen Ausbilder gegangen: Maarten S. Sneijder.
2. KAPITEL
Sabine Nemez betrat den kleinen Hörsaal und ließ den Blick über die Reihen gleiten, die wie in einem Amphitheater aufsteigend und im Halbkreis angeordnet waren. Die acht Studenten ihres Moduls waren bereits anwesend.
Der Anblick war ihr geläufig. Vier Semester lang hatte sie selbst hier Tag für Tag die Bank gedrückt. Ungewohnt war bloß, dass sie diesmal hinter dem Pult stehen sollte.
Nachdem Maarten Sneijder vor einem Dreivierteljahr verhaftet und vom Dienst suspendiert worden war, Waffe und Dienstmarke abgegeben und auch seine Lehrtätigkeit an der Akademie niedergelegt hatte, war eine große Lücke entstanden. Einige Kollegen waren eingesprungen, doch nun hatte eine von ihnen, die Ausbilderin Anna Hagena, dienstlich verreisen müssen. BKA-Präsident Hess war an Sabine herangetreten und hatte sie gebeten, kurzfristig Hagenas Modul zu übernehmen. Nur für den letzten Monat vor den Sommerferien. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der Mordgruppe. Und sie hatte zugesagt – unter der Voraussetzung, dass sie beim Unterricht freie Hand hatte. Widerwillig hatte Hess zugestimmt. Anscheinend gingen ihm für diesen Job die Leute aus. Und da sie als ehemalige Schülerin und spätere Partnerin von Sneijder dessen Methoden wie kaum jemand anderer kannte, war sie wie geschaffen dafür, an der Akademie einzuspringen.
Sabine legte die Dossiers auf das Pult, stellte sich daneben, strich sich das lange braune Haar hinters Ohr und steckte die Hände in die Hosentaschen. Mit ihren eins dreiundsechzig war sie zwar körperlich nicht gerade der Inbegriff der autoritären Respektsperson, doch die Studenten waren mucksmäuschenstill und sahen sie erwartungsvoll an.
»Mein Name ist Sabine Nemez.« Ihren Dienstgrad sparte sie sich. »Willkommen beim Modul der Operativen Fallanalyse«, begann sie, und ihr Herz schlug bis zum Hals. Bestimmt war sie aufgeregter als ihre Studenten. »Da Kriminalhauptkommissarin Anna Hagena kurzfristig dienstlich verhindert ist, werde ich Sie für den Rest des Semesters unterrichten. Wie Sie wissen, ist Ihr eigentlicher Dozent, Maarten Sneijder, immer noch bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert.«
»Maarten S. Sneijder«, rief jemand nach vorn.
»Richtig.« Sabine musste schmunzeln. Mein Gott, wie oft hatte sie diese Richtigstellung von Sneijder selbst gehört. »Ich könnte Ihnen jetzt das Handbuch der Operativen Fallanalyse vorbeten, mithilfe dessen wir einen fiktiven Fall durchspielen würden, oder wir könnten uns einen gelösten Fall ansehen. Aber darauf habe ich keine große Lust, mal abgesehen davon, dass ich das nicht für besonders effizient halte. Außerdem habe ich keine Ahnung, was gerade im Lehrplan steht.«
»Schlecht vorbereitet«, grummelte ein Student in der dritten Reihe.
»Ich würde sagen, gar nicht vorbereitet«, korrigierte Sabine ihn. »Ich habe erst gestern erfahren, dass ich Ihre Gruppe übernehmen darf. Und deshalb unterbreite ich Ihnen einen anderen Vorschlag. Ich mache mit Ihnen das, was ich am besten kann.«
Die Studenten sahen sie abwartend an.
»Ich bin vier Semester lang in den Genuss von Maarten S. Sneijders Unterricht gekommen und hatte später das Vergnügen, mit ihm als Partner zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit habe ich seine Methoden kennengelernt.«
»Die Methode des Visionären Sehens«, wisperte jemand.
»Exakt. Außerdem möchte ich mit Ihnen, ganz in Sneijders Tradition, ein paar ungelöste Fälle durchnehmen. Er war immer der Meinung, dass man die Lösung bereits aufgeklärter Fälle googeln oder im Archiv nachlesen könnte. Aber wie er, so möchte auch ich Sie zu selbstständig denkenden Menschen heranbilden. Jeder kreative Ansatz ist erlaubt. Wir werden uns daher einen aktuellen Fall vornehmen und versuchen, über den Tellerrand zu blicken. Dabei werden Sie unter anderem auch Sneijders breites Repertoire an Ermittlungsmethoden kennenlernen – von seinen kleinen Eigenarten mal abgesehen.«
»Wie selbstgedrehte Zigaretten«, sagte einer.
Die Studenten lachten, und Sabine grinste. Natürlich hatte sich Sneijders Vorliebe für Marihuana bis zu ihnen durchgesprochen.
Sabine wurde wieder ernst. »Davor muss ich Sie aber bitten, diese Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen.« Sabine ging durch die Reihen und teilte die Formulare aus. »Wenn Sie dagegen verstoßen, fliegen Sie von der Akademie. Wenn Sie sich jedoch an meine Anweisungen halten, lernen Sie vermutlich in einem Monat Praxis mehr als in einem ganzen Semester voll trockener Theorie. Wie klingt das?«
Die Studenten nickten. Eine junge Frau hob die Hand.
»Ja bitte?«
»Wie war Sneijder so?«
Sabine hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. »Sneijder kann man nicht beschreiben. Man muss ihn erlebt haben.«
Doch damit gaben sich die Studenten nicht zufrieden. »Erzählen Sie!«, bohrten sie weiter.
Wie war er so? Sabine ging wieder zum Pult, setzte sich daneben leger auf den Tisch und ließ die Beine herunterbaumeln.
»Er war ein Kotzbrocken«, sagte sie. »Manchmal habe ich ihn dafür gehasst, wie er mit anderen Menschen umging. Er hat sie gedemütigt, regelrecht zusammengefaltet. Er duldete keinen Widerspruch. Aber diese Härte allen Menschen und besonders seinen Studenten gegenüber diente nur einem Zweck: Er wollte uns auf die Realität dort draußen vorbereiten. Die Durchfallquote in seinem Modul lag bei siebzig Prozent. Auf der anderen Seite hatte er eine Aufklärungsrate von siebenundneunzig Prozent. Er konnte sich in jedes noch so kranke Gehirn hineinversetzen – und das tat er auch, bis zur völligen Selbstaufopferung.« Seufzend hob sie den Blick. »Aber so weit werden wir hier nicht gehen.«
Ein Student hob den Arm. »Angeblich hat er letztes Jahr einen Menschen erschossen.«
»Nicht nur angeblich.«
»Sie waren dabei, nicht wahr? Wurde er deshalb verhaftet und anschließend suspendiert?«
Sabine nickte. Sie hatte die Bilder immer noch vor Augen und spürte immer noch die Tränen, die ihr an diesem Tag übers Gesicht gelaufen waren.
»Waren Sie bei Sneijders Gerichtsverhandlung dabei?«
Wiederum nickte sie. »Ich war die Hauptzeugin.«
»Und?«
Alle beugten sich nach vorn und starrten sie an.
O Gott, was für ein neugieriger Haufen! Aber Meixner, Schönfeld, Gomez, Martinelli und sie waren vor drei Jahren nicht anders gewesen. »Heben Sie Sneijders Akte aus dem Archiv aus. Dort können Sie meine gerichtliche Zeugenaussage nachlesen.«
»Hätten wir schon längst getan, aber wir haben keinen Zugang zum Archiv.«
Den hatte ich damals auch nicht. »Seien Sie kreativ, lassen Sie sich etwas einfallen.«
Enttäuscht lehnten sich die Studenten zurück.
»Was macht Sneijder heute?«, fragte eine junge Frau mit kurzen blonden Haaren in der ersten Reihe.
»Um die Wahrheit zu sagen: Ich weiß es nicht.« Sie hatte seit der Gerichtsverhandlung keinen Kontakt mehr zu Sneijder. In dieser Zeit hatte sie ihn kein einziges Mal gesehen, ihn nie um Rat gefragt und all ihre Fälle allein gelöst.
Nachdem sich das Gemurmel im Saal beruhigt hatte, ging sie durch die Reihen und sammelte die unterschriebenen Verschwiegenheitserklärungen ein. Dann griff sie zur Fernbedienung, schloss die Jalousien und aktivierte den Beamer.
»Ich hoffe, Sie haben einen starken Magen. Gleich sehen Sie die Fotos eines aktuellen Tatorts …«
Eine Stunde später hatten die Studenten den Hörsaal verlassen. Bestimmt gingen sie nun in die Mensa auf einen starken Kaffee, zu mehr würde ihnen der Appetit fehlen. Aber es hatte keinen Sinn, sie zu schonen. Sabine hatte sich vorgenommen, wie Sneijder gleich von Beginn an die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie schaltete den Beamer aus und packte ihre Unterlagen zusammen.
Als sie den Hörsaal verlassen wollte, läutete ihr Handy. Die Nummer von Hess erschien auf dem Display. Der Präsident höchstpersönlich. Gab es schon die erste Beschwerde wegen ihrer Unterrichtsmethode?
»Guten Morgen, Präsident Hess«, meldete sie sich.
»Nemez, ich habe eine Ermittlung für Sie«, kam er gleich zur Sache.
»Aber ich unterrichte gerade an der Akademie. Sie selbst haben …«
»Ich weiß!«, unterbrach er sie. »Die paar Stunden an der Akademie machen Sie doch nebenbei.«
»Weiß Kriminalhauptkommissar Timboldt davon?«
»Keine Sorge, ich werde ihn noch darüber unterrichten.«
»Danke«, murmelte Sabine. Nach Sneijders Suspendierung war Timboldt der neue Leiter der gesamten Mordgruppe im BKA geworden, womit er einen unglaublichen Karrieresprung hingelegt hatte. »Worum geht es?«
»Eine Frau ist gestern Abend in ihrem Haus die Treppe hinuntergestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Nicht weit weg von hier, in Mainz. Sie wurde erst heute Morgen gefunden. Vermutlich handelt es sich um Mord.«
Vermutlich? Sabine schwieg. Wollte Hess sie verarschen?»Einbruch und Raubmord?«
»Wissen wir noch nicht.«
»Bei allem Respekt, aber das klingt nicht nach einem Fall für das BKA. Dafür ist doch die Mainzer Kripo zustä…«
»Nemez! Ich entscheide hier immer noch, wo und wann das BKA ermittelt und wo nicht. Und dieser Fall ist wichtig! Bei der Toten handelt es sich um Doktor Katharina Hagena.«
Hagena! Ein nicht gerade häufiger Name. Sabine legte die Unterlagen auf das Pult und starrte durchs Fenster des Hörsaals auf das Areal der Akademie. Hinter dem Parkplatz, den Schranken und dem Häuschen des Pförtners lag auf der gegenüberliegenden Straßenseite das mächtige Gebäude des BKA. »Hagena?«, wiederholte sie. »So wie …?«
»Richtig, so wie Anna Hagena. Die Tote ist ihre Schwester.«
Sabine schluckte. Nicht nur, dass sie soeben Anna Hagenas Studenten übernommen hatte, sie kannte die Frau auch persönlich. Hagena war etwa fünfundvierzig Jahre alt, und Sabine hatte vor zwei Jahren einige Module bei ihr belegt.
Nun war Anna Hagenas Schwester tot. »Und ich soll …?«
»Ja, verdammt. Sie sollen den Fall übernehmen, und wenn es tatsächlich Mord war, den Mistkerl ans Kreuz nageln.«
»Weiß Anna Hagena schon, dass ihre …?«
»Nein, und damit sind wir beim zweiten Teil Ihrer Aufgabe: Bringen Sie es ihr schonend bei.«
3. KAPITEL
Donnerstag, 26. Mai
Hardy zog den Gürtel seiner Jeans enger. Der Dorn rastete im letzten Loch ein, und ein zusätzliches Loch wäre auch gut gewesen. Da sah man wieder, wie man sich im Lauf der Jahre veränderte. Obwohl er wegen seines Trainings einige Kilo zugelegt hatte, war seine Taille schmäler geworden.
Er schlüpfte in die Lederjacke und spürte, wie sie an den Oberarmen und am Brustkorb spannte.
»Los, weiter!«, rief jemand hinter ihm.
Hardy musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer den Raum betreten hatte. Es war die Stimme von Major Kieslinger, deren dumpfen Klang er nur zu gut kannte.
»Ich sagte weiter!«
»Ja, halt’s Maul«, murrte Hardy.
»Wie bitte?«
Mit Hardy war schon einmal das Temperament durchgegangen, er hatte dem Mann damals den Kiefer gebrochen, und das hatte ihm weitere achtzehn Monate eingebracht.
Hardy war nicht so blöd, denselben Fehler ein zweites Mal zu begehen. Besonders nicht an einem Tag wie diesem. Und deshalb schwieg er.
»Was hast du gesagt?«
»Nichts.« Hardy krempelte die Ärmel der Lederjacke einmal um und griff in die Innentasche. Da steckte seine Sonnenbrille. Er wischte die Gläser am Stoff seines schwarzen T-Shirts ab und steckte sich die Brille über der Stirn in den Bürstenhaarschnitt. Seine ehemals blonden Haare waren an der Seite grau geworden, die Wangen schmal, Stirn und Hals faltig, und der Haaransatz war ganz schön zurückgewichen. Das Gesicht eines Fünfzigjährigen. Gealtert, aber mit wachem, messerscharfem Blick. So klar und scharf wie noch nie.
»Du bist schick genug«, drängte Major Kieslinger hinter ihm. »Los jetzt!«
Kommentarlos setzte sich Hardy in Bewegung. Pünktlich um acht Uhr erreichte er den Schalter für die Entlassungen.
»Hardy, mein Freund!«, sagte der Fettklops hinter dem Sprechschlitz. »Du siehst scheiße aus.«
»Zwanzig Jahre in deiner Nähe können einen Mann verändern«, brummte Hardy.
Der Fette schob einen Kugelschreiber und einen Packen Formulare durch den Schlitz. »Kriege drei Unterschriften, hier, hier und hier.«
Hardy las sich die Entlassungspapiere und den Depositenbericht genau durch. Schließlich griff er zum Stift und kritzelte Thomas »Hardy« Hardkovsky auf die Blätter.
»Verflucht, das ist ungültig, das ist nicht dein richtiger Name«, beschwerte sich der Beamte.
»Ach ja, richtig«, brummte Hardy, und strich zwei Teile davon durch.
Thomas»Hardy«Hardkovsky
»O Mann!«, rief der Fette. »Mit dir gibt es immer nur Ärger. Bin ich froh, dich endlich loszuwerden.«
»Dann rede nicht lange herum und gib mir meine Sachen, du Qualle!«
Der Fette schob eine Kunststoffschale durch den Schlitz. Darin befand sich ein kleiner Haufen armseliger Besitztümer, die zwei Jahrzehnte lang im Magazindepot im Keller gelagert hatten. Hardy wühlte mit den Fingern durch die Sachen: ein Reserveschlüssel für einen Pajero. Wem gehört der Wagen jetzt wohl– falls es ihn überhaupt noch gibt? Ein Haustorschlüssel. Das Haus gibt es jedenfalls definitiv nicht mehr, das haben sie inzwischen abgerissen. Ein uraltes Mobiltelefon mit Antenne. So groß wie ein Ziegelstein. Vergiss es! Eine Tüte Bonbons. Schau an– englische Rockie-Drops mit Pfefferminzgeschmack. Abgelaufen vor neunzehn Jahren. Eine alte Lederbrieftasche mit ein paar Scheinen drin. Zweihundertsiebzig D-Mark. Wie hilfreich! Zum Glück waren ihm an der Kasse zwölftausenddreihundert Euro ausbezahlt worden. Der Job in der Küche hatte sich bezahlt gemacht – Überstunden an fast jedem Wochenende –, und die Gefängnisdirektion hatte die Hälfte seiner Einkünfte als Rücklage für ihn angespart.
Hardy wühlte weiter durch den Stapel. Ein längst abgelaufener Reisepass und ein Führerschein. Nur noch ein sprödes Heft und ein vergilbter Fetzen Papier. Eine Packung Schmerztabletten. Die könnt ihr behalten! Eine teure Taschenuhr, die sie ihm damals als finanzielle Sicherstellung abgenommen hatten. Sieh an, klebt immer noch Blut von der Festnahme dran. Ein zerlesenes Buch. Der Fänger im Roggen. Eine Packung Streichhölzer und eine Schachtel Zigaretten. Memphis– aber damit hast du vor zwanzig Jahren aufgehört.
»Okay.« Hardy nahm nur Brieftasche, Führerschein, Pass, Uhr und das Buch, steckte alles in die Tasche und ging.
»Und der Rest?«, rief ihm der Fettklops nach.
»Kannst du auf eBay verhökern.«
»Und was ist mit den Büchern in deiner Zelle? Wie viele sind es? Hundert?«
»Zweihunderteinundsechzig«, antwortete Hardy. Der Fettklops war noch nie gut im Zählen gewesen.
»Zweihunderteinundsechzig?«, wiederholte der Mann.
»Ja.« Hardy drehte sich um. Eine bunte Mischung aus Faulkner, Steinbeck und anderem Zeug, für das sich niemand im Knast interessierte. »Das kannst du jemandem in deiner Familie schenken, falls wenigstens einer deiner Verwandten lesen kann.«
Hardy stand auf der Straße, setzte sich die Sonnenbrille auf und blickte in beide Richtungen. Die Sonne brannte unbarmherzig auf sein Genick, der Schweiß lief ihm über den Rücken.
Diese verdammte Hitze!
Und da waren auch wieder seine Kopfschmerzen. Seit Jahren kamen sie regelmäßig, er weigerte sich aber, Medikamente dagegen zu nehmen. Lieber die Schmerzen ertragen als die Sinne betäuben. Scheiß drauf!
Das alte rote Backsteingebäude mit den vergitterten Fenstern, in dem die Justizvollzugsanstalt Bützow untergebracht war, lag nun hinter ihm. Im wahrsten Sinn des Wortes. Vor ihm lag die Freiheit.
Von hier waren es nur dreißig Kilometer Luftlinie nach Rostock, und an manchen Tagen hatte Hardy sogar das Gefühl gehabt, das Salzwasser der Ostsee riechen zu können. Das war natürlich Einbildung, aber wenn man so lange im Knast war wie er, entwickelte man eigene Fantasien. Und nicht alle hatten mit Rache zu tun. Allerdings würde es ihn jetzt erst mal nicht ans Meer ziehen, sondern in eine andere Richtung: in die Gegend von Frankfurt und Wiesbaden. Da musste er hin. Dort würde er Antworten finden.
Wie zu erwarten war niemand gekommen, um ihn abzuholen. Wer denn auch? Niemand würde sich freuen, dass er wieder draußen war. Im Gegenteil!
Der Einzige, der sich für ihn zu interessieren schien, war der Fahrer des schwarzen Lada Taiga, der etwa hundert Meter weit entfernt vor der Friedhofsverwaltung auf der Straße stand. An der schiefen Stoßstange sah Hardy, dass der Wagen eine leichte Schräglage nach links hatte, es schien also jemand darin zu sitzen. Wer das war, konnte er nicht erkennen, denn das Sonnenlicht spiegelte sich in der Scheibe.
Langsam ging Hardy zur Bushaltestelle, die direkt vor der Haftanstalt in der Kühlungsbornerstraße lag. Von dort aus würde ihn der Stadtverkehrsbus zum Bahnhof bringen.
Während der wenigen Schritte nahm er das Buch aus der Jackentasche. Es wurde Zeit, neue Bekanntschaft mit Holden Caulfield und seiner Schirmmütze zu machen, die er immer verkehrt herum trug.
Auf der ersten Seite in dem Buch stand eine Widmung.
Im Grunde deines Herzens bist du immer noch ein Kind.
Bleib so.
In Liebe, Lizzie
Eine Widmung von seiner Frau. Niemand auf dieser Erde hatte ihn so gut gekannt wie Elisabeth Hardkovsky, seine Lizzie. Na ja, mit Ausnahme von Nora – aber diesen Gedanken verdrängte er rasch wieder.
Hardy erreichte die Haltestelle und schielte zu dem schwarzen Wagen hinüber. Niemand würde ihn daran hindern, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Weder der Mann im Lada Taiga noch sonst jemand.
Immerhin hatte er zwanzig Jahre darauf gewartet, endlich die Wahrheit herauszufinden. Er würde in Erfahrung bringen, wie und warum seine Frau gestorben war und wer dafür verantwortlich war. Sorgfältig hatte er an den Details seines Vorhabens gefeilt. Die Sache würde er jetzt innerhalb weniger Tage durchziehen, und es würde ein verdammter Todesreigen werden – für alle, die damals ihre Hand im Spiel gehabt hatten …
4. KAPITEL
Mainz lag nur wenige Autominuten südlich von Wiesbaden. Im Stadtteil Gonsenheim stand eine vornehme Villa neben der anderen, und besonders in der Breite Straße sah man die prächtigsten Bauten in unterschiedlichen Baustilen.
Neidisch könnte man werden!
Sabine parkte ihren Wagen neben einer Straßenbahnhaltestelle direkt vor einem zweistöckigen Haus mit unten roten und oben gelben Backsteinen, mit Erkern, Gaubenfenstern und niedlichem Spitzdach. Die Tür hinter dem schmalen Balkon war geöffnet, und ein blütenweißer Vorhang wehte ins Freie. Sabine legte das BKA-Schild auf das Armaturenbrett, nahm ihr Notebook und stieg aus.
Eine Minute später stand sie in dem Einfamilienhaus, lehnte sich an den Holzpfosten des Treppengeländers und blickte über die Stufen hinauf in den ersten Stock. Für Anfang Juni war es draußen ungewöhnlich heiß und drückend, aber im Haus lief zum Glück die Klimaanlage.
Die Kollegen von der Spurensicherung waren größtenteils fertig, und Dr. Katharina Hagenas Leiche war bereits abtransportiert worden. Nur die weißen Linien zeigten noch, wo ihr Körper gelegen hatte: verkrümmt am Ende der Treppe mit unnatürlich zur Seite gedrehtem Kopf.
»Spuren eines Einbruchs?«, fragte sie einen Kollegen, nachdem sie ihm ihren Ausweis gezeigt hatte. Im oberen Stockwerk flammte ein Blitzlicht auf.
»Das BKA?«, stellte der Mann von der Mainzer Kripo erstaunt fest, steckte sein Diktiergerät weg und schüttelte dann den Kopf.
»Spuren eines Kampfes?«
»Nein.«
»Spuren von Gewalteinwirkung am Körper der Toten?«
»Nein.«
»Fehlt irgendetwas?«
»Sieht nicht danach aus. Ich frage mich, was wir hier eigentlich sollen.«
Das frage ich mich auch. Sabine blieb ihm die Antwort schuldig. Aber offensichtlich wusste Hess mehr als sie oder glaubte es zu wissen. Andernfalls hätte er sie nicht herbeordert.
»Brauchen Sie uns noch?«, fragte der Mann.
»Nein, wenn Sie fertig sind, können Sie gehen. Danke!«
Der Mann nickte seinen Kollegen zu, woraufhin die ihre Sachen zusammenpackten. Vom oberen Stock kamen die Leute von der Spurensicherung und der Kripofotograf herunter, und gemeinsam verließen sie im Gänsemarsch das Haus. Die massive Eingangstür mit den Glaskassetten knallte zu, und im nächsten Moment war es bis auf das Surren der Klimaanlage totenstill in der Villa.
Sabine rief sich die Daten von Katharina Hagenas Akte, die sie zuvor gelesen hatte, ins Gedächtnis. Die Frau war dreiundfünfzig gewesen, hatte – wie später ihre Schwester Anna – nach dem Abitur die Polizeischule absolviert, hinterher aber keine Karriere beim BKA eingeschlagen, sondern Jura studiert, promoviert, jahrelang in verschiedenen Anwaltskanzleien gejobbt und sich vor knapp zehn Jahren mit einer eigenen Kanzlei selbstständig gemacht. Schwerpunkt Strafrecht. Anscheinend hatte sie gut verdient, zumindest mehr als ihre Schwester beim BKA, denn Katharina Hagena hatte – wie sie von einer Kollegin wusste – allein in dieser Villa mit kleinem Garten, Sauna, Infrarotkabine und Whirlpool gelebt. Laut Grundbuch war das Anwesen schuldenfrei.
Sabine starrte die Treppe hinauf. Von dort oben war die Anwältin hinuntergestürzt. Am oberen Treppenabsatz gab es Spuren an der Wand. Wenn man den vorläufigen Daten der Spurensicherung glauben durfte, die Sabine sich im zentralen Einsatzleitsystem angesehen hatte, stammten diese von Katharina Hagenas Fingernägeln. Die Anwältin hatte sich wohl in die Tapete gekrallt und war abgerutscht. Daraufhin war sie mit dem Kopf in etwa einem Meter Höhe an die Wand geknallt. Ist jemand im Haus gewesen und hat sie bedrängt? Falls ja, hatte sie vermutlich versucht sich zu wehren und war die Treppe hinuntergefallen. Gebrochenes Handgelenk, gebrochenes Schlüsselbein, ausgekugeltes Daumengelenk, gesplittertes Schienbein und schließlich Genickbruch. Laut ärztlichem Befund litt sie an starker Osteoporose. Als sie unten auf dem Teppich ankam, war sie vermutlich schon tot.
Wieder blickte Sabine hinauf. Da die Räume drei Meter fünfzig hoch waren, wirkte die Treppe entsprechend imposant. Irgendwie erinnerte sie der Anblick der Stufen an den Film Der Exorzist, in dem Linda Blair auf allen vieren über die Treppe hinuntergekrabbelt kam. In dem Haus war es auch genauso düster wie im Film, da wegen der Hitze alle Jalousien unten waren.
Theoretisch hätte Katharina Hagena auch über eine Katze oder einen Hund gestolpert sein können, doch es gab keinerlei Hinweise auf ein Haustier, keinen Fressnapf und auch sonst nichts. Somit lautete die Frage: Wer oder was hatte sie bedrängt?
Sabine rief über ihr Notebook den aktuellen Stand der Ermittlungen auf, der minütlich aktualisiert wurde. Hagena hatte offiziell ganz allein in diesem Haus gelebt, und den Nachbarn waren keine Besucher an diesem Abend aufgefallen. Den einzigen Hinweis auf einen Gast hätte die Alarmanlage liefern können. Ein modernes Funksystem mit Kamera und Bewegungsmelder, das jede Bewegung vor der Eingangstür filmte. Doch die Aufnahmen waren gelöscht worden. Und auf der Tastatur, die sich unter dem Display an der Wand im Vorzimmer befand, gab es keine Fingerabdrücke. Nicht einmal die von Katharina Hagena selbst. Das Pulver der Spurensicherung klebte noch darauf. Also hatte jemand die Aufnahmen absichtlich entfernt und anschließend seine Fingerabdrücke auf der Tastatur weggewischt. Möglicherweise war Hess’ übertriebene Sorgfalt doch nicht so unbegründet – und vielleicht konnten die Spezialisten die gelöschten Aufnahmen wiederherstellen.
Sabine ging mit ihrem Notebook die breite Treppe hinauf. Die ratternde Klimaanlage blies kühle Luft hinunter, sodass sich eine Gänsehaut in Sabines Nacken bildete. Im oberen Stockwerk lag ein dunkelroter Perserteppich. Sabine konnte keine Falte darin erkennen, über die Katharina Hagena eventuell hätte gestolpert sein können. Von hier aus ging es in fünf weitere Räume: Bad, WC, Schlafzimmer, Büro und begehbarer Schrank. Neben der Bürotür fand Sabine das Display der Klimaanlage. Es war auf sechzehn Grad eingestellt. Ungewöhnlich niedrig! Möglicherweise hatte ein eventueller Mörder die Temperatur so gedrosselt, um die Arbeit des Rechtsmediziners bei der exakten Feststellung des Todeszeitpunkts zu erschweren. Clever gelöst! Immerhin war die Anlage die ganze Nacht bis jetzt aktiv gewesen. Und auch auf diesem Display hatten die Kollegen von der Spurensicherung keine Fingerabdrücke gefunden.
Wie lautete Sneijders Kommentar in solchen Situationen? Je mehr Spuren der Killer zu verwischen sucht, umso mehr Spuren hinterlässt er uns.
Sabine schaltete die Klimaanlage aus und betrat Katharina Hagenas Büro. Auch hier waren die Jalousien geschlossen, und in dem Raum herrschte eine frostige Kälte. Sabine legte ihr Notebook auf den Schreibtisch und verzichtete darauf, sämtliche Berichte noch einmal zu aktualisieren. Technik ist nicht alles. Lieber wollte sie versuchen, die Atmosphäre des Tatorts in sich aufzunehmen.
Wenn man die heruntergestellte Klimaanlage berücksichtigte, war der Tod gegen zweiundzwanzig Uhr eingetreten. Sabine schloss für einen Moment die Augen und rief sich die Fotos in Erinnerung, die die Kollegen gemacht hatten. Die Anwältin hatte noch kein Nachthemd getragen, sondern war mit Jeans und schwarzer Bluse bekleidet gewesen. Und laut vorläufigem Befund des Rechtsmediziners hatte sie kurz vor ihrem Tod weder Zähne geputzt noch Spuren von Seife an den Fingern gehabt.
Sabine hörte ein Knarren des Parkettbodens und sah auf. Jemand befand sich im Zimmer. In der gegenüberliegenden dunklen Ecke des Büros stand eine Frau. Schlank, hochgewachsen, in Jeans und schwarzer Bluse. Sie hielt den Blick gesenkt und sah Sabine durch das lange dunkle Haar an, das ihr in die Stirn fiel.
Sabine kniff die Augen zusammen. »Katharina Hagena?«
»Ja.«
»Was haben Sie gestern Abend kurz vor zweiundzwanzig Uhr hier oben gemacht?«
»Was vermuten Sie?«
»Im Bad sind Sie noch nicht gewesen, um sich für die Nacht frisch zu machen. Ich nehme an, auf der Toilette auch nicht, denn es gibt auch im unteren Stockwerk eine. In Ihrem begehbaren Kleiderschrank waren Sie auch noch nicht, da Sie noch die Ausgehkleidung trugen. Also bleibt nur das Büro.«
»Dann wird es wohl stimmen.«
»Vermutlich waren Sie nicht allein in Ihrem Büro, habe ich recht?«
»Vermutlich.«
»Wer war noch da?«
»Sehen Sie Verletzungen oder Kampfspuren an mir?«
»Nein. Sie haben Ihren Mörder also gekannt?«
»Oder meine Mörderin.«
Oder meine Mörderin, wiederholte Sabine in Gedanken. Sie schüttelte die Vision ab, und das Bild der Frau verblasste. In der Ecke stand nichts weiter als eine Stehlampe, an der ein Kleiderhaken mit einer Strickjacke hing.
Sabine betrachtete den Schreibtisch. Auch hier keine Spuren eines Kampfes, Akten und Stifte ordentlich sortiert, neben dem Monitor ein Tablett mit leerem Teller und Kaffeetasse. Sabine roch dran. Kakao. Anscheinend hatte Katharina Hagena Dienstagnacht in ihrem Büro gearbeitet.
Auf der anderen Seite des Schreibtisches stand eine moderne Telefonanlage mit großem Display und Freisprecheinrichtung; daneben lag ein Notizbuch. Sabine blätterte es auf. Eine Kombination aus Terminkalender und Telefonverzeichnis. Für Dienstagabend waren keine Termine eingetragen. Danach kam bloß der Hinweis, dass sich Hagena am Mittwoch eine Vorabendserie im TV ansehen wollte. Wie die Folge ausging, würde sie nicht mehr erfahren.
Auch auf der Tastatur des Telefons klebte noch das Pulver der Spurensicherung. Hier hatte es ebenfalls keine Fingerabdrücke gegeben. Sabine rief über das Display die Speicherkarte auf, um sich die Nummern der letzten Telefonate anzusehen.
Keine Eintragungen!
Auf dem Anrufbeantworter waren auch keine Nachrichten. Sie lächelte bitter. Irgendjemand hatte sich wirklich große Mühe gegeben, alle Spuren zu verwischen.
Soviel Sabine wusste, waren die Eltern der Hagena-Schwestern bereits vor vielen Jahren gestorben. Katharina hatte bis auf ihre Schwester keine Verwandten. Sabine schlug das Telefonbuch auf, suchte Anna Hagenas Nummer heraus und rief sie mit ihrem Handy an.
Es läutete dreimal, dann hob die Kollegin ab. »Hagena?«
»Hallo, hier spricht Sabine Nemez, BKA Wiesbaden. Ich habe an der Akademie Ihr Modul …«
»Ich weiß, wer Sie sind. Ehemalige Studentin von der Akademie. Kann mich an Sie erinnern. Geht es um meinen Kurs?«
»Ich rufe aus dem Haus Ihrer Schwester an.«
»Aha.« Hagena klang nicht gerade überrascht. »Ich wollte gestern Abend mit ihr telefonieren, habe es mehrmals versucht, konnte sie aber nicht erreichen, woraufhin ich die Nachbarin angerufen habe, damit sie nach Katharina sieht. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Was ist passiert?«
»Ich habe leider schlechte Nachrichten. Es betrifft Ihre Schwester.« Sabine machte eine Pause. »Sie wurde heute Morgen tot in ihrem Haus aufgefunden.«
Schweigen.
»Es tut mir leid«, fuhr Sabine fort. »Vermutlich ist sie die Treppe hinuntergestürzt und hat sich das Genick gebrochen.« Sabines Mutter war vor einigen Jahren in einer Kirche in München ermordet worden. Damals hatte sie den Mistkerl gemeinsam mit Maarten Sneijder gefasst. Sie wusste also, wie es war, ein Familienmitglied zu verlieren, und konnte sich gut in Anna Hagenas Situation hineinversetzen.
»Es tut mir leid«, wiederholte Sabine. »Was wollten Sie mit Ihrer Schwester besprechen?«
Keine Antwort.
»Anna, ich muss mit Ihnen sprechen. Wann können wir uns sehen?«, fragte Sabine.
Hagenas Stimme klang gebrochen. »Ich bin beruflich in Berlin. BKA-Sicherheitskonferenz. Ich komme heute Abend zurück, allerdings erst ziemlich spät.«
Sabine wusste, dass diese Konferenz jedes Jahr in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche stattfand. »Kann ich gegen neun Uhr zu Ihnen kommen?«
Hagena dachte nach. »Ja, sicher.« Sie räusperte sich. »Sie untersuchen den Fall? Nicht die Mainzer Kripo?«
»Präsident Hess will es so.«
»Verstehe. Wurde Katharina ermordet?«
»Wissen wir noch nicht. Falls ja, werde ich den Mörder finden.«
»Ich weiß, danke.« Sie beendete das Gespräch.
Sabine betrachtete den leeren Teller und die Kakaotasse neben dem Monitor.
Ich wollte gestern Abend mit ihr telefonieren, habe es mehrmals versucht, konnte sie aber nicht erreichen.
Aber Katharina Hagena war doch zu Hause gewesen! Und nach dem Mord konnte Anna Hagena nicht mehr angerufen haben, da das Display die versäumten Anrufe angezeigt hätte.
Etwas stimmte hier nicht. Sabine würde sich von der Telekom eine Liste mit den letzten Anrufen und Gesprächen besorgen. Allerdings nicht auf dem Dienstweg – die Telefongesellschaften rückten die Daten nämlich erst am Monatsende heraus, wenn sie regulär abrechneten, es sei denn, der Staatsanwalt schritt ein. So lange wollte Sabine nicht warten. Mittlerweile kannte sie Wege, um rascher an die Informationen heranzukommen.
Aber es gab noch zwei andere Dinge, die sie stutzig machten: Anna Hagena hatte recht emotionslos reagiert – obwohl sie gerade ihre letzte lebende Verwandte verloren hatte. Und sie hatte auch gar nicht wissen wollen, ob ihre Schwester bevor oder nachdem sie hier angerufen hatte, gestorben war. Sabine selbst hätte in diesem Fall der genaue Zeitpunkt des Todes interessiert.
Um ein Uhr saß Sabine in der Mensa der Akademie und scrollte in ihrem Notebook durch ein weiteres Update des vorläufigen Berichts der Spurensicherung. Viele Untersuchungen standen noch aus, und das Ergebnis würde erst in ein paar Tagen vorliegen. Eigentlich hätte Sabine diesen Fall als Nächstes mit ihren Studenten durchnehmen können, doch irgendwie widerstrebte ihr das. Warum eigentlich? Es gab nur eine einzige, aber relativ simple Antwort: Weil dir dein Bauchgefühl sagt, dass deine Kollegin irgendwie darin verwickelt ist. Und deshalb solltest du die Sache vorsichtig angehen!
»Hallo, Sabine.«
Sie schreckte hoch. Vor ihr stand Diana Hess, die Frau des BKA-Präsidenten. Sie trug einen eleganten cremefarbenen Hosenanzug und hatte die Haare bis auf ein paar Strähnen hochgesteckt.
»Ich warte auf meinen Mann, wollte mir etwas die Beine vertreten und habe Sie zufällig durchs Fenster in der Mensa gesehen. Wie geht es Ihnen?«
»Danke. Wollen Sie sich nicht setzen?« Sabine schob ihre Unterlagen zusammen.
»Ich habe nur ein paar Minuten Zeit.« Diana Hess nahm Platz. Eine Sonnenbrille steckte im Ausschnitt ihrer Bluse, und ihre Haut roch nach Sonnenöl. »Mein Gott, wie lange ist das her, seit ich diese Mensa das letzte Mal betreten habe?« Sie lächelte.
Sabine brauchte nicht lange zu überlegen. »Ein halbes Jahr. Am Tag von Sneijders Gerichtsverhandlung. Wir haben uns hier getroffen und Kaffee getrunken.«
»Ja, richtig.«
Sabine hatte Diana zwar seither öfters gesehen – einige Male am Eingang des BKA-Gebäudes, dann in Dietrich Hess’ Büro, zweimal beim Mittagessen und einmal in der Wiesbadener Fußgängerzone beim Einkaufen. Sie hatten sich immer gut verstanden, waren einander sympathisch, aber so richtig ungestört hatten sie nie reden können. Kein Wunder bei einer Frau wie Hess, die offizielle Termine ohne Ende hatte, und bei Sabines Job, der sie oft in andere Bundesländer oder ins Ausland führte. »Wie geht es Ihnen?«
»Ach ja, eigentlich ganz gut«, seufzte Diana. »Mich in die Arbeit zu stürzen war für mich schon immer die beste Methode, um schreckliche Erinnerungen zu verarbeiten.«
Damit meinte sie wohl die Ereignisse, als sie und Sabine nur knapp dem Tod entronnen waren – und ihre Art der Therapie war anscheinend die anstrengende Wohltätigkeitsarbeit für Kinderheime, der sie sich seit einem Dreivierteljahr widmete.
»Und Ihnen?«, fragte Diana.
»Für mich ist die Mörderjagd meine Motivation weiterzumachen.« Kuhscheiße! Sie hörte sich schon an wie Sneijder.
Diana wurde ernst, betrachtete ihre schlanken Finger und spielte mit einem Ring. »Ich kann Ihnen nicht oft genug dafür danken, dass Sie nicht gegen Maarten ausgesagt haben. Mir ist klar, welche Überwindung Sie das gekostet haben muss.«
Sabine nickte. Das war eine schwere Zeit für sie gewesen, an die sie sich nicht gern erinnerte. Offensichtlich lag Diana die Sache schon seit Langem auf dem Herzen, und anscheinend war das auch der Grund, warum sie zufällig in der Mensa aufgetaucht war. Aber warum ausgerechnet jetzt, nach einem halben Jahr?
Sabine sah zur Seite, um sicherzugehen, dass niemand ihr Gespräch belauschte. »Ich habe es für Sie und Sneijder getan.« Sie wusste, wie eng die beiden immer noch befreundet waren.
Diana presste die Lippen aufeinander. »Ohne Maartens Freispruch hätte es übel für ihn ausgesehen.«
Und was hat es gebracht? Dietrich Hess hatte ihn trotzdem wegen der schweren Vorwürfe vom Dienst suspendieren müssen. Sabine versuchte zu lächeln. »Ich habe nur die Wahrheit gesagt.«
An Diana Hess’ Blick sah Sabine, dass sie beide sich der Lüge bewusst waren. Im Zuge der Ermittlungen um die sogenannten Todesmärchen, wie die Presse Sneijders und ihren letzten gemeinsamen Fall getauft hatte, hatte Sneijder einen Mann erschossen. Normalerweise wäre er deswegen, selbst bei guter Führung, für mindestens zehn Jahre in den Knast gewandert. Und nichts anderes hätte Sneijder verdient. Doch an dem Tag ihrer Gerichtsaussage hatte Sabine erkannt, dass das Leben nicht schwarz und weiß war, sondern dass es eine breite Grauzone zwischen Legalität und Verbrechen gab. Sie hatte sich mehr als einmal auf die Zunge gebissen und schließlich schweren Herzens einen Meineid geleistet. Nur dieses eine Mal, hatte sie sich geschworen, und so die Tat vor sich selbst gerechtfertigt. Immerhin hatte ihr Sneijder mehr als einmal das Leben gerettet – nun waren sie quitt.
»Mein Mann hat mir versprochen, dass er versuchen wird, Maarten wieder offiziell in den Dienst des BKA zu holen«, sagte Diana.
Sabine sah auf. Das ist neu! »Wie stehen seine Chancen?«
Diana verzog das Gesicht. »Leider schlecht. Ich habe keine Ahnung, wann und ob das überhaupt jemals gelingen wird. Aber er versucht sein Möglichstes, solange er noch Präsident ist.«
»Hat er vor, in den Ruhestand zu gehen?«
»In sechs Monaten. Wir wollen an die Ostsee übersiedeln. Unser Sohn geht zwar noch zur Schule, aber er ist alt genug und wird hier bei seiner Tante in Wiesbaden bleiben.«
»Nette Gegend, ich kenne die Ostsee von einigen Fällen. Wissen Sie, wie es Sneijder geht?«, fragte Sabine.
»Er …« Diana räusperte sich. »Er unterrichtet hier in Wiesbaden als Gastdozent an der Universität für Wirtschaft und Recht. Ein Nebenfach: Spezielle Psychologie.«
Sabine musste schmunzeln. »Die armen Studenten.«
»Ja, die haben es nicht leicht bei ihm. Er hat sich keinen Deut geändert«, seufzte Diana. Ihr Blick fiel auf den Bildschirm des Notebooks. »Ist das der Fall Hagena?«
Sabine nickte. »Ihr Mann hat mich damit beauftragt.«
»Ja, ich weiß. Das war meine Idee, Sie auf den Fall anzusetzen. Eine schreckliche Sache.«
»Ihre Idee?«, wiederholte Sabine.
Diana nickte. »Ich sagte ihm, wenn jemand Licht in die Sache bringen kann, dann Sie.«
Sabine fühlte sich geschmeichelt, andererseits wurde sie stutzig. »Das bedeutet, Sie kannten Katharina Hagena?«
»Katharina ist … war eine bekannte Anwältin in Mainz und Wiesbaden.«
»Demnach kennen Sie vermutlich auch Anna Hagena?«
»Mein Gott, welche von Dietrichs Mitarbeiterinnen kenne ich nicht?« Diana lächelte. »Nachdem Maarten vom Dienst suspendiert wurde, hat sie die Ermittlungen an seinem letzten ungelösten Fall übernommen.«
Sabine hob instinktiv die Augenbrauen, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. »Aber vermutlich nicht sehr erfolgreich.«
»Stimmt, wer kommt schon an Maartens hohe Aufklärungsrate heran?« Diana Hess erhob sich. »Ich muss los, um meinen Mann zu einem Termin und später zu einem offiziellen Abendessen mit Innenminister und Oberstaatsanwalt zu begleiten und dabei die Atmosphäre aufzulockern.« Sie verdrehte die Augen. »Sie wissen ja, wie so etwas läuft. Übrigens …« Sie senkte die Stimme. »Mein Angebot gilt immer noch. Maartens Freunde sind meine Freunde, und wenn Sie meine Hilfe brauchen, können Sie mich jederzeit anrufen.«
»Ich weiß, danke.« Sabine sah Diana Hess nach, wie sie durch den Seitenausgang der Mensa verschwand.
Anna Hagena hat also Sneijders letzten ungelösten Fall übernommen – und nun war ihre Schwester unter mysteriösen Umständen gestorben.
5. KAPITEL
Tina Martinelli kannte Sneijders Haus nur aus Erzählungen. Angeblich war es ein altes Sommerhaus am Stadtrand von Wiesbaden, das direkt am Wald lag. Zumindest hatte Sabine Nemez es ihr mal so beschrieben.
Am Wald gelegen war jedoch die Untertreibung des Jahres. Sneijders Haus befand sich am Ende von einer Art Wanderweg, kaum mit dem Auto befahrbar. Angeblich besaß Sneijder ja nicht einmal einen Führerschein. Darum hatten ihn die Kollegen früher immer mit dem Dienstwagen von zu Hause abholen müssen. Früher. Mittlerweile waren auch diese Zeiten vorbei. Womit Sneijder seit einem Dreivierteljahr seine Brötchen verdiente, war Tina egal. Sie wollte nur seine Aussage – denn diesmal war er der Befragte.
Tina parkte ihren Wagen neben einem Bach vor einer Holzbrücke und ging den Rest des Forstweges zu Fuß. Auf einer Lichtung lag vor dem Hintergrund bewaldeter Hügel eine alte, stillgelegte Mühle mit rotem Schindeldach, Giebelfenstern, Holzläden und einem Schornstein mit Wetterhahn. Sneijders Haus wurde freundlich von der Mittagssonne beschienen. Saftig grüner Efeu rankte sich an einem Holzspalier die Wand empor, daneben schwirrten Bienen über die Wiese.
Als Tina näher kam, sah sie, dass der Bach, an dem sie zuvor entlanggefahren war, durch eine bogenförmige Öffnung im Fundament des Gebäudes verschwand. Vor dem Grundstück entdeckte sie ein riesiges Holzfass, an dem ein Schild hing.
Maarten S. Sneijder– Besucher unerwünscht!
Das war klar!
Auf der Natursteinterrasse standen unter dem Dachvorsprung und einer tief hängenden Regenrinne ein Tisch und Korbstühle. Sneijder saß in einem davon im Schatten und las in einer großformatigen Zeitung. Zu seinen Füßen lag ein Basset auf einer Decke, der, als er Tina bemerkte, müde den Kopf hob und ein tiefes Wuff ausstieß. Danach vergrub er die Schnauze wieder in der Decke und schloss die Augen.
Als Sneijder kurz von der Zeitung aufsah und Tina erkannte, faltete er das Blatt zusammen und legte es auf den Korbtisch neben sich. Tina sah den Lauf einer Pistole zwischen den Seiten. Der Form nach zu schließen eine Glock. Sneijders ehemalige Dienstwaffe?
»Wen haben Sie erwartet?«, fragte sie. »Einen Auftragskiller?«
»Kann man nie wissen«, knurrte Sneijder. »Es verirrt sich nur selten ein Wagen in diese Gegend. Und Vincent ist nicht gerade der beste Wachhund.«
Tina griff in die Hosentasche und holte einen Hundekuchen hervor. Jahrelang hatte sie von Sneijders Hund gehört, nun sah sie ihn zum ersten Mal. Er hatte ein struppiges Fell und war für einen Basset ziemlich dünn. Tina kniete sich hin, streichelte Vincent und hielt ihm das Leckerli vors Maul. Es war nie verkehrt, Sneijder milde zu stimmen, vor allem wenn man etwas von ihm brauchte. Und seine Zuneigung zu diesem Hund war bekannt.
Der Basset schnappte nach dem Hundekuchen und verschlang ihn in einem Stück. Grummelnd ließ er sich wieder auf der Decke nieder.
»Was wollen Sie?«, fragte Sneijder unbeeindruckt.
»Irgendwie hatte ich erwartet, Sie mal in legerer Kleidung vorzufinden, in Jeans und Sweatshirt, aber …« Sie betrachtete Sneijder irritiert. Er trug wie all die Jahre zuvor einen maßgeschneiderten Anzug und ein weißes Hemd. Tina hatte ihn noch nie anders gesehen. Der oberste Knopf des Hemdes war zwar geöffnet und das Sakko hing über der Stuhllehne, doch Sneijder sah immer noch sehr offiziell aus.
»Lassen wir den Smalltalk. Was wollen Sie?«, wiederholte er.
»Darf ich mich setzen?«
»Nein, sonst stören Sie mich noch länger.« Sneijder erhob sich. Aber nicht, um Tina einen Stuhl zum Tisch zu schieben, sondern um nach der Hundebürste zu greifen. »Komm her, mein Junge.« Er klopfte auf einen freien Korbstuhl, woraufhin Vincent kurz murrte, sich erhob und auf den Stuhl sprang.
»Ich habe gehört, der Hund ist Ihnen zugelaufen.«
»Ist er. Zum dritten und letzten Mal, Martinelli, was wollen Sie?« Sneijder begann mit seinen langen, dünnen Armen den Hund zu bürsten, was der sich mit einem kehligen Glucksen gefallen ließ.
Sneijder war erst fünfzig, aber er hatte immer schon älter ausgesehen. Sein ehemaliger Job hatte ihn gezeichnet, und auch dieses Dreivierteljahr Suspendierung hatte es nicht besser gemacht. Alle anderen hätten sich erholt – er nicht. Die dünn rasierten Koteletten begannen beim Ohr und verliefen in einer schmalen Linie bis zum Kinn. Der Kontrast zu der Glatze und dem bleichen Gesicht, das so aussah, als hätte es seit Jahren keine Sonne mehr gesehen, wirkte wie aus einem Schwarz-Weiß-Film. Sneijder war ein einziger Fremdkörper in dieser Sommerlandschaft.
Tina zog sich einen freien Stuhl heran und setzte sich. »Was können Sie mir über Gerald Rohrbeck erzählen?«
»Hat er etwas angestellt?«