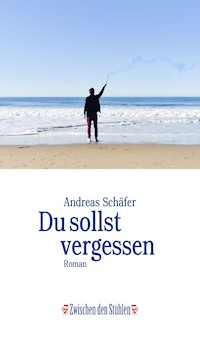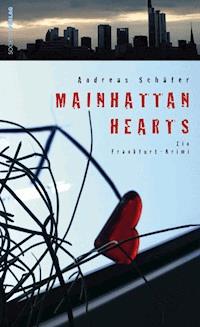Andreas Schäfer
Mainhattan Blues
Alle Rechte vorbehalten • Societäts Verlag
© 2003 Frankfurter Societäts Druckerei GmbH
Schutzumschlaggestaltung: Frederik Tropf, Frankfurt
Satz: Societäts-Verlag, Marco Stamm, Martina Schulze-Biermann
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-942921-97-8
Für Iris,
mein Sonnenschein an hellen,
mein Regenbogen an dunklen Tagen
Prolog
Feuchter Dezemberschnee fiel in dicken Flocken vom Frankfurter Nachthimmel. Nur die Lichtkegel der Straßenlaternen und die grellen Leuchtreklamen der Billigboutiquen und Rotlichtshops durchschnitten das Schneetreiben. Eine Autoschlange quälte sich zäh die Kaiserstraße entlang – Gaffer auf dem Nachhauseweg, die noch rasch einen Blick auf den Frankfurter Straßenstrich werfen wollten.
Sie kam aus der Eingangstür einer Absteige in der Moselstraße. Sofort fröstelte es sie, und sie zog sich ihren Kunstledermantel eng um die Schultern. Sie sah lustlos in das Schneetreiben. Wie unschuldige Seelen auf dem Weg ins Paradies, dachte sie plötzlich. Doch dass die weißen Flocken sofort mit dem dreckigen Schneematsch verschmolzen, fiel ihr nicht auf. Mit einer fahrigen Bewegung strich sie sich eine dunkle Strähne aus dem Gesicht, griff in ihre Handtasche und nestelte Zigaretten und ein Feuerzeug heraus. Der letzte Freier war in Ordnung gewesen. Ein blauer Schein für ein paar Minuten Sehnsucht. Noch so einer, und sie konnte diese Weihnachten mit viel Dope und wenig Stress feiern. Nur mit wem? Sie versuchte, durch die beschlagenen Autofenster ein Gesicht zu erkennen, als plötzlich eine Faust ihren Magen packte und das Verlangen nach einem Schuss Heroin sie wie ein Krampf krallte. Rasch riss sie eine Zigarette aus der Schachtel und steckte sie an. An einer Ecke blieb sie stehen und sah durch das Schneetreiben zur erleuchteten Halle des Hauptbahnhofes hinüber. Müde Männer in Wintermänteln und mit Aktentaschen liefen mit eisigen Mienen an ihr vorbei. Ein Zeitungsverkäufer hielt eine Ausgabe des Frankfurter Express hoch, ohne den Strom der Abendpendler auf ihrem Weg zum Bahnhof unterbrechen zu können. Als er sie erkannte, lächelte er sie an:
„Hallo Michaela, schöne Weihnachten, hier, für Dich!“ Sie nahm die Zeitung und bedankte sich bei dem Inder:
„Danke, schöne Weihnachten!“
Beim Weitergehen nahm sie einen tiefen Zug Nikotin und schlug dann die Zeitung auf. Überall Weihnachtsmänner, Politikermärchen und viel Werbung. Sie ging weiter und überlegte sich, ob sie vielleicht doch besser mit dem letzten Freier nach Bad Homburg gefahren wäre. Seine Einladung klang nett, aber warum sollte sie sich Gefühle leisten?
Der Anblick des hell erleuchteten Hauptbahnhofes faszinierte Frank Hoppe immer wieder. Auch das Schneetreiben konnte den Glanz des erleuchteten Portals nicht trüben. Sein Benz schien im Matsch der Kaiserstraße zu schwimmen. Er lenkte leicht dagegen, dann konzentrierte er sich wieder auf die Gestalten am Straßenrand. Aus dem Autoradio erklang „Jingle Bells“ und er musste kalt lächeln, als er einen Weihnachtsmann sah, der vor dem Eingang der Kaufhalle Werbegeschenke an Kinder verteilte. Hoppe wäre zu gern ausgestiegen und hätte die Rolle des Weihnachtsmannes übernommen. Auch nur ein einziges Lächeln aus den unschuldigen Augen dieser Wesen hätte ihm eine enorme Kraft gegeben. Seine Lederhandschuhe umfassten fester den Schalthebel des Sechszylinders, und er schaltete einen Gang herunter, als er die Einmündung zur Moselstraße erreicht hatte. Die Ampel sprang auf Rot und er brachte den Mercedes direkt vor der Ampel zum Stehen. Als sie vor ihm die Straße überquerte und ihn durch die Scheibe anlächelte, wusste er, dass sie heute die Auserwählte war. Auf dem Bürgersteig blieb sie stehen, steckte eine Zeitung in ihre Manteltasche und warf ihre Zigarettenkippe in den Rinnstein. Dann taxierte sie mit wenigen Blicken ihn und sein Auto. Mercedes Benz, solide Erscheinung, sagten ihre Augen. Er fuhr rechts ran und winkte ihr. Sie kam zu ihm, strich sich ihre feuchten, dunklen Strähnen zurück und lächelte ihn an. Frank Hoppe lächelte kalt zurück.
Als sie die Beifahrertür des Benz öffnete und seinen scheuen Blick sah, wusste sie sofort, dass sie einen neuen Freier gefunden hatte. „Schöne Weihnachten, wohin geht’s heute Abend noch?“, fragte sie schelmisch lächelnd.
„Steig ein, es ist scheißkalt“, erwiderte er.
Ohne zu überlegen stieg sie ein. War es seine Stimme, der sie nicht widerstehen konnte? Oder der Krampf in ihrem Bauch, der sie nach vorne schob?
Sie schlug die Tür zu. Sofort fuhr er los und bog nach rechts in die Moselstraße ab. Sie drehte ihren Kopf zu ihm hin und lächelte ihn an. Es klappte immer. Die Freier umschwärmten sie wie die Motten das Licht, gingen ihr auf den Leim, ich bin der Star zwischen Elbe und Weserstraße, dachte sie. Ein blauer Schein war bestimmt wieder drin. Und dann war Weihnachten gerettet. Doch bevor sie etwas sagen konnte, nahm er drei Hunderter aus dem Ablagefach der Fahrertür, warf sie in den Fußraum unterhalb von ihr und sagte teilnahmslos: „Zieh Deinen Slip aus.“ Unser grauer Opel Ascona schob sich durch den Schneematsch auf der Kaiserstraße und hielt schließlich direkt hinter einem dunklen Benz an der Kreuzung zur Moselstraße. Ich lehnte mich auf dem Beifahrersitz zurück und nippte an meinem Pappbecher. Der schwarze Kaffee schmeckte zwar stark und bitter, hatte aber keine Chance gegen die Müdigkeit, die mir seit Stunden an den Augenlidern hing. Eine Langbeinige mit Ledermantel und hochhackigen Stiefeln stelzte über die Fußgängerampel durch den Schneematsch und lächelte den Benzfahrer an.
„Hey, die kann doch mal bei uns mitfahren ....“, fing Rainer, mein Partner, an.
„Nicht schon wieder ...“, brummte ich, nahm den letzten Schluck von dem bitteren Kaffee und träumte weiter von Heiligabend im letzten Jahr. Dann hob ich die schwere Lederjacke an, schob das Holster mit der Sig Sauer Pistole an der Hüfte nach hinten und versuchte, mit offenen Augen einzuschlafen. Als das nicht ging, zerknüllte ich den leeren Pappbecher, warf ihn auf die Rücksitzbank und sah aus dem Beifahrerfenster hinaus.
„Hey, die Alte steigt ein...“, nervte Rainer. Sein „Hey“ verfolgte mich manchmal schon im Schlaf. Als ich nach vorne sah, konnte ich noch einen Stiefel sehen, der auf der Beifahrerseite im Benz verschwand. Es war eine Szene, die ich schon tausend Mal beobachtet hatte, und ich ließ mich wieder in meinen Tagtraum zurück gleiten. Dort lächelte mich Angela an, es war Weihnachten, und Sandra saß mit großen Augen vor dem Weihnachtsbaum und packte ihre Geschenke aus. Ich fragte mich manchmal, ob mein Leben anders wäre, wenn ich letztes Jahr keinen Sonderdienst an Heiligabend geschoben hätte. Nun war es schon drei Monate her, seit Angela mit Sandra ausgezogen war. Insofern ging es mir nicht anders als vielen anderen Kollegen, die nach einigen Jahren wieder zwangsweise die Steuerklasse wechseln mussten.
„Check doch mal die Nummer...“, holte mich Rainer in die Realität zurück. Die Ampel zeigte mittlerweile grün und der Benz bog nach rechts in die Moselstraße ab. Ich nahm das Mikro aus der Halterung und gab das Kennzeichen des Wagens an die Einsatzzentrale durch, um den Fahrzeughalter überprüfen zu lassen. Rainer fuhr hinterher. Von der Taunusstraße bogen wir nach links in Richtung Friedensbrücke ab und fuhren am erleuchteten Hauptportal des Hauptbahnhofes vorbei. Einige Passanten hetzten bei Rot über die Fußgängerfurt am Bahnhofsvorplatz, und Rainer fuhr Slalom zwischen ihnen durch, um Anschluss an den Daimler zu halten. Seit Wochen lief unsere Fahndung, ohne jeden Erfolg. Der Frankfurter Express nannte ihn mittlerweile den „Main Ripper“ und brachte jeden Tag genüsslich ein paar neue Schlagzeilen über seine Mordserie. Kurz nach der Wende hatte es angefangen und obwohl seit einiger Zeit die Fahndung auf Hochtouren lief, gab es bislang keine einzige Spur. Zuletzt hatte er eine Prostituierte vom Straßenstrich umgebracht, und seitdem fuhren wir fast jeden Abend durch das Bahnhofsgebiet und an der Messe entlang, ohne große Hoffnung, wir könnten durch Laufarbeit auf den entscheidenden Hinweis stoßen.
„Der Halter ist negativ“, meldete sich die Einsatzzentrale, doch Rainer schüttelte den Kopf. „Das muss nichts besagen“, meinte er. Mir war es egal, wem er nachfuhr, solange er mich nicht allzu sehr bei meinen Träumen störte. Der Benz hatte die Friedensbrücke überquert und bog an der Kennedyallee nach rechts ab.
„Der fährt bestimmt mit der Nutte in den Stadtwald. Wollen wir dranbleiben?“, meldete sich Rainer wieder zu Wort. Offenbar hatte es ihm die Kleine angetan.
„Warum nicht, es ist doch Weihnachten, vielleicht können wir den Schutzengel spielen ...“, brummte ich. Hunderten von Autos waren wir so schon gefolgt, immer ohne jedes Ergebnis. Begonnen hatte es im Dezember 1989, als eine Sechzehnjährige am Niddaufer gefunden wurde. Erst sah es wie eine Beziehungstat aus, aber alle aus dem Umfeld hatten wasserdichte Alibis. Das nächste Opfer lag in einem Müllcontainer am Nordwestzentrum. Das war ein Jahr später. Erst bei der Dritten, einer Halbwüchsigen vom Straßenstrich Weserstraße, entdeckten wir die Gemeinsamkeiten. Alle Opfer waren weiblich, aus einfachen Verhältnissen. Und alle wiesen seine „Unterschrift“ auf, das individuelle Merkmal, das dieser Serienmörder an seinen Opfern hinterließ.
Der Mercedes fuhr inzwischen an der Tankstelle am Oberforsthaus vorbei, weiter in Richtung Autobahn. Mittlerweile hatte das Schneetreiben nachgelassen, nur einzelne Flöckchen fielen noch auf die Windschutzscheibe.
„Hey, meinst Du, der hat uns bemerkt?“, fragte Rainer. Sein Jagdinstinkt schien hellwach.
„Und wenn, ist mir das auch egal ...“, gab ich zurück.
„Hey, ich wäre heute Abend auch lieber daheim“, bellte Rainer zurück.
Ich holte tief Luft und lenkte ein: „Sorry, aber Du weißt doch selbst, wie oft wir schon ...“
„Nicht oft genug“, meinte Rainer und ließ den Abstand zum Benz etwas größer werden.
Wir hatten inzwischen das Waldstadion passiert und fuhren über die Autobahnbrücke in Richtung Zeppelinheim. Rainer ließ den Opel langsam weiterrollen, dachte wahrscheinlich an seine Freundin und hoffte bestimmt, dass er wenigstens Silvester zu Hause verbringen könnte. Mir war das in diesem Jahr egal.
Ihr Blick glich dem eines scheuen Rehs in Gefangenschaft, ihre Locken glänzten nass vom Schnee. Sie hatte die drei Hunderter aus dem Fußraum geangelt und offenbar angebissen. Professionell hatte sie sich ihren Slip über die Beine gezogen und auf das Armaturenbrett gelegt. Frank Hoppe sah angestrengt auf den Mittelstreifen.
„Wo geht’s denn hin, zu Dir nach Hause?“, fragte sie mit betont kühler Stimme.
Er antwortete nicht, sondern sah sie nur kurz von der Seite an. Dann schob er eine Kassette in den Rekorder an der Mittelkonsole und die Ballade „November Rain“ von Guns and Roses klang aus den Hecklautsprechern. Am Kreisel hinter der Autobahnbrücke fuhr er auf einen Parkplatz. Niemand war zu sehen. Er lächelte kalt. Ein Mensch und ein Auto konnten hier problemlos entsorgt werden. Keine Spuren, keine Zeugen, vielleicht würde es bis zum Frühjahr dauern, bis die ersten Spaziergänger hier etwas finden würden. Merry Christmas, dachte er und bremste. Dann brachte er den Mercedes in der Ecke eines verlassenen Parkplatzes zum Stehen. Sie sah ihn wieder an und versuchte, ihm seine Wünsche aus den Augen abzulesen. Als er ihr nun das erste Mal länger in die Augen sah, zuckten ihre Augen zusammen. Sein Gesicht war eine undurchdringliche Maske und er versuchte ein kühles Lächeln. Guns and Roses dröhnte in ihren Ohren und sie bereute instinktiv, dass sie zu ihm ins Auto gestiegen war. Cool bleiben, dachte sie und lächelte zurück, während sie gleichzeitig nach der CS Gasdose in ihrer linken Manteltasche griff.
„Lass das und verarsch mich nicht“, sagte er so beiläufig, wie als wenn er ihr eine Zigarette angeboten hätte. Sie sah nach vorne. Auf die Windschutzscheibe fielen ein paar Schneeflocken und sie erkannte in einem Anflug von Panik, dass er verrückt war. Sie bewegte sich nicht und beobachtete, wie die Schneeflocken schmolzen.
„Was kann ich für Dich tun?“, fragte sie mit halbwegs fester Stimme.
„Fang mal an zu beten.“ Seine Stimme schien von einer anderen Welt.
Sie zog die CS Dose, aber er packte sie sofort am linken Handgelenk. Dann schlug sie ihm mit der rechten Faust auf die Nasenwurzel und er ließ kurz ihr Handgelenk los. Sie drehte sich blitzschnell um, zog den Hebel der Beifahrertür. Sofort packte er sie von hinten an ihren Haaren. Sie trat gegen die Tür, die langsam aufschwang. Als sie sein kehliges Lachen an ihrem Ohr hörte, schrie sie lauthals auf. Dann sah sie das Messer.
Rainer bremste den Ascona auf der Zufahrt zu dem Parkplatz ab, löschte das Abblendlicht und machte den Motor aus. Der Benz stand etwa hundert Meter weiter am Ende eines verlassenen Parkplatzes, der immer wieder von Freiern für die schnelle Nummer benutzt wurde. Ich kurbelte das Fenster einen Spalt weit herunter, während Rainer ein Fernglas mit Restlichtverstärker vom Rücksitz nahm. Das Schneetreiben war mittlerweile fast endgültig vorbei. Wieder die übliche Routine. Warten, bis es vorbei war, und wenn sie wieder auf der Kaiserstraße stand, würden wir hinfahren und sie nach besonderen Vorlieben des Freiers fragen. Im besten Fall würden wir eine dürftige Spur bekommen, einen Hinweis auf einen unscheinbaren Biedermann, dessen Fantasien sich am Rande des Erlaubten bewegten und den wir in Zukunft besser im Auge behalten sollten.
Ein heller Schrei zerschnitt die Stille der winterlichen Nacht.
„Oh Gott!“, platzte es aus mir heraus, während Rainer geistesgegenwärtig das Fernglas auf die Rückbank warf, den Ascona startete und ohne Licht mit durchdrehenden Reifen anfuhr. Die Sekunden, bis wir das Ende des Parkplatzes erreicht hatten, erschienen mir wie Stunden. Rainer bremste den Opel im Schneematsch vor dem Benz ab und blockierte den Fluchtweg. Sofort sprang ich aus dem Wagen und ging mit der Hand an der Dienstwaffe auf die Fahrertür des Mercedes zu. Die künstliche Innenbeleuchtung machte die Szene noch unwirklicher. Das Mädchen lag zusammengekrümmt auf dem Beifahrersitz und starrte mit weit aufgerissenen Augen ins Nichts. Ihr Freier drehte sich ruckartig zu mir um. Sein Gesicht erstarrte für eine Sekunde, dann umspielte ein kühles Lächeln seine schmalen Lippen. Ich hielt ihm mit meiner Linken die Kripomarke hin, die Rechte weiter an der Pistole: „Polizei! Keine Bewegung, noch nicht einmal daran denken!“
Er grinste weiter und stieß die Fahrertür auf. „Die Kleine verspricht mir erst den Himmel auf Erden, dann macht sie so ein Palaver bei mir im Auto.“
Seine Stimme klang so sachlich, als würde er einen Börsenbericht vorlesen. Es war eine Stimme, die mich beunruhigte. Mein Körper gab einen neuen Schub Adrenalin frei.
Langsam schob er das linke Bein aus der Fahrertür und setzte es auf den Boden. Er grinste weiter und zog das rechte Bein nach. „Sehen Sie mal, was sie für eine Sauerei in meinem Wagen angerichtet hat!“
Für einen kurzen Moment sah ich weg von ihm in den Wagen. Im selben Augenblick hörte ich sein kehliges Lachen. Er schnellte auf mich zu, geduckt, ich erkannte ein Messer in seiner Hand. Ich stand knapp zwei Meter von ihm entfernt und hatte keine Sekunde, um mich zu entscheiden. Die Sig war unerreichbar und meine Kripomarke half mir wenig. Er bewegte sich wie ein Tänzer, aber mit einer tödlichen Eleganz. Er hatte ein jungenhaftes Konfirmandengesicht, dem der kalte Blick und die unwirklich verzogenen Mundwinkel einen verschlagenen Eindruck gaben. Meine Sinne liefen auf Hochtouren. Ich sah seinen dunklen Mantel, den korrekten, kurzen, dunklen Pagenschnitt, den weißen Hemdkragen, über den sich eine kleine Perlenschnur von roten Spritzern in Richtung seiner dunklen Krawatte zog. Und ich sah seine Rechte vorschnellen, fast als wolle er mich umarmen mit der stählernen Klinge, die aus seinem schwarzen Lederhandschuh blinkte. Ich bog meinen Oberkörper nach hinten rechts ab und meine rechte Hand packte sein Handgelenk. Ich machte einen Ausfallschritt nach hinten, knickte seine Messerhand ab und brach dann das Handgelenk mit einem Kipphandhebel. Er knallte kopfüber in den Schneematsch. Als ich auf ihm kniete und ihm Handfesseln auf dem Rücken verpasst hatte, sah ich Rainer vor der Motorhaube des Benz stehen. Er hatte seine Dienstwaffe gezogen.
„Alles klar?“, keuchte er.
„Okay, ich hab ihn“, keuchte ich zurück.
Rainer steckte seine Dienstwaffe weg, ging zur Beifahrertür des Benz, dann sah ich ihn nicht mehr.
„Sie lebt noch, ich hole einen Notarztwagen“, kam es erleichtert. Er rannte zum Ascona und ich blieb auf dem Messerstecher knien. Der Typ drehte seinen Kopf und ich sah in sein mit Schneematsch verschmiertes Gesicht. Er lachte kühl und zischte dann: „Ihr hättet mich besser umgelegt.“
Der Prozess war erst ein Jahr später, im größten Saal des Landgerichts Frankfurt am Main. Michaela, die junge Frau vom Straßenstrich, hatte zwar noch Wochen auf der Intensivstation gelegen, aber wenigstens überlebt. Rainer und ich hatten sie einmal im Krankenhaus besucht. Während der Verhandlung sagte sie als Zeugin aus und der Anwalt von Hoppe versuchte, sie mit ständigem Nachfragen zu ihrer Person unglaubwürdig zu machen. Nach sechs Wochen Verhandlung, die immer wieder durch Beweisanträge der Verteidigung in die Länge gezogen wurde, betraten die Richter und Schöffen zur Urteilsbegründung den Saal. Wir erhoben uns. Rainer und ich saßen auf der Tribüne oberhalb des Saales, wo sich auch die Pressevertreter drängten. Die junge, engagierte Staatsanwältin und ihr erfahrener Kollege blickten ernst zur Bank der Verteidigung. Frank Hoppe stand auf und mit ihm erhoben sich sein Anwalt und die beiden Justizvollzugsbeamten, die direkt hinter ihnen saßen. Für uns war die Sache klar. Er hatte keinen einzigen Mord gestanden, aber in seinem Keller hatten wir seine „Trophäen“ gefunden: Aufnahmen von den ermordeten Frauen, selbstgedreht, mit einer kleinen Videokamera. Die Staatsanwälte hatte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert, die Verteidigung hatte drei Gegengutachten vorgelegt und wegen mangelnder Schuldfähigkeit eine Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Therapie statt Strafe. Der vorsitzende Richter wartete, bis sich die letzten Prozessbeteiligten und Zuschauer erhoben hatten und begann dann mit der Urteilsverkündung: „Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil ...“
Wir hatten es schon geahnt. Nicht schuldfähig wegen schwerer seelischer Störungen. Unterbringung im Maßregelvollzug. Therapie mit Aussicht auf Freigang. Ich war fassungslos. Nach ein paar Jahren guter Führung und dem Gutachten eines Psychotherapeuten würde man ihn wieder herauslassen. Rainer und ich sahen uns an und erhoben uns, um uns den Rest der Urteilsbegründung zu ersparen. Am Ausgang der Tribüne sah ich zurück zu Frank Hoppe. Er blickte zu mir hoch und grinste. Langsam, aber überdeutlich formten seine Lippen die Worte:
„Ihr hättet mich besser umgelegt.“
Die ersten Sonnenstrahlen krochen irgendwo hinter Offenbach über den Horizont und tauchten den Main in mattes Licht. Giovanni Mancuso pfiff Sergio, seinem Golden Retriever, zu und ging dann weiter in Richtung Flößerbrücke. Die Frühsonne im Rücken und eine Ballade von Eros Ramazotti auf den Lippen genoss er seinen Spaziergang am Sachsenhäuser Mainufer. Auf der anderen Mainseite schossen Appartementhäuser wie Pilze aus dem Boden. Er sah zur Baustelle der neuen Europäischen Zentralbank, die an der Großmarkthalle gebaut werden sollte. Frankfurt ist Boomtown, dachte er. Auch auf dieser Seite des Sachsenhäuser Ufers war auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes ein neues Wohngebiet entstanden, und links von der Flößerbrücke fiel Mancuso das Main Plaza mit seiner extravaganten Architektur ins Auge. Er hatte schon einmal ein ähnliches Gebäude in New York gesehen, und der rote Turm erschien ihm mit seiner abgestuften Fassade in den oberen Stockwerken wie eine abgeschnittene Keksdose. Vielleicht würde er sich auch einmal ein Appartement dort ansehen, sein Geschäft lief gut. Giovanni Mancuso riss sich von dem Anblick los und drehte sich um, weil Sergio immer noch nicht beikam. Er pfiff noch einmal, doch statt zu kommen, fing sein Liebling an zu bellen. Der Hund tänzelte neben einem Gebüsch am Fahrweg und schien außer sich zu sein.
„Sergio!“, brüllte Mancuso noch einmal, dann ging er zurück zu der Stelle, an der Sergio stehen geblieben war. Der Hund war auf einmal still, blickte aus feuchten Augen zu ihm hoch, und dann sah Mancuso den leblosen Körper hinter dem Gebüsch. Sein Blick verharrte auf dem blutigen Körper mit den blonden Haaren und dann bekreuzigte er sich schnell. „Madonna mia!“, entfuhr es ihm.
Der frische Kaffeeduft zog durch meine Sachsenhäuser Penthousewohnung und ich kam in Shorts und T-Shirt aus dem Bad. Sandra hatte schon den Frühstückstisch gedeckt. Ich setzte mich an den Tisch und sie goss mir eine Tasse Kaffee ein.
„Mensch Paps, Du wirst auch immer grauer!“, lachte sie mich an.
„Danke für die Blumen“, brummte ich und versuchte zu lächeln. Sie grinste weiter wie ein Honigkuchenpferd und ich fand, dass sie ihrer Mutter immer ähnlicher wurde, obwohl wir erst vor ein paar Wochen ihren sechzehnten Geburtstag gefeiert hatten. Ich nahm einen Schluck von meinem Kaffee und biss in ein trockenes Brötchen. Ich sah sie von der Seite an. Sie schnitt sich ein Brötchen auf und tat so, als bemerke sie meinen Blick nicht. Dann legte sie das Messer neben den Teller, warf die braunen Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte, zurück und griff nach der Butter. Die kleinen Sommersprossen auf der Nasenspitze, die sie am liebsten wegradieren würde, erinnerten mich auch an Angela. Wenn meine Tochter mich so angrinste, dann waren auf einen Schlag die über zehn Jahre vergessen, seit mich Angela zusammen mit ihr verlassen hatte.
„Mensch, nimm das doch nicht gleich so ernst! Grau steht Dir gut“, flötete sie, stand auf und schlang einen Arm um meine Schultern.
„Ist schon okay, komm lass uns frühstücken“, meinte ich.
„Der Film war doch toll, oder?“ Sie war eine Meisterin darin, das Thema zu wechseln. Das hatte sie nicht von ihrer Mutter geerbt. Wir hatten uns am Vorabend einen Hollywoodstreifen mit einem dieser Supermodels angesehen, für das sie gerade schwärmte. Den Rest des Abends verbrachten wir bei Mario in einer kleinen Pizzeria in Griesheim, in der ich schon mit ihrer Mutter ganze Nächte verbracht hatte. Neun Jahre waren jetzt seit der Scheidung von Angela vergangen und alle zwei Wochen besuchte mich Sandra an einem Wochenende, das wir dann gemeinsam verbrachten. Diesmal musste sie den Termin um eine Woche verschieben und ich hatte Mordbereitschaft, weil ich keinen Kollegen fand, der mit mir tauschen wollte. Aber zum Glück war bis jetzt nichts passiert und ich freute mich auf diesen Samstag mit Sandra.
„Der Schluss war natürlich etwas kitschig, aber ...“, schwärmte sie weiter.
Mein Diensthandy zirpte in meiner Lederjacke an der Garderobe und ich wusste sofort, dass das Wochenende gelaufen war. Ich stand auf, ging zur Garderobe, angelte das Handy aus der Jackentasche und meldete mich:
„Thomas Bach, K 11.“
„Waldheim. Kriminaldauerdienst. Sorry, dass ich Dich stören muss. Wir haben eine Frauenleiche am Mainufer“, meldete sich der Kollege vom Dauerdienst, dem KDD, und gab mir dann die Details.
Auf dem Weg zum Einsatzort setzte ich Sandra am Südbahnhof ab.
„Sei nicht traurig, Dad, in zwei Wochen nehme ich Dich dafür mit in den Bayernstadl“, meinte sie zum Abschied und grinste schelmisch.
„Na ja, warum nicht“, meinte ich und dachte mir: Besser sie geht mit mir dahin als mit sonst wem. Sie drückte mir einen Kuss auf meine unrasierte Wange und warf die Beifahrertür zu. Vor der Treppe zur B-Ebene drehte sie sich noch einmal um und winkte mir zu.
Bis zum Mainufer brauchte ich nur fünf Minuten. Ich ließ den Opel neben einem Appartementblock stehen und ging die letzten Meter zu Fuß. Der blaue Himmel über der Mainmetropole zeigte sich von seiner schönsten Seite. Bei einem solchen Wetter stirbt keiner gerne, dachte ich.
Als ich das Mainufer erreichte, dauerte es nur wenige Sekunden, bis ich mir einen Überblick verschafft hatte. Der Einsatzort lag an der Uferpromenade des Tiefkais, auf einem Rasenstück direkt am Ufer zwischen einem Gebüsch und einer Straßenlaterne. Ein heller Omega und zwei Funkstreifenwagen standen auf dem Fahrweg, wenige Meter weiter. Zwei Beamte spannten das flatternde, rot-weiße Plastikband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ zwischen die Laterne und einen Abfalleimer. Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst, dem KDD, standen mit einem gut gekleideten Mann neben dem Omega. Ein Hund kuschelte sich an die Füße des Mannes, den ich von der Erscheinung her für einen Griechen oder Italiener hielt. Ich ging hin und stellte mich kurz vor: „Guten Morgen. Bach, K 11.“
Ich gab allen die Hand. Man musste kein Einstein sein, um zu ahnen, dass der Südländer ein Zeuge war, und der erste Eindruck ist nicht nur bei Zeugen oft schon entscheidend für eine wichtige Aussage. Die Kollegin kam nach kurzer Vorstellung gleich zur Sache: „Herr Mancuso hat vor einer Stunde beim Spazierengehen dort einen Leichnam gefunden und dann gleich die Polizei über Handy verständigt.“
Ich nickte ihr ermutigend zu und sie fuhr fort: „Die Funkstreife vom Achten war zuerst hier und sie haben sofort den Fahrweg gesperrt. Keine weiteren Zeugen. Den Leichnam hat bisher keiner berührt. Es sieht nach Fremdverschulden aus. Die Personalien von Herrn Mancuso habe ich notiert.“
Sie sah mir in die Augen und nickte. Sachlich, kurz, prägnant. Sie war Anfang Dreißig, hatte eine blonde Lockenmähne und wirkte mit ihren blauen, wachen Augen bedeutend professioneller als ihr Kollege, der mit den Händen in den Hosentaschen dabeistand und Löcher in die Luft guckte. Er war mindestens zwanzig Jahre älter als sie. Ich kannte ihn schon eine Weile und wusste, dass er sich schon vor zwanzig Jahren nicht überarbeitet hatte. Ich tat so als ob ich überlegen würde, bückte mich zu dem Hund, streichelte ihn kurz und sah dann zu Mancuso hoch.
„Gehen wir ein Stück?“, bat ich ihn. Er nickte und ich sah noch den Schrecken in seinen traurigen Augen. Wir gingen ein paar Meter und ich stellte ihm erst ein paar belanglose Fragen. Dann wurde ich ernst: „Es ist wirklich wichtig, Herr Mancuso. Überlegen Sie genau: Haben Sie die Leiche angefasst?“
Ich sah ihm direkt in die Augen und er sagte nur:
„Madonna mia, nein, das ist viel zu schrecklich. Nur Sergio hat sie mit seiner Schnauze angestoßen.“
Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte. Man konnte niemandem hinter seine Stirn sehen, aber im Laufe der Jahre bekommt man ein Gefühl dafür, ob die Leute lügen oder nicht. Ich verdächtigte ihn nicht, aber ich musste sicher sein, dass er die Leiche nicht angefasst hatte. Manchmal sagen das die Zeugen aus Scham nicht und dann finden sich DNA Spuren auf der Leichenbekleidung, die uns wochenlang in die Irre führen.
Ein Frachtschiff fuhr unter der Flößerbrücke den Main abwärts und ich sah zur Skyline hinüber. Auch wenn ich Frankfurt oft genug hässlich fand, ich hing an meiner Heimatstadt. Dann drehte ich mich um und gab Mancuso die Hand: „Danke für Ihre Hilfe. Wenn wir noch etwas wissen wollen, wenden wir uns an Sie. Falls Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an.“
Ich gab ihm meine Visitenkarte, kraulte Sergio hinter den Ohren und ging zurück zur Absperrung. Mittlerweile war der VW Bus der Spurensicherung eingetroffen. Sie zogen sich ihre weißen Papieroveralls an. Ich ließ mir auch einen geben. Er war mir etwas zu klein. Als ich gerade noch ein Paar Plastikhandschuhe überstreifen wollte, kam mein neuer Partner um die Ecke des VW Bus.
„Morgen Thommy!“, gähnte Stefan.
„Morgen Stefan“, erwiderte ich und fuhr fort: „Ich gehe ran, ist schon okay.“
„Kann ich sonst noch etwas tun?“, fragte er.
„Nein, Eddie ist schon da, dem Staatsanwalt habe ich auf die Mailbox gesprochen“, erwiderte ich.
Ich wusste, dass die Leichenschau nicht unbedingt seine Lieblingsbeschäftigung war. Stefan Bauer, einunddreißig Jahre alt, war seit einem halben Jahr mein Partner. Er war der Ersatz für Rainer, der sich für einen UN Einsatz im Kosovo gemeldet hatte. Vorher war Stefan beim K 13 für Sexualstraftaten zuständig. Er trug meistens teure Anzüge und wirkte auf den ersten Blick ziemlich arrogant, aber ich mochte ihn.
Stefan setzte seine Edelsonnenbrille ab und nahm ein Memocord aus seiner Sakkoinnentasche.
„Moin Thommy, ich mach noch mal ein paar Detailaufnahmen vom Kopf. Vermutlich tödliche Schnittverletzungen im Halsbereich“, raunte Eddie Steinmann, als ich zur Leiche kam.
Eddie, ein alter Hase vom Team der Spurensicherung, bückte sich mit einer Digitalkamera über den Kopf der zusammengekrümmten Gestalt. Nach zwanzig Jahren Tatortarbeit konnte ihm keiner etwas vormachen. Er wusste genau, welche Bilder entscheidend waren.
Sie trug einen schwarzen Lederbody und eine schwarze Ledermaske. Die langen blonden Haare waren teilweise mit geronnenem Blut verklebt. Die scharfkantigen Wundbegrenzungen im Halsbereich fielen mir zuerst auf. Solche Schnittverletzungen waren mit Sicherheit tödlich. Tod durch Verbluten innerhalb kürzester Zeit. Ich beugte mich herunter und schaute mir den Kopf genauer an. Die Maske kam eindeutig aus dem Sado-Maso-Bereich.
„Ich mach mal eine Detailaufnahme von der Abrinnspur hier“, meinte Eddie und filmte eine dünne Blutspur, die unter der Maske in Ohrhöhe hervortrat.
Plötzlich war die Erinnerung da. Ich wusste schlagartig, dass ihr das linke Ohrläppchen fehlte. Zehn Jahre war es her, doch ich hatte die Bilder sofort in meinem Bewusstsein. Mein Magen zog sich zusammen und Morgenkaffee und Milchbrötchen fuhren Achterbahn.
„Hol mir etwas zum Schneiden“, raunte ich Stefan zu, der sofort zum VW Bus lief und mit einem sterilisierten Skalpell zurückkam, das er aus einer Plastikhülle zog. Ich beugte mich über die Tote und fand sofort den Lederriemen im Genickbereich, an dem die Maske befestigt war. Eddie filmte weiter, während ich den Leichnam und die Abrinnspuren beschrieb. Dann durchtrennte ich den Riemen im Genick, um das Lederding abzunehmen. Die Kamera lief weiter. Ich zog die Maske vorsichtig zur Seite und sah das blutverschmierte, linke Ohr. Das Ohrläppchen fehlte.
„Das hatten wir doch schon einmal“, meinte Eddie Steinmann sofort und sah mich mit verkniffenen Augen an: „Thommy, Du weißt doch, der Irre mit den Videos. Dieser Main-Ripper.“
Ich nickte. Die Kleine am Niddaufer, die Frau in der Nordweststadt und die Halbwüchsige vom Straßenstrich. Und dann die junge Frau, die blutend in seinem Benz lag. Ich sah ihre Gesichter und die verstümmelten Ohren. Mein Mund wurde trocken und ich schluckte.
„Frank Hoppe“, meinte ich leise.
„Ja genau, der Irre, ist der schon wieder draußen?“ Eddie sah mich fragend an.
Ich musste wieder an den Prozess vor zehn Jahren denken, an seine feixende Miene und sein kühles Lächeln:
„Ihr hättet mich besser umgelegt!“
„Draußen ist er schon, nur liegt er seit zwei Jahren auf einem Friedhof in Nordhessen“, erwiderte ich. „Er ist damals in der Psychiatrie gestorben, noch vor seiner Entlassung“, klärte ich Eddie auf und fuhr fort: „Ich war bei der Beerdigung. Der Pfarrer hatte sich auf das Nötigste beschränkt und ich war froh, als es endlich vorbei war.“
Eddie beugte sich vor und betrachtete sich die Wundränder an der Ohrmuschel aus der Nähe.
„Oh Mann, meinst Du, da will ihm einer etwas nachmachen?“
Ich schüttelte den Kopf: „Keine Ahnung, Eddie. Aber an Zufälle glaube ich nicht.“
Dann dachte ich an das Buch, das ich über Nachahmungstäter gelesen hatte. Copycatkiller, so nannte man die Psychopathen in den USA, die die Arbeitsweise berühmter Serienkiller kopierten. Hatten wir es jetzt auch in Frankfurt mit dieser Art von Irrsinn zu tun?
„Thommy, wir kriegen Besuch“, meldete sich Stefan. Der Übertragungswagen eines Fernsehsenders rollte heran.
„Halt mir die vom Leib, dafür habe ich jetzt keinen Kopf“, raunte ich Stefan zu und fuhr fort: „Und lass die Absperrung ausdehnen. Hol auch ein Boot von der Wasserschutzpolizei, wir brauchen auch keine Gaffer auf dem Main.“
Er stand in der Gruppe der Presseleute. Zusammen mit ihnen wurde er von zwei Polizeibeamten hinter eine neue Absperrung gedrängt. Dann wurden sie darauf hingewiesen, dass es sich um einen Tatort handele – das hatten sich alle schon gedacht. Als er hinter der neuen Absperrung stand, sah er nur noch Männer in weißen Overalls, die sich um das Gebüsch drängten. Plötzlich schubste ihn ein junger Schnösel mit einem riesigen Fotoapparat und krächzte: „Ich will auch etwas sehen ...“
Doch er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er nahm seine Nikon mit dem Teleobjektiv hoch und schoss noch einige Aufnahmen von den Männern in den weißen Overalls, die an dem Gebüsch neben der Kaimauer standen. Zum Glück hatte er schon einige Profilaufnahmen machen können. Die Bilder würde seine kleine Sammlung hervorragend ergänzen.
Ich sah mich noch einmal um und vergewisserte mich, dass die erweiterte Absperrung eingehalten wurde. Der Leichnam lag in einem toten Winkel zwischen dem Gebüsch und der Kante der Kaimauer, so dass man den Fundort eigentlich nur aus der Luft einsehen konnte. Die Presse konnte nun nicht mehr sehen, was ich tat.
Bevor ich mit den üblichen Untersuchungen der Leichenschau anfing, musste ich mich vergewissern, was der Täter wusste. Frank Hoppe hatte allen Opfern das linke Ohrläppchen abgebissen. Das ging durch die Presse und war jedem bekannt. Bei solchen Taten werden aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht alle Details veröffentlicht. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, sie seien der Mörder, nur um ihre zehn Minuten Berühmtheit zu bekommen. Aber ihnen fehlt das Täterwissen, die Details, und nach einem ordentlichen Anschiss fallen sie regelmäßig um und gestehen, dass sie sich die Geschichte ausgedacht haben. Frank Hoppe hatte seinen Opfern nämlich nicht nur die Ohrläppchen abgebissen. Er hatte ihnen hinterher auch beide Brustwarzen abgetrennt. Ich schälte den Lederbody vom kalten Körper der jungen Frau. Mit einem Blick sah ich, dass auch bei dieser Toten beide fehlten. Mein Magen rebellierte weiter. Wir hatten es also mit einem Copycatkiller zu tun und dazu noch mit einem Insider, der mehr als die Öffentlichkeit wusste. Noch etwas war mir klar: Es würde nicht lange dauern, und wir würden vor der nächsten Leiche stehen.
Nachdem Eddie die Verletzungen mit der Kamera dokumentiert hatte, führte ich die weiteren Untersuchungen zur Leichenschau durch. Wolfgang, ein anderer Techniker, kam mit einer Folie und nahm Fingerabdrücke von dem Opfer: „Wir schicken sie sofort nach Wiesbaden und lassen sie über AFIS laufen“, meinte er.
Die Fingerabdrücke von unbekannten Opfern konnten mit den im Computer des Bundeskriminalamtes gespeicherten Fingerabdrücken von Straftätern verglichen werden. AFIS, das Automatische Fingerabdruck Identifizierungs-System, hatte mit der Installation beim BKA vor zehn Jahren zu einem Durchbruch in der Kriminalitätsbekämpfung geführt. Mit AFIS konnten Fingerabdrücke oder Fingerspuren von Tatorten elektronisch kategorisiert und mit gespeicherten Fingerabdrücken verglichen werden. Falls das Opfer schon einmal irgendwo in Deutschland erkennungsdienstlich behandelt worden war, dann hatten wir in wenigen Stunden ihre Identität.
Ich unterdrückte mühsam das Verlangen nach einer Zigarette. Vor ein paar Monaten hatte ich mit dem Rauchen aufgehört und noch hielt ich durch. Die Kollegin vom KDD kam zu mir und fragte, ob wir sie noch brauchten.
„Nehmt Euch noch zwei Kollegen mit und fangt damit an, Klinken zu putzen“, begann ich und zeigte mit einer Hand in Richtung der Appartementblocks: „Nachbarschaftsbefragungen, wem ist etwas aufgefallen, das Übliche.“
Sie nickte und ging zu ihrem älteren Kollegen, der etwas abseits stand und weiter so tat, als ginge ihn die Sache nichts an. Ich ging zum VW Bus und zog mir die Plastikhandschuhe aus. Ein Kollege im Einsatzanzug kam auf mich zu. Es war der Hundertschaftsführer der Direktion Sonderdienste, ein alter Freund und Kollege. Ich warf die Plastikhandschuhe in einen Müllbeutel im Bus und gab ihm die Hand.
„Hallo Thommy“, grüßte er kurz.
„Servus Gerhard“, grüßte ich zurück. Wir kannten uns von zahllosen Einsätzen in den Achtzigern, als wir häufig zusammen Dienst geschoben hatten. Ich klärte ihn über den Sachverhalt auf und bat ihn, seine Truppen zusammenzuziehen. Ihm unterstanden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die im Bahnhofsgebiet und in der Innenstadt die Rauschgiftkriminalität bekämpften.
„Ich möchte, dass Ihr die Umgebung außerhalb der Absperrung nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Weggeworfene Handschuhe, blutige Gegenstände und so weiter. Das Übliche. Wenn Ihr etwas findet, dann informiert die Spurensicherung, die Kollegen sind noch eine Weile hier.“
„Alles klar, ich setze das um. Meinen Bericht kriegst Du dann per Fax“, meinte Gerhard, nahm sein Funkgerät aus der Brusttasche und ging zu seinem Funkwagen. Ich zog die Plastiküberzüge von meinen Turnschuhen und schälte mich aus dem Papieroverall. Die Bilder von dem blutverkrusteten Ohr konnte ich nicht so einfach abstreifen.
Ich setzte mich auf den Beifahrersitz, um einen Moment lang nachzudenken. Was war passiert? Hatten wir damals etwas übersehen? War Hoppe vielleicht kein Einzeltäter, wie wir es immer vermutet hatten? Wer wusste noch von der Abtrennung der Brustwarzen, seiner zweiten individuellen „Unterschrift“?
Stefan kam auf mich zu und sah mich fragend an.
„Hier nicht“, raunte ich ihm zu und nickte dann in Richtung der Appartementblocks, wo der Opel stand. „Lass uns gehen.“
An der Absperrung hob ich das weiß-rote Plastikband hoch, wir gingen darunter durch und schon bedrängten uns die Fotografen und ein Kamerateam mit ihren Fragen.
„Kein Kommentar, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle!“, sagte ich ärgerlich und ging mit Stefan in Richtung der Appartementhäuser. Zum Glück drehten sie sich sofort wieder um und als ich zurücksah, wusste ich warum. Die Jungs von der Spurensicherung hoben den Leichnam in den schwarzen Plastiksack. Beim Weitergehen sah ich aus dem Augenwinkel das Blitzlichtgewitter. Als wir unseren Dienstwagen erreichten, kam eine junge Frau mit einem Fotografen auf uns zu: Ute Link vom Frankfurter Express. Wir kannten uns.
„Hauptkommissar Bach, nur eine Frage: Haben Sie die Tote schon einmal gesehen?“ Ich war perplex.
„Kein Kommentar, ich kann mich nur wiederholen.“ Woher wusste sie, dass es sich um ein weibliches Opfer handelte? Wahrscheinlich das lange blonde Haar, das eventuell mit einem Teleobjektiv zu erkennen war. Dann fiel mir auf, dass ich sie vorher nicht bei den anderen Pressevertretern gesehen hatte. Ich schloss den Vectra auf und Stefan und ich stiegen ein.