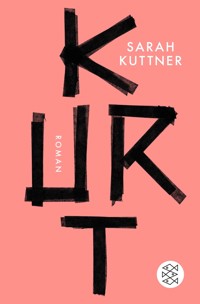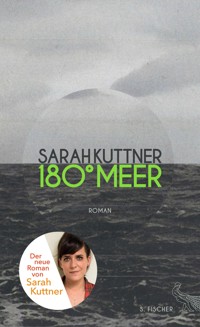19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sarah Kuttner schildert in ihrem neuen Roman »Mama & Sam« eine Ausnahmesituation, wie es sie gar nicht selten gibt. Eine Tochter steht in der Wohnung ihrer plötzlich verstorbenen Mutter. Die Mutter ist fort, ihre gesamten Ersparnisse auch. Was bleibt, sind Fragen: Warum ist die Wohnung so chaotisch, der Briefkasten so voll? Und wie ist es überhaupt möglich, seine eigene Mutter an einen Heiratsschwindler zu verlieren? Sarah Kuttner erzählt die Geschichte einer Frau, die Liebe suchte und auf einen Love Scammer traf. Die sich verliebte und die Augen verschloss. Die nichts zurückließ, außer einem schier endlosen Chat mit dem Betrüger. Vor allem aber ist es die Geschichte einer Tochter, die zurückbleibt, mit einer Leerstelle, wo einmal die Mutter war. Also liest die Tochter die Nachrichten, die nicht für sie bestimmt waren, liest Dinge über sich selbst, die sie nie wissen wollte. Und doch, ganz langsam, füllt sich die Leerstelle mit einer Nähe, wie sie beiden zu Lebzeiten nicht möglich war. Ein Roman über das Gefühl der Schuld, den Schmerz des Zurückbleibens, und die ungewollte Intimität eines Nachlasses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sarah Kuttner
Mama & Sam
Roman
Über dieses Buch
»Es wird ein gutes Jahr werden, denke ich und sehe meine Mutter zum letzten Mal.«
Eine Tochter steht in der Wohnung ihrer plötzlich verstorbenen Mutter. Die Mutter ist fort, ihre Ersparnisse auch. Was bleibt, sind Fragen: Warum ist die Wohnung so chaotisch, der Briefkasten so voll? Und wie ist es überhaupt möglich, seine Mutter an einen Heiratsschwindler zu verlieren?
Sarah Kuttner erzählt die Geschichte einer Frau, die Liebe suchte und auf einen Love Scammer traf. Die sich verliebte und die Augen verschloss. Die nichts zurückließ, außer einem schier endlosen Chat mit dem Betrüger. Vor allem aber ist es die Geschichte einer Tochter, die zurückbleibt, mit einer Leerstelle, wo einmal die Mutter war.
Ein Roman über das Gefühl der Schuld, den Schmerz des Zurückbleibens, und die ungewollte Intimität eines Nachlasses.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sarah Kuttners erster Roman »Mängelexemplar« erschien 2009 und stand wochenlang auf der Bestsellerliste. Damals wie heute schreibt sie über ernste, existenzielle Themen direkt, ehrlich und gleichzeitig schwerelos. Bekannt wurde Sarah Kuttner durch ihre Moderationen auf VIVA und MTV sowie diversen Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Seit 2017 moderiert sie gemeinsam mit Stefan Niggemeier den Podcast »Das kleine Fernsehballett«, außerdem spricht sie auf YouTube über ADHS und mentale Gesundheit. Sarah Kuttner lebt seit 2023 auf dem Land und hat inzwischen einen ziemlich grünen Daumen.
Sarah Kuttner im Netz: Instagram: @diekuttner I Twitter: @KuttnerSarah I Facebook: @SarahKuttner / YouTube: @sarah.kuttner
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Studio Godewind GmbH unter Verwendung von Google Imagen
Coverabbildung: Studio Godewind GmbH, Hamburg
ISBN 978-3-10-492321-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Zitat]
[Widmung]
[Motto]
Januar
Juni
Januar
Juni
Januar
Juni
Januar
Juli
Januar
Dezember
Januar
März
Februar
März
Dezember
Januar
März
Januar
März
Juli
März
Januar
April
Januar
April
Januar
April
Januar
April
Januar
Juni
April
Januar
April
Januar
Mai
Januar
Mai
Januar
Februar
Juni
Februar
Juni
Juli
Februar
Juli
August
Februar
September
Februar
September
März
Oktober
März
November
April
Mai
1.
2.
3.
4.
Nachwort
1. Ruhe bewahren – keine Konfrontation
2. Emotional ansprechbar bleiben – nicht rational argumentieren
3. Beweise sammeln – für später
4. Polizei und Opferhilfe informieren – auch ohne Einwilligung
5. Bei finanzieller Ausbeutung: rechtlich vorsorgen
6. Geduld und Bindung über Monate aufrechterhalten
Fazit
»Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich gut leiden kann?«
Für Briele & Eule
I wanna know what love is.
I want you to show me.
I wanna feel what love is.
I know you can show me.
(Foreigner)
Januar
Im Dielenboden der kleinen Altbauwohnung, etwa dort, wo das Schlafzimmer abgeht, befindet sich ein ausgesägtes Loch in der Größe eines Menschen. Nicht irgendeines Menschen, sondern meiner Mutter.
Die Tatortreinigerin erwähnte am Telefon, dass neben der klassischen Reinigung des Bodens auch ein Teil der Dielen herausgesägt werden müsse, da Körperflüssigkeiten in den Holzboden gesickert seien. Es werde extra ein Tischler kommen. Aber neue Dielen hat er wohl nicht mitgebracht, der Tischler.
Also starre ich in ein muttergroßes Loch, das mit staubigem Schutt gefüllt ist. Sind die Dielen original? Ich sehe mich um. Könnten sehr gut Originale sein, also hat dieser Schutt vielleicht seit über 100 Jahren kein Tageslicht erblickt. Und ich bin der erste Mensch, den er nach seinem Dornröschenschlaf sieht. Na ja, nach dem Tischler. Hallo, mein Freund! Erzähl mir Geschichten! Was hast du alles erlebt? Wer hat hier gelebt? Und wie hat meine Mutter ihre letzten Tage verbracht?
Meine Mutter hatte riesige blaue Augen, Grübchen und einen schön geschnittenen, weichen Mund, mit einer Unterlippe, für die man heute zum Hyaluron-Dealer des Vertrauens rennt. Sie hatte ein paar Sommersprossen, die sie, soweit ich weiß, nie gestört haben. Ich bekomme sie im Sommer auch. Mich stören sie auch nicht.
Mama war klein und lange Zeit ihres Lebens ein bisschen rund. Sie sammelte Figuren von Frauen, die ähnliche Körper hatten. Sie sind aus Jade und Speckstein und Holz, und sie sind alle ganz glatt und samtig. Ich überlege, ob ich eine von ihnen mitnehmen möchte, so dass sie bei mir weiterleben kann.
Dass meine Mutter ihren runden, weichen Körper selbst gar nicht liebte, erfuhr ich zum ersten Mal dadurch, dass sie meinen vor irgendetwas bewahren wollte. »Zwei Toast sind genug!«, sagte sie am Frühstückstisch, ich war elf oder zwölf Jahre alt. Als sie einmal hinter mir die Treppe zu unserer Wohnung hochlief, sagte sie: »Du kriegst langsam einen dicken Po!«, und lachte. Das Lachen sollte versöhnlich klingen. Als ich noch kein Gefühl für Mode hatte und die ersten Klamotten bei H&M anprobierte, sagte meine Mutter in der Umkleide zu mir: »Du trägst gar kein Unterhemd unter deinem Pullover? Davon stinkt man!«, und danach: »Wenn man sich schwarz anzieht, sieht man immer dünner aus!«
Bis heute fühle ich mich in schwarzer Kleidung am wohlsten, aber das ist vermutlich nicht relevant, denn meine Mutter ist tot, und das ist erst der Anfang.
Also stehe ich jetzt in ihrer verlassenen Wohnung. Es riecht muffig, aber nicht nach dem, was der Schlüsseldienst und die Polizei rochen, als sie vor fünf Wochen das Schloss aufgebrochen hatten. Hier riecht es nur nach es müsste mal gelüftet werden und nach meinem neuen Freund, dem Schutt. Ein bisschen nach Holzarbeiten und nicht nach: Hier ist jemand gestorben.
Ich habe das Gefühl, hier schon seit Stunden zu stehen. Ich sehe den riesigen Flurspiegel aus der Gründerzeit, vor dem ich schon als Kind stand, um zu prüfen, ob ich wirklich einen dicken Po bekomme und ob ich tatsächlich eine Kartoffelnase habe, wie meine Mutter erwähnt hatte. Ich sehe ihr Bett, in dem ich zwei Wochen lang schlafen durfte, als mich meine erste Depression niedergeschmettert hatte, und daneben den winzigen Balkon, auf dem Mama mich damals mit Toast fütterte, damit ich irgendwas zu mir nehme in der ganz schlimmen Zeit.
Die Spüle ist voller benutzter Kaffeebecher. Meine Mutter liebte Kaffee, und ein Therapeut hatte ihr mal empfohlen, für jeden neuen Kaffee auch eine neue, saubere Tasse zu nehmen, anstatt die bereits benutzte wieder zu befüllen. Als Zeichen der Wertschätzung für sich selbst. Auch wenn meine Mutter nie zu einer richtigen Therapie gegangen ist, und der Tassentherapeut sonst nur Quatsch von Chakren und Aura erzählt hatte und letztendlich von meiner Mutter verlassen wurde, weil sie sich sicher war, dass er sich in sie verliebt hatte, ist das eine Anekdote, die ich nie vergessen habe. Weil ich sie logisch fand. You go, girl!
Ich erblicke das Gemälde mit den Schiffen in der Küche. Als Kind fand ich, dass sie alle aussehen wie Sandalen mit Keilabsatz. Jedes Mal, wenn ich es als Erwachsene gesehen habe, dachte ich heimlich: Das will ich mal haben, wenn meine Mutter stirbt. Wegen genau dieser Kindheitserinnerung. Jetzt könnte ich es einfach von der Wand nehmen – aber ich fühle es nicht mehr. Das vorletzte Mal, als ich das Bild gesehen habe, saß meine Mutter direkt darunter und ließ meinen sehr emotionalen und vorwurfsvollen Monolog über sich ergehen. Sie wirkte erst überfordert, dann schien sie einfach rauszuzoomen. Was mich an diesem Tag nur noch wütender machte. »Wie oft muss ich mich denn noch entschuldigen?«, fragte sie irgendwann genervt, und ich war verletzt. Das letzte Mal sah ich die Keilabsatz-Schiffe am zweiten Weihnachtsfeiertag vor einem Jahr. Ich saß am Tisch, während meine Mutter Kaffee machte und nebenbei versuchte, die ganzen Töpfe und Bräter und Pfannen, die man für einen Gänsebraten nun mal braucht, wie Tetris-Blöcke in dem kleinen Raum zu stapeln. Ich hatte meine Ukulele dabei, denn ich wollte, dass alles ganz locker und fröhlich und liebevoll ist. Ich wollte meiner Mutter zeigen, dass ich versuchen möchte, sie zu mögen. Sie sie sein zu lassen. »Hast du ein Lieblingslied?«, fragte ich sie und ergänzte eifrig, dass ich einige Songs aus ihrer Zeit spielen kann. »Hm«, sagte sie und balancierte zwei leere Kaffeebecher auf den drei ineinandergestapelten Töpfen, die wiederum im Bräter standen, der bedenklich auf dem unebenen Schneidebrett kippelte. Was soll schon passieren? »Oh, kannst du I Wanna Know What Love Is? Das liebe ich!«, sagte sie. Und weil ich im Grunde jeden Song, den ich kenne, auf der Ukulele spielen kann, wenn ich nur die Akkorde habe, versuchte ich es. Es klang blöd und falsch, weil ich nicht sofort die richtige Tonlage fand und die Strophe des Songs etwas eintönig ist und deshalb noch schwerer zu singen. Beim Refrain wurde ich zu hoch und deswegen nervös, und dann hörte ich auf und sagte: »Sorry. Ich zieh mir den für dich rauf, und dann schick ich ihn dir als Video!« »Au ja!«, freute sie sich, grinste fast liebevoll und brühte den Kaffee auf. Ich habe ihr den Song nie geschickt. Weil nur zwei Monate später ein neuer Mann in Mamas Leben trat, der alles kaputt gemacht hat. Inklusive meiner Mutter. She really did want to know what love is. And he showed her.
Mein Mann rumpelt überraschend von hinten in mich rein. »Ich hab den Briefkasten geleert! Der war rappelvoll, und vielleicht können wir so rausfinden, wann sie das letzte Mal aktiv war!« Augenscheinlich habe ich es immer noch nicht sehr weit hinein geschafft in die Wohnung. Ich bin direkt am Eingang eingefroren für mein Gespräch mit dem Schutt und den Erinnerungen. Und es können auch keine Stunden gewesen sein, die ich hier das Leben meiner Mutter stichprobenhaft durch meinen Kopf habe ballern lassen, denn mein Mann war ja eben noch kurz hinter mir, bis er den Gedanken mit dem Briefkasten hatte.
»Uh! Ja, geile Idee!«, sage ich und bewundere ihn sehr. Unsere Gene! Also die von ihm und mir. Wir sehen seit Jahren zusammen True-Crime-Dokumentationen, haben unzählige Vernehmungen von Tätern und Opfern gesehen, scheuen auch nicht vor Tatortfotos zurück, und manchmal, wenn wir in der Pampa Brandenburgs mit dem Hund spazieren, fragen wir uns, wie es wohl wäre, eine Leiche zu finden. Näher als hier werden wir dieser morbiden Vorstellung vermutlich nicht kommen. Mein Mann hat meine tote Mutter gefunden, zumindest sagen wir das so. Es ist keine richtige Lüge, denn er hätte sie tatsächlich gefunden, wenn nicht zwei Wochen vorher schon eine Nachbarin die Polizei informiert hätte, weil in Mamas Wohnung über mindestens fünf Tage das Licht durchgehend an war. Und man sie irgendwann eben auch riechen konnte.
Obwohl es die größte Angst meiner Mutter war, alleine zu sterben und lange nicht gefunden zu werden, ist es genau so passiert. Was erst mal furchtbar tragisch wirkt, ist eigentlich nur ganz natürlich. Das Internet sagt, dass nur knapp die Hälfte aller Menschen im Krankenhaus sterben, ein Drittel stirbt zu Hause. Gleichzeitig ist es der Wunsch jedes zweiten Deutschen, dort zu sterben, wo er gelebt hat. Wobei dieser Wunsch sicher auf der romantischen Vorstellung basiert, dass kurz vor dem Tod die gesamte Familie tränenüberströmt am Bett des Hinscheidenden steht, ewige Liebe schwört und, während die kühlen Hände gehalten werden, die besten Momente des Sterbenden Revue passieren. Vielleicht wird noch eine spannende Sterbebettbeichte abgelegt oder ein Familiengeheimnis gelüftet. Das ist mit zu Hause sterben gemeint.
Was sie damit nicht meinen, ist, dass man, eher überraschend mit 68 Jahren, im eigenen Flur einfach um- und aufs Gesicht fällt und dann zwei Wochen lang nicht gefunden wird, während die Katze verstört durch die Wohnung tigert, aus dem Klo und den halbvollen Kaffeetassen trinkt und alles vollkotzt. Das wünscht sich niemand. Wie oft es dennoch so oder ähnlich geschieht, ist vielleicht traurig, aber nachvollziehbar. Wer plötzlich stirbt, tut dies, statistisch gesehen, oft an einem Ort, an dem er viel Zeit verbringt. Und wenn man keinen Partner, keine Mitbewohnerin oder superregelmäßige Sozialkontakte hat, dann wird man eben nicht umgehend gefunden. Oder überhaupt erst mal vermisst.
Meine Mutter hatte weder Partner noch Mitbewohner (vom Kater abgesehen, aber der kann halt kein Telefon bedienen) und vor allem keine superregelmäßigen Sozialkontakte. Stattdessen hatte meine Mutter Depressionen. Nur phasenweise, wie die meisten Menschen mit angeschlagener geistiger Gesundheit, aber besonders ab Spätherbst war sie gern allein. Meldete sich wochenlang nicht bei ihren Freundinnen und machte es sich in ihrem winzigen Zweiraum-Schloss gemütlich. Woher sollte man also wissen, dass die Funkstille dieses Mal eine andere war? Wäre ich nicht verheiratet, könnte ich auch wochenlang tot in meiner Wohnung liegen. Alle würden denken, dass ich gerade viel um die Ohren habe und meine Ruhe will. Deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, alleine zu sterben. Es kann jedem von uns passieren.
»Alles in Ordnung?«, fragt mein Mann, und seine grünen Augen sind ganz schön und groß und verunsichert. Er kann nicht einschätzen, wie es mir geht, ist schließlich eine sogenannte Ausnahmesituation das alles hier. Immerhin stehe ich festgewachsen in der frisch tatort-gereinigten Wohnung meiner toten Mutter und glotze in das Loch, auf dem sie tagelang gelegen hat. »Jaja, alles gut. Ich hab mich nur festgedacht«, sage ich und bewege mich endlich vorwärts. Wir gehen direkt nach rechts in die winzige Küche, am Fenster steht ein kleiner Tisch, da sitzen wir nun und atmen einmal durch. »Krass«, sage ich. »Ja, voll«, sagt mein Mann, der jetzt derjenige ist, der unter den Keilabsatz-Schiffen sitzt und beginnt, den 15 Zentimeter hohen Poststapel aus Mamas Briefkasten zu sortieren: Werbung nach rechts, Zeitschriften in die Mitte, Briefe nach links. Ich sehe, wie er bei den Prospekten kurz hängen bleibt, denn er liebt Prospekte, mein Mann. Montags liegt er oft neben mir auf dem Sofa und studiert sorgfältig alle Angebote, um sich dann für einen Supermarkt zu entscheiden, und von dort tollen, reduzierten Kram für mich mitzubringen. Niemand kann ihm diesen winzigen Dopaminstoß verwehren. Schließlich hat er meine tote Mutter gefunden. Und zwar an einem Freitag, dem 13. Das ist insofern erwähnenswert, als dass ich am selben Morgen noch dachte, wie komisch es ist, dass so viele Menschen solche Angst haben vor dem Tag. Mir war noch nie irgendetwas Aufregendes passiert an einem Freitag, dem 13. Ab Mittag sollte sich das ändern, denn das war der Moment, in dem wir das Gefühl hatten, dass etwas nicht stimmt. Also fuhr mein Mann nach Berlin, um dort meine Tante zu treffen, die als engste Vertraute meiner Mutter deren Wohnungsschlüssel hatte. Sie würden zusammen nachsehen, ob es meiner Mutter gut ginge
Meine Mutter und meine Tante waren ein besonderes Team. Sie sind als Kinder zusammen durch eine Menge Mist gegangen und waren nach dem Tod ihrer Mutter die einzig echte Familie füreinander. Ich nehme das niemandem übel, ich habe nie engen Kontakt mit meiner Familie gehabt, zum einen, weil wir als Familie so nicht zu ticken scheinen, und zum anderen, weil ich Gründe hatte. Meine Kindheit war auf verschiedenen Ebenen kompliziert, und sobald ich erwachsen war, wollte ich die Liebe außerhalb dieses Konstruktes suchen. Aber meine Mutter und meine Tante waren einander Familie. Sie fuhren früher sogar zusammen in den Urlaub, sahen sich recht regelmäßig und schrieben sich über WhatsApp. Wobei eher meine Mutter schrieb, und meine Tante kurz angebunden antwortete. Schreiben ist nicht so ihr Ding. Während meine Mutter nicht so gerne redete, und wenn doch, log sie oft, was uns später allen die Beine brechen sollte.
Meine Tante hätte also sehr wohl recht früh merken können, dass etwas nicht stimmte, während Mamas Freundinnen noch dachten, dass es wieder »diese Zeit des Jahres« sei. Warum sie und mein Mann dennoch erst einen ganzen Monat nach ihrem Tod und sechs Wochen, nachdem sie das letzte Mal gesehen wurde, in ihrem Hinterhof standen, ist zum einen der deutschen Bürokratie geschuldet, aber auch einem Mann.
Juni
Der Balkon meiner Tante ist riesig. Sie haben ihn Anfang des Jahres an den alten Plattenbau rangeklatscht wie ein weiteres Zimmer. So sitzen wir also in dem neuen Außenzimmer, es ist warm, und die Trompetenblume meiner Tante hat verfärbte Blätter. Weil ich im Garten unseres neuen Hauses selbst gerade steilgehe, weiß ich sehr genau, welche Blattfärbung was bedeutet, und klugscheißere das sofort raus. »Scheint ein Pilz zu sein«, sage ich und versuche, in meiner Pflanzen-App den genauen Feind zu identifizieren. Es ist schön, dieses sommerliche Geplänkel über Pflanzen (»Uh! Du hast den Wein komplett an der Decke lang verlegt? Nice!«) und die Ruhe, die dieses Jahr verspricht.
Anfang des Jahres hatte ich meinen ersten richtigen Burn-out. Er war beeindruckend, aber weil ich keine Kopfkirmes-Anfängerin bin und außerdem (oder deswegen) ein Kontrollfreak, hatte ich sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen und erblühe gerade. Ich passe besser auf mich auf, gehe zur Therapie und versuche, meine ganzen vielen Gefühle zu bändigen. Eigentlich will ich sie lieber weghaben, denn sie überfordern mich, rauben mir Energie, nerven andere und, na ja, stören eben. Aber so läuft es nicht, sagt meine Therapeutin. Die Gefühle sind nun mal da. Und sie haben ihre Berechtigung, denn ich hätte multiple Traumata aus einer wirklich beschissenen Kindheit, da hat man eben all diese Gefühle. Sagt sie. Sie haben mir jahrelang den Hintern gerettet, man kann sie jetzt nicht einfach nach Hause schicken. Also ist die Marschrichtung, diese Gefühle nur wahrzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Sich nicht von ihnen mitreißen zu lassen wie ein Stück Papier in der Toilette. Und, so abgedroschen er klingt: Dieser Rat hilft mir. Denn, wie gesagt: Ich mag Kontrolle, und ich mag Logik, und ich weiß, zumindest in der Theorie, dass Gefühle nur dann gruselig sind, wenn man sich in sie hineinlegt und sich ordentlich durchspülen lässt. Wenn man sich machtlos ergibt, geht man unter. Also muss man erst schwimmen lernen und dann möglichst oft üben, gar nicht erst reinzufallen in die Gefühle. Man muss üben, neben ihnen zu stehen, sie sich ruhig und freundlich anzusehen, nicht unbedingt willkommen zu heißen, aber ihre Existenz zu akzeptieren. Wenn man also nicht wegläuft, sondern die ganzen Emotionen wie im Sportunterricht vor sich aufreiht, sie sich vielleicht sogar in kurzen Hosen vorstellt, dann kann man erkennen, dass die ganzen großen Gefühle nur aufgeregte, schmächtige Jungs in Polyestershorts sind. Nur ein Haufen durcheinandergewürfelter Neurotransmitter und Hormone: ein Cocktail aus Adrenalin und Cortisol. Den wir selbst herstellen. Das hat mir geholfen: zu begreifen, dass ich auf Neurotransmitter und Hormone reinfalle.
Also lerne ich, meine Gefühle realistischer einzuschätzen. Ich übe an Mitmenschen, die mich verletzen. Da ich diese Menschen zum Verrecken nicht geändert bekomme, muss ich selbst ran. Und so spiele ich für meine Mutter Ukulele in der Küche, obwohl sie mir am selben Abend noch einen wirklich wichtigen Gefallen abschlagen wird, weil sie noch auf eine Lieferung Katzenfutter wartet. Und ich übe an meiner Mutter, wenn sie wieder die ganze Zeit nur auf ihr Handy schaut, als unsere winzige Familie sich an Ostern zum ersten Mal seit Weihnachten in meinem neuen Zuhause sieht. Ich lächle freundlich und sage mir, dass es doch nicht so schlimm ist, dass sie überhaupt nicht richtig zuhört und schon sehr früh wieder nach Hause will. Oder dass sie meinem Mann sagt, dass er einen Braten-Bauch bekäme, was ein enormer Verrat ist in meiner Welt, denn Braten sind unser Ding. Der Gatte macht gern welche, ich esse gern welche. Jahrelang habe ich ihn den Braten-Mann genannt. Meine Mutter weiß all das, und das Einzige, was sie, nahezu mit ihm flirtend, sagt, ist, dass er von all dem Braten einen Bauch kriegt. Das ärgert mich so sehr, dass ich heiße Ohren kriege. Aber eigentlich ist es nur Adrenalin, also lächle ich freundlich.
»War doch schön an Ostern!«, sage ich also jetzt zu meiner Tante, die aus verschlafenen Augen blinzelt. Seit dem Tod meiner Oma, mit der sie bis zum Schluss zusammengelebt hat, blüht sie irgendwie auf. Sie zündet die Kerze des Lebens an beiden Enden an und schläft so lange, wie sie will. Isst, was sie will und wann sie es will, und chillt auf ihrem neuen Riesenbalkon. »Ich bin ganz stolz, dass Mama mich gar nicht genervt hat, obwohl sie wieder die ganze Zeit am Handy war«, plappere ich fröhlich, auch, weil ich es so meine: Ich freue mich. Darüber, wie viel Macht ich über meine Gefühle haben kann, und weil ich irgendwie auch was Gutes tue, wenn ich meine Mutter wieder mehr in mein Leben einbeziehe. Wir haben ein paar Jahre lang so gut wie gar nicht miteinander gesprochen, was besonders für meine Tante schwer war, weil sie blöd zwischen den Stühlen rumstand und sich wüste Beschimpfungen von beiden Seiten anhören musste. »Ich bin die Schweiz«, hat sie immer gesagt, und ich dachte jedes Mal, wie kacke es ist, immer die Schweiz sein zu müssen. Die Schweiz hat doch auch Gefühle und will mal auf den Tisch hauen. Also hatte ich an Weihnachten die Tür wieder aufgemacht und beschlossen, meine Mutter etwas reinzulassen. In mein Leben. Ohne sie zu bewerten (zumindest weniger), ohne mit Argusaugen ihr Verhalten zu analysieren und im Anschluss meine Gefühlsskala auf Hinnehmbarkeit abzugleichen. Ich nahm sie als die etwas merkwürdige, unkonzentrierte, hibbelige und ein bisschen gemeine Frau, die sie nun mal war. Auch, weil ich seit meiner ADHS-Diagnose vor ein paar Jahren darauf schielte, woher ich das wohl haben könnte, und überraschenderweise ploppte meine Mutter ins Bild. Auch das hat geholfen, mich weniger von ihr verletzt zu fühlen.
»Also mich hat es ganz schön genervt!«, antwortet meine Tante und zieht an ihrer Zigarette. »Whooot?«, frage ich etwas zu laut, und für eine Sekunde bin ich neidisch, dass meine Tante sich einfach freiheraus ärgern darf, und ich the bigger person sein muss. Wie ein Junkie lechze ich nach ihrer Genervtheit, um nur einen Hauch davon selbst spüren zu dürfen. Ich bin ein Passivraucher ihrer Gefühle. »Ich weiß nicht«, versuche ich mich wieder zu justieren, »sie sah irgendwie glücklich dabei aus. Ist doch cool, wenn ihr jemand am Telefon so viel Spaß macht!«
Meine Tante zieht an ihrer Zigarette, und irgendwas verändert sich in ihren Augen. Ich hake nach: »Wie geht’s Mama denn überhaupt so? Hat sie ’nen Typen?« Ein Gedanke, der sich erst mitten im Satz ergeben hat. »Uh! War sie am Telefon mit einem Mann?!« Das wäre ja was! Meine Mutter hatte seit Jahren, eventuell Jahrzehnten, keinen Mann mehr. Zumindest keine Beziehung, und das ist es, was meine Mutter eigentlich immer nur wollte: einen Mann, der sie liebt. Der ihr Nähe, aber auch Raum gibt, der interessiert und interessant ist, der bei ihr, aber auch bei sich selbst ist. Die erste große Liebe erfüllte das bei ihr sein nicht, die zweite lange Beziehung danach scheiterte an der Hilflosigkeit des Mannes. Sie hatte ihn jahrelang aufgebaut, seine Unsicherheiten gedeckelt, ihn ermutigt und unterstützt. Als er dann endlich bei sich war, trennte er sich. Und gab ihr zum Abschied noch mit, dass sie mache, dass er sich alt fühle.
Eine Liebe, die endlich erfüllt, was all die Filme und Bücher ihr versprochen hatten, fehlte also. Meine Mutter flanierte von Kontaktbörsen über Partnerportale zu Tinder und klassischen Kontaktanzeigen. Es war nie jemand dabei. Über jeden hatte sie gespottet: Wessi, nicht links genug, doofe Kinder, kein Klamottengeschmack, Kulturbanause. Ich kenne meine Mutter gar nicht richtig mit Mann. Wie aufregend es jetzt also wäre, wenn einer da wäre!
Meine Tante blickt immer noch merkwürdig aus ihren scharfen blauen Augen und hält schön die Zigarette fest mit dem Mund, der eigentlich antworten sollte. »Ist es ein Mann?!«, dränge ich sie. »Ich darf nix sagen!«, presst sie sich aus schmalen Lippen heraus. Es ist irre, wie unterschiedlich sie sind, die beiden Schwestern. Vieles im Gesicht meiner Mutter ist weich und rund: die Augen, der Mund, die Grübchen und ihre eigene Kartoffelnase. Meine Tante hat definiertere Konturen. Sie sieht mit ihren eindringlichen Augen und dem oft dunkel geschminkten Mund tougher aus. Wacher, aber auch wachsamer. Meine Mutter ist eine Träumerin, ein gefühlvoller Hansdampf in allen Gassen. Meine Tante wirkt im Vergleich viel rationaler. Sie galt immer als die Schlaue der beiden Schwestern und ist auf eine tolle Art rau und lustig. Der macht man nichts vor. Wenn meine Mutter eine Träumerin ist, ist meine Tante eine Frau des Volkes. Sie hat jahrelang hart in der Gastro gearbeitet, sie weiß, was Menschen, die hart arbeiten, brauchen und was nicht. Bei einem neuen Arzt geht sie immer zuerst zu den Arzthelferinnen am Empfang und gibt ihnen einen Zehner für die Kaffeekasse und eine kleine, vergnügte und verständnisvolle Konversation, bevor sie sich geduldig und ohne zu meckern in das volle Wartezimmer setzt. Ich liebe das an ihr! Auch ich habe die beste Zeit, wenn ich mit DHL-Botinnen, Klempnern und Bäckereifachverkäuferinnen flirten kann. Meine Tante wirkt wie ein Stein in der Brandung. Sie ist direkt und meistens fair. Wenn irgendwann mal Apokalypse angesagt ist, dann will ich, dass meine Tante uns alle führt.
Jetzt aber darf sie nichts sagen. Diese vermaledeiten Geheimnisse immer. Die eine darf der anderen nichts davon erzählen, die andere wiederum will nicht, dass die Dritte von dieser Sache erfährt, und wenn man bitte nichts zu ihr sagen könnte, wäre es super. Mich stressen Geheimnisse sehr. Weil ich sie nicht gut für mich behalten kann, aber auch, weil sie meinem Grundbedürfnis nach emotionaler Sicherheit im Wege stehen.
Nun darf also meine Tante nichts vom neuen Mann meiner Mutter erzählen. Unmut steigt in mir auf, aber ich bleibe stark und supererwachsen und sage: »Musste auch gar nicht, sag mir nur, ob es fetzt! Ob es sie glücklich macht!«
Die folgende Pause ist bedeutend zu lang. In Kombination mit den nun vorsichtigen Augen meiner Tante schießt wieder ein Gefühl in mir hoch. Mein Mann nennt mich Kinderkommissarin, weil ich eine wirklich gute Ermittlerin wäre. Ich sehe alles, was nicht ins Raster passt. Ich lese Menschen wie Bücher und Situationen wie Bühnenprogramme. Und meine Neurotransmitter sagen dieses Mal, dass gleich die Kacke am Dampfen sein wird, und die Kinderkommissarin hat immer recht, denn da kommt sie, die Kacke.
Januar
Der Klodeckel meiner Mutter ist geöffnet. Das Wasser im Toilettenbecken ist zur Hälfte verdunstet, und vermutlich hatte Mamas Kater auch den einen oder anderen Schluck daraus getrunken. Ein schwarzer Rand zeigt an, wie hoch es mal war, das Wasser. Ich habe eine nervöse Blase, daher ließ ich meinen die Post sortierenden Mann in der Küche unter den Schiffen sitzen, um, na ja, zu schiffen. Aber jetzt kann ich plötzlich nicht, weil hier irgendwas nicht stimmt. Klar, die Toilette ist dreckig. Wobei ich das so klar gar nicht finde. Meine Mutter hatte keine schmutzige Toilette. Nur weil sie in ihrer Wohnung gestorben ist, muss nicht notgedrungen die Toilette siffig sein. In dem Becken müsste eigentlich klares Wasser gewesen (und verdunstet) sein. Weshalb ist es also so schmutzig? Warum sind dunkle Flecken auf dem Boden der Kloschüssel? Kann das der Kater gewesen sein? Er hat ja auch überall sonst in die Wohnung gekackt, in seiner Verzweiflung. Aber weshalb sollte er aufs Klo gehen, vor allem, wenn er daraus getrunken hat.
Verwirrender ist aber, dass ich das schmutzige Wasser überhaupt sehen kann, denn ich habe den Klodeckel nicht geöffnet. Ich öffne den Klodeckel bei uns zu Hause selten, weil ich ihn fast nie schließe. Er wird wegen meiner nervösen Blase eh demnächst wieder geöffnet, weshalb ihn also überhaupt runterklappen? Ein effizienter, wenn auch nicht notgedrungen hygienischer Gedanke. Aber meine Mutter fand einen offenen Klodeckel furchtbar! Unerträglich sogar, denn jedes Mal, wenn sie bei mir zu Hause war, kam sie meckernd aus dem Bad. Warum ich mir nicht endlich angewöhnen könne, den Deckel zu schließen. Sie war wirklich sauer, jedes Mal. Wenigstens ist meine Kloschüssel immer sauber, denke ich gehässig und schäme mich umgehend. Der Bann wird gebrochen, und ich setze mich endlich, um mich zu erleichtern. Dennoch: Warum ist der Klodeckel oben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei sich selbst nicht genauso streng war. Vielleicht musste es nur schnell gehen, und sie dachte: Na, mach ich später zu, und dann gab es einfach kein Später? Oder war hier noch jemand, außer meiner Mutter?
Als ich fertig bin, finde ich kein Toilettenpapier. Nirgendwo. Auch das ist merkwürdig, denn ich weiß, dass meine Mutter Diabetikerin war und dass die Krankheit Diarrhoe nach sich ziehen kann. Hat man unter diesen Umständen nicht immer Klopapier? Oder wurde das vom Reinigungsteam entsorgt? Man hatte mir gesagt, dass alles, was in unmittelbarer Nähe meiner Mutter gelegen hatte, entsorgt werden müsse, weil die sich verflüssigenden Fette in Dinge reinkriechen und sie dann, keine Ahnung, kontaminieren würden. Sie haben auch die Bettdecke meiner Mutter entsorgt, die Polizei hatte sie nach ihrem Abtransport auf das gelegt, was von ihr übrig war, vermutet die Tatortreinigerin. Das sei üblich, um die Angehörigen zu schonen.
Diese Bettdecke habe ich auf den Vorher-Fotos der Reinigungsfirma gesehen. Sie machen Bilder bei der Erstbegehung, um den »Schaden« zu dokumentieren und dann einen Kostenvoranschlag zu geben. Ich bat die Tatortreinigerin, mir die Bilder zu zeigen, weil ich wissen wollte, wie es in der Wohnung ausgesehen hatte, wie die Vorfinde-Situation war, alles, um einschätzen zu können, was zum Teufel passiert war. Die delikateren Fotos will sie unauffällig weiterswipen auf ihrem Handy, aber nicht mit mir! »Kann ich alle Fotos sehen? Ich bin hart im Nehmen!«, sage ich. »Bist du sicher?«, fragt sie, und ja, wir sind schon beim Du, weil die Umstände besonders sind, und ich ihren Schlag Menschen mag, und weil uns trotz all des Dramas das Interesse am Tod eint. Wie gesagt: Ich habe schon eine Menge gesehen, die getrockneten Körperflüssigkeiten meiner Mutter auf Linoleum können mir nicht so viel anhaben. Auf diesen Fotos sehe ich sie noch, die Bettdecke meiner Mutter. Und jetzt, da ich in der Wohnung bin, ist sie weg, weil eben kontaminiert. Ergibt erst mal Sinn. Dann könnte es auch Sinn ergeben, dass man das Toilettenpapier wegwirft. Obwohl es sich nicht in unmittelbarer Nähe meiner Mutter befunden hat. Die Firma arbeitet sehr sorgfältig, sie haben auch den Kühlschrank geleert, die Katzenklos mitgenommen und all die verstreuten Klamotten und Handtücher, die auf dem Boden rumlagen. Auch so ein Ding: Warum lagen da Handtücher? Dass man seine Hose auszieht, sobald man nach Hause kommt, und sie samt Unterwäsche als kleinen Turm, den ausgezogene Hosen eben ergeben, einfach liegen lässt, verstehe ich. Es überrascht mich ein bisschen, dass meine Mutter das getan hat, aber hinter verschlossenen Türen sind wir ja alle ein bisschen mehr Sau, als wir vorgeben zu sein. Aber die ganzen Handtücher? Auf dem Boden, in der Wanne …
»Deiner Mutti scheint es gegen Ende nicht sehr gut gegangen zu sein«, sagte die Tatortreinigerin, nachdem sie in der Wohnung gewesen war. Eben weil so viel rumlag und es so … nun, eklig war. Ich nehme allerdings an, dass der Kater dabei auch eine große Rolle gespielt hat. Auf den Fotos sieht man aufgerissene Lebensmittelpackungen am Boden, Feuchtfuttertüten, aber auch anderen Kram. Es ist überall ein bisschen klebrig und schmierig. Passiert das, wenn eine Katze so lange allein ist? Oder wenn eben ein Leichnam tagelang verwest? Oder gibt das Rückschluss darauf, wie die letzten Tage meiner Mutter waren, warum sie gestorben ist?
Vielleicht bin ich auch nur paranoid und sehe Dinge, die irrelevant sind, denn das fällt mir manchmal schwer: Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wer in einem Körper randvoll mit Gefühlen und unsortierten Eindrücken wohnt, kann das nicht so gut.
»Kannst du mir Taschentücher oder Küchenrolle oder so bringen?«, rufe ich in die Küche rüber. »Jupp«, murmelt es zurück, und dann höre ich ein bisschen Taschengewühle, ein leises »Ah«, und wenig später steht mein Mann vor mir und reicht mir Tempos. Bevor ich spüle, habe ich das Gefühl, einen Tatort zu verunreinigen, aber dieser Tatort ist ja nur für mich einer. Die Polizei hat schon abgeschlossen mit meiner Mutter. Ich hingegen nicht. So wie es aussieht, stehe ich erst ganz am Anfang, denn ich bin nicht hier, in der verlassenen Wohnung meiner Mutter, um zu trauern. Noch nicht.
Ich bin hier, weil ich mir dringend einen Überblick verschaffen muss. Die Weihnachtsfeiertage, ein seitens der Ämter verlegter Schlüssel und die erforderliche Tatortreinigung haben mich vier Wochen gekostet. Es bleiben nur noch zwei übrig, um mich mit dem Nachlass meiner Mutter auseinanderzusetzen, bevor ich die Entscheidung treffen muss, das Erbe anzunehmen. Oder eben nicht.
Juni
»Ich sag mal so«, sagt meine Tante auf meine Frage, ob dieser ominöse Mann im Handy meiner Mutter sie glücklich macht, »sie ist sehr glücklich, ich hingegen eher nicht.« Sie spricht in Rätseln, während hinter ihr die kranke Trompetenblume im Frühsommerlüftchen zittert, und ich werde ungeduldig, aber auch aufgeregter. Noch denke ich nicht an die ganz große Kacke, die dampfen könnte. Ich denke eher an: Meine Mutter schläft mit einem verheirateten Mann oder so. »Was bedeutet das? Muss man sich Sorgen machen?«, frage ich und setze mich ganz aufrecht in meinen Hochlehner. Ich kann sehen, dass sie mit sich kämpft, meine toughe Tante. »Ich hab geschworen, dir nichts davon zu erzählen«, presst sie aus den immer schmaler werdenden Lippen heraus. Huch. Das sitzt. Ich weiß, es ist gerade nicht wichtig, aber: Sie hat geschworen, explizit mir nichts zu erzählen? Ich versuche, mich davon jetzt nicht über den Jordan spülen zu lassen und konzentriere mich auf meine Tante. Ich kann sehen, dass sie es gleich sagen wird. Es bläht sich in ihr auf, und ich spüre, dass sie Angst vor dem Moment hat, aber sich auch auf die Erleichterung danach freut. »Du musst es mir nicht sagen, ich will dich in keine blöde Situation mit ihr bringen«, sage ich, meine es aber nicht. Ich will es jetzt wissen.
Stellt sich heraus, dass der neue Mann nicht irgendein Mann ist. Er ist Schauspieler. Ein recht berühmter. Mamas neuer Freund ist Sam Heughan. Er wurde in Schottland geboren, lebt aber in L.A. Er hat vier Millionen Follower auf Instagram, und er ist ein Jahr jünger als ich. Und jetzt ist er offensichtlich mein neuer Papa.
Was meine Tante erzählt, klingt hochgradig besorgniserregend: Meine Mutter ist wohl schon lange großer Fan der Fantasyserie Outlander, die von einer verheirateten Frau handelt, die irgendwie durch die Zeit reist und dabei Jamie, gespielt von Sam Heughan, trifft. Die Serie hat sieben Staffeln. Meine Mutter hat alle gesehen. Mehrfach. Und dann hat sie sich in Jamie verknallt und Sam Heughan auf irgendeinem der zahlreichen Fakeprofile auf Facebook angeschrieben. Und er hat geantwortet.
Meine Mutter konnte ihr Glück nicht fassen, und, boom, sitze ich jetzt hier auf dem Balkon und habe riesige Augen vor Fassungslosigkeit. »Unsere schönen Augen«, hat meine Mutter immer gesagt. Nie waren es meine. Sondern unsere. Denn ich habe sie mir nicht allein erarbeitet, diese schönen Augen, sie sind im Grunde das Eigentum meiner Mutter. Sie hat sie schließlich hergestellt, meine Augen. Als ich einmal einen Kurzhaarschnitt ausprobiert hatte, der leider nicht viel für mich tat, weil ich einen verdammten Haufen an Haaren habe und mein Kopf eher an eine Legofigur als an Natalie Imbruglia erinnerte, bat ich sie um ihre Meinung. Ich brauchte ein paar freundliche Worte und hoffte, dass meine Mutter meine Unsicherheit nachvollziehen könnte und etwas Freundliches sagen würde. In ihrer Welt tat sie das, glaube ich, auch. Sie sagte: »Na, unsere schönen Augen kann nichts entstellen.«
Nun sind unsere schönen Augen weit aufgerissen, und gleichzeitig spüre ich Hitze aus der Brust in den Kopf steigen. Das hier ist richtig schlimm. Meine Tante berichtet, dass sie meine Mutter umgehend angepfiffen hätte, wie sie so dumm sein könne, auf so was reinzufallen. Weiß doch jeder, dass das organisierte Verbrechen aus Ghana oder