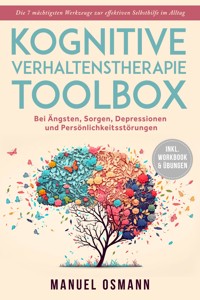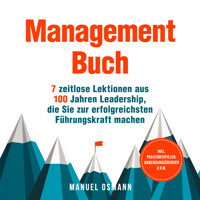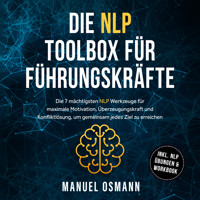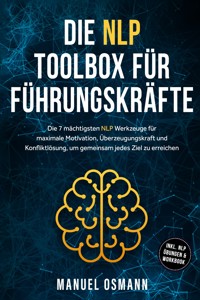Management Buch: 7 zeitlose Lektionen aus 100 Jahren Leadership, die Sie zur erfolgreichsten Führungskraft machen - inkl. Praxisbeispielen, Anwendungsübungen u.v.m. E-Book
Manuel Osmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Management: Mit klaren Visionen, langfristigen Strategien und souveräner Führungskompetenz Leadership authentisch umsetzen und Unternehmen langfristig auf die Erfolgsschiene bringen Sie möchten in Ihrem Betrieb aufsteigen und Führungsverantwortung übernehmen? Vielleicht haben Sie bereits eine Position übernommen, in der Managementfähigkeiten gefragt sind? Und nun möchten Sie sich fit für diese große Aufgabe machen und Ihren persönlichen Managementstil entwickeln? Dann wechseln Sie mit diesem Ratgeber beruflich ganz einfach auf die Überholspur! Tragfähige Visionen, konstruktives Konfliktmanagement, flexible Reaktionen und authentischer Leadership-Spirit: Wenn Sie Managementverantwortung übernehmen, werden höchste Anforderungen an Sie gestellt, und fehlt es hier an Erfahrung, machen sich leicht Unsicherheit und Führungsschwäche breit. Doch das muss nicht sein, denn die Schlüsselkompetenzen für gute Führungsarbeit lassen sich strategisch, gezielt und Schritt für Schritt erlernen, und dafür bietet dieses Buch Ihnen die perfekte Anleitung. Erfahren Sie zunächst kompakt und verständlich, auf welche Faktoren es bei erfolgreichem Management wirklich ankommt, um sich dann Step by Step in die Praxis einzuarbeiten. Mit konkreten Handlungsanleitungen für zahlreiche Situationen, Rollenspielen, Übungen, anschaulichen Praxisbeispielen und vielem mehr wachsen Sie in kürzester Zeit in Ihre neue Rolle hinein und entwickeln Sicherheit und Führungsstärke im Auftreten. Ganz ohne Erfahrung? Keine Sorge! Dieser Ratgeber holt Sie genau dort ab, wo Sie stehen, und bringt Sie von den Management-Basics bis hin zu fortgeschrittenen Profi-Strategien in Ihrem Tempo auf der Karriereleiter nach oben. Klarheit & Flexibilität: Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Unternehmen mit klaren Visionen, Agilität im Denken und flexibler Entscheidungsfähigkeit fit für die Zukunft machen und auch für herausfordernde Zeiten stabil aufstellen. Delegieren & Konfliktmanagement: Entdecken Sie, wie Sie aus gezielter Verantwortungsabgabe Vertrauen und Stärke erschaffen und Konflikte wirksam und langfristig in Chancen verwandeln. Nachhaltiger Erfolg: Erlernen Sie eine kluge Balance zwischen kurzfristigem Gewinn und langfristigem Erfolg, um Ihr Unternehmen für nachhaltige Innovationsfähigkeit und Gewinnmaximierung in Position zu bringen. Führung mit Sinn: Sinnstiftung, Authentizität, Empathie und Inspiration – schärfen Sie mit Übungen und Reflexionen Ihr Profil, um in der Führung mit Persönlichkeit zu überzeugen. Dieses Buch steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und begleitet Sie auf dem spannenden Weg, Ihre persönliche Führungsrolle zu entwickeln. Ob Sie in Kürze eine Beförderung erwarten, eine neue Position übernehmen werden oder bereits Verantwortung tragen – hier finden Sie Inspirationen und Tipps für jede Management-Herausforderung. Also worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" und beeindrucken Sie Ihr Umfeld schon bald mit Souveränität, klarer Kommunikation und Führung, die wirklich vorangeht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
Die Macht der Klarheit – Visionen definieren und kommunizieren
Warum eine klare Vision essenziell ist
Tools zur Definition und Kommunikation einer Vision
Wie man alle Ebenen der Organisation für die Vision gewinnt
Praxisübung Teamworkshop zur Visionsentwicklung
Die Kunst der Delegation – Vertrauen durch Verantwortung schaffen
Warum Manager oft zögern, zu delegieren
Warum Delegation nicht nur entlastet, sondern das Team stärkt
Die Prinzipien effektiver Delegation in der praktischen Anwendung
Wie Vertrauen schrittweise aufgebaut wird
Praxisübung: Selbstreflexion als Tool zur Stärkung der Delegationsfähigkeiten
Agilität im Denken – Umgang mit Unsicherheit und Wandel
Die Bedeutung von Agilität und iterativem Arbeiten
Wie man Wandel proaktiv managt
Praxisübung: Worst-Case-Szenario-Workshop – Strategien für den Ernstfall entwickeln
Konflikte als Chancen nutzen – Die Kraft effektiver Kommunikation
Wie man Konflikte erkennt und deeskaliert
Kommunikationsmodelle für Konfliktlösungen
Konflikte in Wachstumsmöglichkeiten umwandeln
Praxisübung – Konfliktsituation im Rollenspiel
Entscheidungsfreude – In der Komplexität den Weg finden
Die Psychologie hinter Entscheidungsprozessen
Entscheidungsmodelle für den Management-Alltag
Umgang mit Entscheidungsmüdigkeit und Perfektionismus
Praxisübung - Prioritäten setzen mit der Eisenhower-Matrix
Die Balance zwischen kurzfristigen Gewinnen und langfristiger Strategie
Die Herausforderung kurzfristigen Denkens
Methoden zur strategischen Planung
Investitionen in Mitarbeiter, Innovationen und Werte
Praxisübung: Erstellen einer Balanced Scorecard für Ihr Unternehmen oder Team
Führung mit Sinn – Menschen begeistern und authentisch führen
Die Bedeutung von Sinnstiftung
Prinzipien der authentischen Führung
Übung: Stärkung der Empathiefähigkeit
Menschen inspirieren, über Ziele hinauszuwachsen
Praxisübung: Workshop - Eine gemeinsame Mission entwickeln, die Sinn stiftet
Führung, die bleibt – Die Kunst des nachhaltigen Managements
Rückblick auf die sieben Lektionen
Führung in der Praxis: Der entscheidende Unterschied
Ein letzter Impuls: Was bleibt?
Die Macht der Klarheit – Visionen definieren und kommunizieren
Als Jonas Schneider zum neuen CEO eines traditionsreichen Maschinenbauunternehmens ernannt wird, ist er voller Tatendrang. Doch schnell bemerkt er, dass die Abteilungen des Unternehmens eher gegeneinander als miteinander arbeiten.
Die Entwicklungsabteilung setzt auf Innovationen, während der Vertrieb versucht, kurzfristig möglichst viele Bestellungen abzuschließen. Die Produktion wiederum priorisiert Effizienz und Kostenreduktion. Projekttermine werden verschoben, Konflikte zwischen Abteilungen häufen sich und die Mitarbeiter sind zunehmend frustriert.
In einer Vorstandssitzung fragt Jonas die Abteilungsleiter, welches übergeordnete Ziel das Unternehmen verfolgt. Schweigen. Dann beginnen die Führungskräfte zu reden – aber jeder hat eine andere Vorstellung. Jonas wird klar: Es fehlt eine gemeinsame Vision. Ohne eine klare Richtung kann es keine koordinierte Strategie und keinen nachhaltigen Erfolg geben. Er beschließt, eine Vision zu entwickeln, die alle Mitarbeitenden inspiriert und vereint.
Er startet mit einer Analyse und stellt dabei die folgenden Leitfragen auf: Welche Werte haben das Unternehmen in der Vergangenheit geprägt? Welche Erwartungen haben Kunden, Mitarbeiter und Investoren? Und vor allem: Welche Herausforderungen müssen in den nächsten zehn Jahren bewältigt werden?
Jonas führt Einzelgespräche, analysiert Daten und holt externe Berater hinzu. Schließlich entwickelt er eine Vision:
Wir werden der innovativste Anbieter fürnachhaltigen Maschinenbau in Europa.
Diese Vision wird in Workshops mit Mitarbeitern diskutiert und durch spezifische Leitlinien ergänzt. Die Einführung der neuen Vision dauert Monate und kennzeichnet sich durch aufwendige, aber sich lohnende Prozesse. Widerstände werden adressiert, Missverständnisse aufgeklärt. Doch allmählich spüren die Mitarbeitenden, dass sich die Zusammenarbeit verbessert. Entscheidungen werden schneller getroffen, weil sie an der Vision ausgerichtet sind. Die Unternehmenskultur wandelt sich – aus Einzelkämpfern wird ein Team mit einem gemeinsamen Ziel.
Warum eine klare Vision essenziell ist
Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch eine starke, einheitliche Vision aus. Nehmen wir Apple als Beispiel: Steve Jobs formulierte die Vision, „eine Delle ins Universum zu schlagen“ und schuf Produkte, die Technologie und Design auf einzigartige Weise vereinten. Tesla verfolgt die Vision einer nachhaltigen Zukunft mit Elektromobilität – eine Leitidee, die Mitarbeiter, Investoren und Kunden gleichermaßen begeistert. Doch was genau ist nun der Zweck einer solchen Vision?
Eine klare Vision schafft Orientierung, motiviert Teams und dient als Entscheidungshilfe in strategischen Fragen. Unternehmen ohne Vision hingegen verlieren sich oft in operativen Details oder kurzfristigem Profitdenken. Bevor eine Vision formuliert werden kann, ist es jedoch entscheidend, den "Purpose" des Unternehmens – also seinen Daseinszweck – zu definieren.
Kurz gesagt:
Der Purpose gibt Antwort auf die Frage: Warum gibt es uns? Die Vision beschreibt dann, wohin das Unternehmen in Zukunft will.
Während der Purpose langfristig Bestand hat, kann sich die Vision im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um auf veränderte Marktbedingungen und Unternehmensstrategien zu reagieren.
Ein deutsches Medizintechnik-Unternehmen hatte über Jahrzehnte seinen Fokus auf hochwertige Geräte für Krankenhäuser gelegt. Doch mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung stellte sich die Frage: Wollen wir nur Gerätehersteller sein, oder sollten wir eine größere Rolle in der digitalen Gesundheitsversorgung spielen? Nach intensiven Diskussionen entwickelte das Unternehmen eine neue Vision: „Wir ermöglichen ein gesünderes Leben durch intelligente Medizintechnik.“
Diese Vision führte dazu, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz, Telemedizin und Softwarelösungen erhöht wurden. Die Firma wandelte sich von einem reinen Hardware-Anbieter zu einem digitalen Gesundheitsdienstleister.
Eine klare Vision gibt nicht nur strategische Orientierung, sondern erfüllt auch eine fundamentale psychologische Funktion. Menschen suchen in ihrer Arbeit nach Sinn, nach einem übergeordneten Zweck, der über die bloße Erfüllung von Aufgaben hinausgeht. Hier setzt die Verbindung zwischen Purpose und Vision an. Während der Purpose eines Unternehmens dessen grundlegende Daseinsberechtigung beschreibt – die Frage nach dem „Warum existieren wir?“ –, zeichnet die Vision ein inspirierendes Zukunftsbild, das konkretisiert, wohin sich das Unternehmen entwickeln möchte. Diese Differenzierung ist entscheidend, da Purpose die langfristige Identität des Unternehmens bewahrt, während die Vision Veränderungen in Strategie und Marktausrichtung aufgreifen kann, um den Purpose bestmöglich zu erfüllen.
Ein klares Purpose-Statement gibt einem Unternehmen eine tiefere Bedeutung über wirtschaftliche Ziele hinaus. Es beantwortet die Frage nach dem Daseinszweck des Unternehmens und beschreibt dessen Beitrag zur Gesellschaft oder Umwelt.
Beispiele für Purpose-Statements führender Unternehmen:
Google: „Die Informationen der Welt organisieren und für alle zugänglich und nutzbar machen.“
Tesla: „Den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen.“
IKEA: „Einen besseren Alltag für die vielen Menschen schaffen.“
Die Vision hingegen zeichnet ein konkretes Bild der angestrebten Zukunft und dient als Orientierungsrahmen für Entscheidungen. Während der Purpose konstant bleibt, kann sich die Vision den veränderten Marktbedingungen anpassen.
Für das Beispiel des deutschen Medizintechnik-Unternehmens heißt das:
Das Unternehmen hatte über Jahrzehnte seinen Fokus auf hochwertige Geräte für Krankenhäuser gelegt. Sein Purpose bestand darin, mit technischer Präzision die Gesundheitsversorgung durch zuverlässige Medizingeräte zu verbessern. Doch mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung stellte sich die Frage: Wollen wir nur Gerätehersteller sein, oder sollten wir eine größere Rolle in der digitalen Gesundheitsversorgung spielen? Während der Purpose – also die grundlegende Daseinsberechtigung – weiterhin darin bestand, zur Gesundheit der Menschen beizutragen, musste die Vision neu definiert werden.
Nach intensiven Diskussionen entwickelte das Unternehmen eine neue Vision: „Wir ermöglichen ein gesünderes Leben durch intelligente Medizintechnik.“ Diese Vision lenkte den Blick auf eine neue strategische Richtung und führte dazu, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz, Telemedizin und Softwarelösungen erhöht wurden. Die Firma wandelte sich von einem reinen Hardware-Anbieter zu einem digitalen Gesundheitsdienstleister. Der Purpose blieb unverändert, aber die Vision entwickelte sich weiter, um das Unternehmen auf eine zukunftsweisende Strategie auszurichten.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Purpose und Vision zwar eng miteinander verbunden sind, jedoch unterschiedliche Funktionen erfüllen. Der Purpose bleibt als konstantes Leitbild bestehen und gibt dem Unternehmen seinen übergeordneten Sinn. Die Vision hingegen entwickelt sich weiter und passt sich veränderten Marktbedingungen sowie strategischen Prioritäten an. Während der Purpose langfristig Stabilität schafft, bietet die Vision eine klare Richtung für zukünftige Entwicklungen.
Daniel Pink beschreibt in Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, dass Menschen insbesondere durch Autonomie, Kompetenz und Sinnhaftigkeit angetrieben werden. Eine gut formulierte Vision stärkt daher vor allem das Bedürfnis nach Sinn, indem sie Mitarbeitenden vermittelt, wie ihre Arbeit zum großen Ganzen beiträgt. Dieses psychologische Bedürfnis steht in enger Verbindung zur Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan, die zeigt, dass intrinsische Motivation steigt, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit eine tiefere Bedeutung hat. Eine klare Vision kann Mitarbeitenden genau diese Orientierung geben, indem sie zeigt, welchen Beitrag ihre tägliche Arbeit zur Erfüllung des Purpose und zur Erreichung eines größeren Ziels leistet.
Exkurs: Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
Die Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Deci und Ryan bildet einen zentralen theoretischen Ansatz zur Erklärung intrinsischer Motivation. Sie postulieren, dass das Erleben von Motivation stark davon abhängt, inwieweit drei grundlegende psychologische Bedürfnisse befriedigt werden: Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit.
Autonomie beschreibt das Bedürfnis, selbstbestimmt zu handeln und Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, ihre Arbeit selbst steuern zu können, erleben sie ein höheres Maß an innerer Motivation. Kompetenz bezieht sich auf das Streben, sich in herausfordernden Aufgaben als fähig und erfolgreich zu fühlen. Wird dieses Bedürfnis erfüllt, fördert das Erleben von Erfolg und das positive Feedback das Selbstvertrauen und die Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen. Verbundenheit schließlich meint das Verlangen nach bedeutungsvollen zwischenmenschlichen Beziehungen, bei denen sich Einzelne als integrierter und geschätzter Teil eines größeren Ganzen fühlen.
Deci und Ryan argumentieren, dass diese drei Bedürfnisse universell sind und in allen Lebensbereichen – sei es im Beruf, in der Bildung oder im privaten Umfeld – erfüllt sein müssen, um eine nachhaltige intrinsische Motivation zu ermöglichen. Ein Arbeitsumfeld, das Autonomie fördert, ermutigt Mitarbeitende dazu, kreative Lösungen zu finden und eigeninitiativ zu handeln. Gleichzeitig stärkt die gezielte Förderung von Kompetenzen das Gefühl der Wirksamkeit, während eine Kultur der Verbundenheit dazu beiträgt, dass Mitarbeitende sich als essenzieller Teil eines Teams oder einer Organisation wahrnehmen.
Die Implikationen der Selbstbestimmungstheorie für moderne Führungskonzepte sind weitreichend: Führungskräfte sollten Bedingungen schaffen, die diese Grundbedürfnisse systematisch unterstützen. Dies kann beispielsweise durch partizipative Entscheidungsprozesse, gezielte Weiterbildungsangebote und den Aufbau eines unterstützenden Arbeitsklimas geschehen. Eine solche Herangehensweise fördert nicht nur die individuelle Motivation, sondern trägt auch maßgeblich zur langfristigen Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation bei.
Neben der Orientierung spielt die Vision eine entscheidende Rolle für die Motivation. Ohne ein klares Zukunftsbild besteht die Gefahr, dass Mitarbeitende sich nur auf kurzfristige operative Aufgaben konzentrieren, ohne den größeren Zusammenhang zu sehen.
Ein Beispiel:
Ein Technologieunternehmen befand sich in einer tiefen Krise: Sinkende Marktanteile, hohe Fluktuation und eine wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Belegschaft bedrohten die Zukunft des Unternehmens. Viele Mitarbeitende waren demotiviert, da sie das Gefühl hatten, dass kurzfristige Gewinnmaximierung über alles gestellt wurde und ihre Arbeit keinen höheren Zweck erfüllte.
Der neue CEO erkannte dieses Problem und führte eine inspirierende Vision ein: „Wir entwickeln Technologien, die Menschen das Leben erleichtern.“ Diese Aussage wurde nicht abstrakt stehen gelassen, sondern durch konkrete Beispiele unterfüttert: Die Entwicklung von Gesundheits-Apps, KI-gestützten Assistenzsystemen und nachhaltigen IT-Lösungen wurde in den Mittelpunkt gestellt. Plötzlich konnten Entwickler und Ingenieure den tieferen Sinn ihrer Arbeit erkennen. Sie arbeiteten nicht mehr nur an Softwarelösungen, sondern an Innovationen, die das Leben von Menschen verbessern. Dies führte nicht nur dazu, dass das Unternehmen Talente halten konnte, sondern es zog auch neue Fachkräfte an, die sich für sinnstiftende Arbeit begeisterten.
Damit eine strategische Neuausrichtung nicht nur auf dem Papier existiert, sondern aktiv von den Mitarbeitenden getragen wird, bedarf es gezielter Methoden zur emotionalen und kognitiven Verankerung. Hier setzt die Neurolinguistische Programmierung (NLP) an, die Führungskräften wirksame Ansätze bietet, um Purpose und Vision nachhaltig mit der Motivation der Mitarbeitenden zu verknüpfen. Dazu gehören Methoden wie Reframing, die Analyse von Wertestrukturen und die bewusste Verankerung von Zielen.
Methode Nr. 1: Reframing
Reframing ist eine bewährte Methode, um die Wahrnehmung von Situationen oder Konzepten bewusst zu verändern. Im Kontext von Purpose und Vision bedeutet Reframing, dass Führungskräfte nicht nur eine neue strategische Ausrichtung kommunizieren, sondern diese in eine für die Mitarbeitenden sinnvolle Perspektive setzen. Dies ermöglicht es, Widerstände abzubauen, Identifikation zu fördern und Motivation zu steigern. Ein Unternehmen kann zwar eine neue Vision formulieren, doch wenn diese nicht in den Denk- und Erfahrungshorizont der Mitarbeitenden integriert wird, bleibt sie abstrakt und wirkungslos.
Hier kommt Reframing ins Spiel: Durch die gezielte Veränderung des Deutungsrahmens werden neue Bedeutungen geschaffen, die den Mitarbeitenden einen direkten Bezug zu ihrer eigenen Arbeit ermöglichen.
Für das Beispiel unseres Medizintechnik-Unternehmens heißt das:
Die Vision wird nun erweitert, um sich als digitaler Gesundheitsdienstleister zu positionieren. Viele Mitarbeitende, insbesondere in der Produktion, könnten zunächst Widerstand verspüren. Sie sehen ihre Rolle möglicherweise als bedroht oder befürchten eine Abwertung ihrer bisherigen Arbeit. Ein rein rationales Argument wie „Wir müssen innovativer werden, um am Markt zu bestehen“ wird nicht ausreichen, um die Menschen emotional für den Wandel zu gewinnen. Stattdessen kann die Führungsebene durch Reframing eine andere Perspektive ermöglichen: „Bisher habt ihr mit eurer Arbeit die besten Medizingeräte gebaut, um Leben zu retten. Künftig geht es darum, nicht nur Geräte, sondern intelligente Lösungen bereitzustellen, die Menschen eine bessere Versorgung ermöglichen – unabhängig davon, wo sie sich befinden.“ Durch dieses Reframing verändert sich der Blickwinkel. Die Mitarbeitenden fühlen sich nicht als Verlierer der Transformation, sondern als essenzieller Teil einer Entwicklung, die ihre ursprüngliche Mission – Leben zu retten – auf eine neue Ebene hebt.
Laut John P. Kotter (1996) ist die Schaffung einer „Sense of Urgency“ – also eines Sinnes für Dringlichkeit – für Veränderungsprozesse entscheidend. Doch diese Dringlichkeit muss in einen positiven Bezugsrahmen gesetzt werden. Wird der Wandel lediglich als Reaktion auf Bedrohungen dargestellt, kann dies Ängste und Widerstände verstärken. Reframing hingegen lenkt den Fokus auf Chancen und die persönliche Bedeutung für den Einzelnen. Ähnlich argumentiert Daniel Pink (2009), der betont, dass Menschen besonders dann motiviert sind, wenn sie Autonomie, Kompetenz und Sinn in ihrer Arbeit erleben. Reframing trägt dazu bei, diese Faktoren zu stärken, indem es eine neue, sinnvolle Perspektive auf Veränderung bietet.
Ein weiteres Beispiel aus der Praxis:
Ein Automobilhersteller, der verstärkt auf Elektromobilität setzt, könnte bei seinen langjährigen Ingenieuren auf Widerstand stoßen. Sie sehen ihre Expertise im traditionellen Verbrennungsmotor nicht mehr gefragt. Statt ihnen zu sagen, dass ihre Fähigkeiten nicht mehr relevant sind, könnte die Führungsebene betonen: „Ihr habt jahrzehntelang dafür gesorgt, dass Autos effizienter und leistungsfähiger wurden. Jetzt seid ihr diejenigen, die die Zukunft der Mobilität mitgestalten und dafür sorgen, dass unsere Fahrzeuge nachhaltiger und intelligenter werden.“ Hier wird das bisherige Know-how nicht entwertet, sondern in einen neuen Kontext gesetzt, der die Betroffenen als wichtige Treiber des Wandels anerkennt.
Peter Drucker (1967) betont in „The Effective Executive“, dass Führungskräfte den Menschen nicht nur erklären sollten, was sich verändert, sondern vor allem, warum diese Veränderung für sie selbst von Bedeutung ist. Genau hier setzt Reframing an: Es ermöglicht eine emotionale Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, zwischen Gewohntem und Neuem. Indem Führungskräfte eine neue Bedeutung für den Wandel schaffen, können sie Mitarbeitende nicht nur rational, sondern auch emotional für die Vision des Unternehmens gewinnen.
Praxisanleitung: Reframing mit der "ALT-NEU-WARUM"-Methode
Diese Methode ermöglicht eine strukturierte Herangehensweise, um Veränderungen verständlich und akzeptabel zu machen. Sie kombiniert Reflexion, Storytelling und praktische Anwendung.
Vorbereitung: Workshop-Rahmen setzen
Ziel ist es, Mitarbeitende aktiv in den Reframing-Prozess einzubinden und eine neue, motivierende Sichtweise auf die Veränderung zu entwickeln. Teilnehmende sind Führungskräfte, betroffene Mitarbeitende oder Teams. Die Dauer beträgt etwa 60 bis 90 Minuten.
Einführung (ca. 10 Min.)
Zunächst wird kurz erläutert, warum der Workshop durchgeführt wird. Ein Beispiel für eine Einführung wäre: „Wir alle erleben gerade Veränderungen. Manche sind herausfordernd, andere bieten Chancen. Heute wollen wir gemeinsam eine Perspektive finden, die uns hilft, diese Veränderung sinnvoll zu gestalten.“ Danach wird die Methode „ALT-NEU-WARUM“ vorgestellt.
Durchführung: Die „ALT-NEU-WARUM“-Methode (ca. 40 Min.)
Die Teilnehmenden reflektieren, was bisher gut war, aber auch welche Herausforderungen es gab.
Fragen zur Orientierung:
Was hat in der alten Situation gut funktioniert?
Welche Schwierigkeiten gab es?
Welche Emotionen verbinden wir mit dem Alten?
Das Ziel ist es, Verständnis für die bisherigen Gewohnheiten zu schaffen und zu erkennen, wo Veränderungsbedarf bestand.
Die Teilnehmenden schreiben auf, welche Veränderungen jetzt anstehen und was dies für sie bedeutet.
Fragen zur Orientierung:
Was genau verändert sich?
Welche Vorteile kann die neue Situation bieten?
Wo gibt es Unsicherheiten oder Widerstände?
Das Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Veränderung zu schaffen und zu erkennen, welche positiven Aspekte sie mit sich bringen kann.
Gemeinsam wird ein „Warum“-Statement formuliert, das die Brücke zwischen ALT und NEU schlägt.
Fragen zur Orientierung:
Warum findet diese Veränderung statt?
Wie trägt sie zum Unternehmensziel oder zu unseren Werten bei?
Wie können wir sie aktiv gestalten, anstatt sie nur passiv hinzunehmen?
Das Ziel ist es, ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln, das Orientierung gibt und Widerstände reduziert. Das Ergebnis ist eine positive, gemeinsame Sichtweise auf die Veränderung, die schriftlich festgehalten wird.
Abschluss: Storytelling & Reframing-Statement (ca. 20 Min.)
Die Führungskraft oder eine ausgewählte Person fasst die Erkenntnisse zusammen. Anschließend wird eine kurze Reframing-Geschichte entwickelt:
Wie könnte ein Mitarbeitender die Veränderung positiv erleben?
Gibt es ein Beispiel aus der Vergangenheit, das zeigt, dass Wandel erfolgreich sein kann?
Das finale Reframing-Statement wird gemeinsam formuliert und auf Flipcharts, Whiteboards oder als Team-Reminder festgehalten.
Nachbereitung: Umsetzung im Alltag
In regelmäßigen Abständen (alle zwei bis vier Wochen) wird eine kurze Feedbackrunde durchgeführt:
Wie fühlt sich die Veränderung jetzt an?
Welche Aspekte funktionieren gut?
Wo gibt es noch Unsicherheiten?
Methode Nr. 2: Wertanalyse
Die Werte eines Unternehmens sind die unsichtbare Grundlage, die seine Kultur, Entscheidungsfindung und langfristige strategische Ausrichtung beeinflussen. Ebenso haben Mitarbeitende persönliche Werte, die ihr Verhalten und ihre Motivation prägen. Eine gezielte Werteanalyse hilft Führungskräften dabei, diese beiden Ebenen in Einklang zu bringen, um eine tiefere Identifikation mit dem Unternehmenszweck (Purpose) und der Vision zu ermöglichen. Wenn Mitarbeitende erkennen, dass ihre eigenen Überzeugungen mit den Unternehmenswerten übereinstimmen, entsteht eine intrinsische Motivation, sich aktiv für den Erfolg des Unternehmens einzusetzen.
Laut Edgar Schein (2010) sind Werte ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, die sich über Jahre hinweg entwickeln und das Verhalten der Mitarbeitenden bestimmen. Ein Unternehmen kann zwar offiziell bestimmte Werte wie „Innovation“ oder „Kundenzentrierung“ formulieren, doch wenn diese nicht von den Mitarbeitenden mit ihren eigenen Wertvorstellungen in Verbindung gebracht werden, bleiben sie wirkungslos. Hier setzt die Werteanalyse an: Sie ermöglicht es, Schnittstellen zwischen persönlichen und unternehmerischen Werten zu identifizieren und bewusst zu nutzen.
Zurück zu unserem Beispiel des Medizintechnikunternehmens:
Es entwickelt eine neue Vision, um sich von einem reinen Gerätehersteller zu einem digitalen Gesundheitsdienstleister zu transformieren. Viele Mitarbeitende fühlen sich mit der alten Struktur verbunden, da sie stolz darauf sind, hochwertige medizinische Geräte zu bauen. Die Werteanalyse kann helfen, diesen Wandel in einer für die Mitarbeitenden sinnvollen Weise zu gestalten. Statt einfach zu verkünden, dass „Digitalisierung die Zukunft ist“, könnten Führungskräfte gezielt die Wertemuster der Mitarbeitenden einbeziehen. Wenn die Belegschaft beispielsweise „Präzision“, „Verantwortung für Patienten“ und „Sicherheit“ als zentrale Werte betrachtet, kann die Vision darauf abgestimmt werden: „Unsere digitalen Lösungen ermöglichen eine noch präzisere und sicherere Patientenversorgung weltweit.“ Dadurch entsteht eine emotionale Verknüpfung zwischen dem neuen Unternehmensweg und den bestehenden Überzeugungen der Mitarbeitenden.
Laut Richard Barrett (2017) in „Building a Values-Driven Organization“ haben Werte eine Hierarchie, die darüber entscheidet, welche Aspekte für Individuen und Organisationen höchste Priorität haben. Während einige Mitarbeitende stark leistungs- und wachstumsorientiert sind, legen andere mehr Wert auf soziale Verantwortung oder Stabilität. Führungskräfte sollten deshalb nicht nur die Werte der Organisation definieren, sondern auch herausfinden, welche Werte den Mitarbeitenden am wichtigsten sind.
Ein praktischer Ansatz ist die Durchführung von Werteworkshops, in denen Mitarbeitende ihre wichtigsten Werte priorisieren und diese mit den Unternehmenswerten abgleichen. Wenn beispielsweise „Innovation“ als Unternehmenswert festgelegt ist, aber die Mehrheit der Belegschaft „Sicherheit und Verlässlichkeit“ als entscheidend betrachtet, sollte die Führungsebene darauf eingehen. Statt Innovation als Selbstzweck zu präsentieren, kann sie kommunizieren, dass neue digitale Lösungen langfristig die Sicherheit in der Patientenversorgung verbessern. Dadurch entsteht ein Anreiz, den Wandel als positiven Beitrag zur eigenen Arbeit zu sehen.
Simon Sinek (2009) beschreibt in „Start with Why“, dass Menschen nicht für Unternehmen arbeiten, sondern für das, woran sie glauben. Unternehmen, die Werte nicht nur als Schlagworte verwenden, sondern gezielt analysieren und in der Praxis erlebbar machen, schaffen eine starke Unternehmenskultur. Dies kann durch konkrete Maßnahmen wie Wertegespräche in Teamsitzungen, die Hervorhebung von Erfolgsgeschichten, die den Unternehmenswerten entsprechen, oder partizipative Entscheidungsprozesse geschehen.
Eine gezielte Werteanalyse trägt maßgeblich dazu bei, dass sich Mitarbeitende mit der Vision und dem Purpose eines Unternehmens identifizieren. Sie schafft eine Brücke zwischen den individuellen Antrieben und den strategischen Zielen des Unternehmens. Ohne eine bewusste Auseinandersetzung mit den Wertevorstellungen der Belegschaft bleibt eine Vision abstrakt und kann auf Widerstand stoßen. Unternehmen, die jedoch die persönliche Bedeutung der Werte für ihre Mitarbeitenden verstehen und in ihre Kommunikation einbauen, fördern nicht nur die Akzeptanz von Veränderungsprozessen, sondern auch langfristige Motivation und Loyalität.
Schritt-für-Schritt Anleitung für eine Werteanalyse
Schritt 1: Zielsetzung und Vorbereitung
Definieren Sie zunächst, was Sie mit der Werteanalyse erreichen möchten. Soll geprüft werden, inwieweit die persönlichen Werte der Mitarbeitenden mit der Unternehmensvision und dem Purpose übereinstimmen? Bestimmen Sie die Zielgruppen (z. B. verschiedene Abteilungen oder Hierarchieebenen) und legen Sie den zeitlichen Rahmen sowie die methodischen Ansätze fest.
Schritt 2: Datenerhebung – Methode: Werteinterviews
Führen Sie strukturierte Werteinterviews durch, um die individuellen und kollektiven Werte systematisch zu erfassen. Diese Interviews ermöglichen einen tieferen Einblick in die persönliche Bedeutung von Werten und deren Umsetzung im Arbeitsalltag.
Zieldefinition
Welche Werte sind besonders relevant für das Unternehmen?
Gibt es Diskrepanzen zwischen den gelebten und den gewünschten Unternehmenswerten?
Erstellung eines Interviewleitfadens:
Entwickeln Sie gezielte Fragen zur Werteerfassung, z. B.
Welche Werte sind Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag besonders wichtig?
In welchen Situationen fühlen Sie sich besonders motiviert oder demotiviert?
Wie erleben Sie die Unternehmenskultur in Bezug auf Werte wie Fairness, Innovation oder Zusammenarbeit?
Welche Werte sehen Sie als zentrale
Treiber für den Erfolg des Unternehmens?
Durchführung der Interviews
Befragen Sie eine repräsentative Auswahl von Mitarbeitenden aus verschiedenen Hierarchieebenen und Abteilungen.
Nutzen Sie ein halbstrukturiertes Format: Lassen Sie Raum für individuelle Erfahrungen, während Sie dennoch den Leitfaden beibehalten.
Analyse der Antworten
Identifizieren Sie Muster und wiederkehrende Werte.
Unterscheiden Sie zwischen individuellen, teambezogenen und unternehmensweiten Werteprioritäten.
Analysieren Sie mögliche Werte-Konflikte oder Fehlstellen in der Unternehmenskommunikation.
Ableitung von Handlungsempfehlungen
Entwickeln Sie Maßnahmen zur Stärkung von Schlüsselwerten und zur Anpassung der Unternehmenskultur.
Definieren Sie Strategien zur besseren Kommunikation und Integration der Werte in den Arbeitsalltag.
Schritt 3: Analyse der Ergebnisse
Werten Sie die gesammelten Daten aus, um zentrale Themen und wiederkehrende Werte zu identifizieren. Gruppieren Sie ähnliche Aussagen und analysieren Sie, inwieweit diese individuellen Werte mit den strategischen Zielen und der übergeordneten Vision des Unternehmens übereinstimmen. Identifizieren Sie mögliche Diskrepanzen oder Überschneidungen, die als Ansatzpunkte für weitere Maßnahmen dienen können.
Schritt 4: Ableitung von Maßnahmen
Leiten Sie aus der Analyse konkrete Handlungsfelder ab. Bestimmen Sie, welche Werte gestärkt und in die Unternehmenskommunikation integriert werden sollten. Entwickeln Sie Maßnahmen wie gezielte Workshops, interne Kampagnen oder Schulungsprogramme, um die identifizierten Werte im Arbeitsalltag zu verankern. Priorisieren Sie diese Maßnahmen nach Dringlichkeit und potenzieller Wirkung.
Schritt 5: Integration und Evaluation
Kommunizieren Sie die Ergebnisse der Werteanalyse transparent und binden Sie die Mitarbeitenden aktiv in den Veränderungsprozess ein. Implementieren Sie die erarbeiteten Maßnahmen und etablieren Sie regelmäßige Feedbackrunden, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. So schaffen Sie eine nachhaltige Verbindung zwischen den individuellen Antrieben und den strategischen Zielen des Unternehmens.
Methode Nr. 3: Verankerung von Zielen
Die Verankerung von Zielen ist mitunter der wichtigste Schritt, um eine Unternehmensvision nicht nur zu formulieren, sondern sie auch wirksam in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ziele bleiben wirkungslos, wenn sie nicht klar mit den täglichen Aufgaben und Entscheidungsprozessen der Mitarbeitenden verbunden werden. Eine effektive Verankerung sorgt dafür, dass die strategische Ausrichtung nicht als abstrakte Managementvorgabe wahrgenommen wird, sondern als praktischer Handlungsrahmen, der Orientierung und Sinn vermittelt.
Laut Peter Drucker („The Effective Executive“, 1967) werden Ziele nur dann nachhaltig verankert, wenn sie in die Entscheidungsfindung, Leistungsbewertung und Kommunikation eingebettet sind. Wenn Führungskräfte Ziele lediglich zu Beginn eines Jahres definieren und danach aus dem Blickfeld verlieren, fehlt der notwendige Bezug zum Tagesgeschäft. Stattdessen müssen Ziele regelmäßig reflektiert, überprüft und angepasst werden. In erfolgreichen Unternehmen geschieht dies durch fest etablierte Feedbackschleifen wie Quartalsreviews, Team-Check-ins oder persönliche Entwicklungsgespräche.
Ein Beispiel aus der Praxis ist die Einführung eines strukturierten Zielsystems wie Objectives and Key Results (OKRs).
Objectives and Key Results (OKRs) verbinden ambitionierte Ziele (Objectives) mit messbaren Ergebnissen (Key Results) zur Steuerung und Überwachung des Fortschritts.
Beispielsweise könnte ein Unternehmen als Objective die Steigerung der Kundenzufriedenheit definieren und als Key Results eine Reduktion der Reklamationsrate um 20 % sowie eine Erhöhung der positiven Kundenfeedbacks um 30 % festlegen.
Unternehmen wie Google oder Intel haben OKRs genutzt, um ambitionierte Ziele zu setzen und diese regelmäßig zu überprüfen. Der Vorteil liegt in der Transparenz und der klaren Messbarkeit. Statt allgemeine Absichten zu formulieren, werden konkrete, überprüfbare Ergebnisse definiert, die Mitarbeitenden helfen, ihre täglichen Aufgaben mit den übergeordneten Unternehmenszielen zu verknüpfen.
Dies steigert nicht nur die Motivation, sondern auch die Eigenverantwortung. Laut John Doerr („Measure What Matters“, 2018) führt die konsequente Nutzung von OKRs zu einer spürbaren Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Zielerreichung, weil sich alle Beteiligten kontinuierlich mit den gesetzten Vorgaben auseinandersetzen.
Neben formalen Strukturen spielt die emotionale Verankerung eine große Rolle. Laut Daniel Pink („Drive“, 2009) sind Menschen besonders motiviert, wenn sie Autonomie, Kompetenz und Sinn in ihrer Arbeit erleben. Führungskräfte sollten daher nicht nur Ziele definieren, sondern auch sicherstellen, dass Mitarbeitende verstehen, warum diese Ziele wichtig sind und welchen Beitrag ihre Arbeit dazu leistet. Storytelling ist hierbei ein wirksames Mittel, um abstrakte Zielsetzungen greifbar zu machen. Statt zu sagen „Wir wollen unsere Effizienz um 15 Prozent steigern“, könnte eine Führungskraft erklären: „Mit dieser Effizienzsteigerung ermöglichen wir es, mehr Patienten schneller zu behandeln und die Gesundheitsversorgung für viele Menschen zu verbessern.“ Diese Form der Kommunikation erzeugt eine tiefere emotionale Bindung an das Ziel.
In unserem Medizintechnikunternehmen, das sich von einem reinen Gerätehersteller zu einem digitalen Gesundheitsdienstleister transformierte, könnte es so abgelaufen sein:
Um sicherzustellen, dass die neue strategische Ausrichtung nicht nur in der Unternehmenskommunikation, sondern auch im Arbeitsalltag verankert wurde, führte das Unternehmen eine Kombination aus OKRs und internen Kommunikationsmaßnahmen ein.
Jedes Team entwickelte spezifische Ziele, die direkt zur Vision „Wir ermöglichen ein gesünderes Leben durch intelligente Medizintechnik“ beitrugen. Für die Entwicklungsabteilung bedeutete dies etwa die Einführung von KI-gestützten Diagnosesystemen, während der Vertrieb sich darauf konzentrierte, neue digitale Services für Krankenhäuser zu etablieren.
Zusätzlich wurden monatliche „Innovation Days“ eingeführt, bei denen Mitarbeitende neue Ideen für digitale Gesundheitslösungen präsentieren konnten. Die Führungsebene verstärkte die emotionale Verankerung der neuen Vision, indem sie regelmäßig Erfolgsgeschichten teilte – etwa über ein Krankenhaus, das durch die neuen digitalen Lösungen effizientere Behandlungen durchführen konnte.
Zudem wurden physische Anker geschaffen: In den Unternehmensbüros wurden großformatige Visualisierungen der strategischen Ziele angebracht, und interne Newsletter hoben monatlich Meilensteine auf dem Weg zur digitalen Transformation hervor.
Ein weiteres Mittel zur Verankerung der neuen Unternehmensausrichtung war die Integration der Ziele in die Feedback- und Belohnungssysteme. Mitarbeitende, die durch ihre Arbeit aktiv zur Umsetzung der Vision beitrugen, wurden im Rahmen von Teammeetings hervorgehoben und für ihre Beiträge belohnt. Die regelmäßige Verknüpfung individueller Leistung mit dem großen Ganzen sorgte dafür, dass die Vision nicht abstrakt blieb, sondern als konkreter Bestandteil der täglichen Arbeit wahrgenommen wurde.
Zur Vertiefung dieser Ansätze sei auf die Arbeiten von Daniel H. Pink („Drive – Was Sie wirklich motiviert“), Peter Drucker („The Practice of Management“) und John P. Kotter („Leading Change“) verwiesen, die wertvolle Impulse zur Verknüpfung von Unternehmensstrategie und Mitarbeitermotivation liefern.
Die Verankerung von Zielen hängt davon ab, ob sie in den Köpfen der Menschen lebendig bleiben. Unternehmen, die dies erfolgreich umsetzen, integrieren ihre Zielsetzungen konsequent in alle relevanten Prozesse, verknüpfen sie mit individuellen Motivationsfaktoren und sorgen für eine klare Kommunikation. Sie nutzen dabei bewährte Tools zur Definition und Kommunikation von Visionen und Zielen, die wir in dem kommenden Abschnitt näher kennenlernen werden.
Tools zur Definition und Kommunikation einer Vision
Die Entwicklung und erfolgreiche Kommunikation einer Vision erfordert mehr als nur eine inspirierende Formulierung. Eine Vision muss greifbar, überzeugend und für alle Mitarbeitenden verständlich sein. Ohne klare Definition und konsequente Vermittlung bleibt sie ein abstraktes Konzept, das keine Wirkung entfaltet. Um eine Vision wirkungsvoll in der Organisation zu verankern, stehen verschiedene bewährte Methoden zur Verfügung. Diese helfen, die Vision nicht nur zu entwickeln, sondern sie auch so zu kommunizieren, dass sie Orientierung gibt und Motivation schafft. In diesem Kapitel werden praxisnahe Tools vorgestellt, die Führungskräften dabei helfen, eine klare und überzeugende Vision zu formulieren und in den Alltag zu integrieren.
Tool 1: SMART-Methode für klare Zielsetzung
Die SMART-Methode ist ein bewährtes Werkzeug, um Visionen in klare, umsetzbare Ziele zu überführen. Unternehmen, die eine ambitionierte Vision formulieren, stehen oft vor der Herausforderung, diese in konkrete Maßnahmen zu übersetzen. Hier setzt die SMART-Methode an, indem sie sicherstellt, dass Ziele nicht nur inspirierend, sondern auch spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sind. Dadurch wird vermieden, dass strategische Leitlinien vage bleiben oder in der alltäglichen Umsetzung an Klarheit verlieren.
Schritt 1: Analyse
Der erste Schritt in der Anwendung der SMART-Methode besteht darin, die Vision eines Unternehmens zu analysieren und zu prüfen, ob sie ausreichend konkretisiert wurde. Eine allgemeine Vision wie „Wir wollen Marktführer in nachhaltiger Technologie werden“ ist zwar inspirierend, bietet jedoch keine Orientierung für operative Maßnahmen. Indem die SMART-Kriterien angewandt werden, lässt sich aus einer solchen Formulierung ein präziseres Ziel ableiten, das Mitarbeitenden eine klare Richtung gibt.
Ein spezifisches Ziel definiert genau, was erreicht werden soll. Es geht darum, die Vision in greifbare Begriffe zu übersetzen. Anstatt zu sagen „Wir wollen nachhaltiger werden“, sollte beispielsweise formuliert werden: „Wir reduzieren den Energieverbrauch unserer Produktion um 20 % bis 2028.“ Diese Spezifizierung verhindert Missverständnisse und stellt sicher, dass alle Beteiligten ein einheitliches Verständnis des angestrebten Ergebnisses haben.
Ein Ziel ist messbar, wenn es eindeutige Indikatoren zur Erfolgskontrolle enthält. Ohne eine messbare Größe ist es schwierig zu beurteilen, ob Fortschritte erzielt wurden. Ein Beispiel wäre: „Wir steigern den Anteil recycelter Materialien in unseren Produkten auf 50 % innerhalb der nächsten fünf Jahre.“ Der Fortschritt lässt sich anhand der tatsächlich verwendeten Materialien überprüfen, was eine objektive Bewertung ermöglicht.
Ein attraktives Ziel motiviert die Beteiligten und trägt zur übergeordneten Strategie des Unternehmens bei. Mitarbeitende müssen verstehen, warum das gesetzte Ziel für den langfristigen Erfolg relevant ist. Wenn das Ziel beispielsweise lautet: „Wir reduzieren den CO₂-Ausstoß unserer Produktion um 30 % bis 2027“, sollte gleichzeitig erläutert werden, wie dies zur Verbesserung der Marktposition oder zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen beiträgt.
Die Realisierbarkeit eines Ziels ist ein entscheidender Faktor. Ein Ziel darf ambitioniert sein, sollte jedoch mit den verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen umsetzbar bleiben. Es wäre wenig sinnvoll, ein Ziel zu setzen, das unerreichbar erscheint, da dies zu Frustration und Demotivation führt. Stattdessen sollten bereits bestehende Maßnahmen und Potenziale berücksichtigt werden.
Die Terminierung sorgt dafür, dass ein Ziel an einen festen Zeitrahmen gebunden ist. Ohne eine klare Frist besteht die Gefahr, dass Maßnahmen aufgeschoben oder nicht konsequent verfolgt werden. Beispielsweise könnte ein Unternehmen formulieren: „Bis Ende 2026 sollen alle neuen Produkte mit mindestens 50 % recycelten Materialien hergestellt werden.“
Wenden wir diese Methode nun auf das Beispiel des Medizintechnik-Unternehmens an, das sich von einem Gerätehersteller zu einem digitalen Gesundheitsdienstleister transformiert. Seine Vision lautet: „Wir ermöglichen ein gesünderes Leben durch intelligente Medizintechnik.“ Diese Aussage gibt eine klare Richtung vor, benötigt jedoch spezifische Ziele, um in den Alltag überführt zu werden.
Schritt 2: Formulierung des konkreten SMART-Zieles
Ein SMART-Ziel könnte nun folgendermaßen lauten:
„Bis 2026 sollen 80 % unserer medizinischen Geräte mit digitalen Assistenzsystemen ausgestattet sein, die eine präzisere Diagnose ermöglichen.“
Dieses Ziel ist spezifisch, da es sich auf digitale Assistenzsysteme und deren Integration in medizinische Geräte konzentriert.
Es ist messbar, weil sich der Fortschritt anhand des Anteils der Geräte mit entsprechender Technologie erfassen lässt.
Es ist attraktiv, weil es den übergeordneten Unternehmenszweck unterstützt und sowohl für Kunden als auch für die Belegschaft einen erkennbaren Mehrwert bietet.
Die technische Entwicklung des Unternehmens erlaubt es, dieses Ziel realistisch zu erreichen.
Schließlich stellt die Frist bis 2026 sicher, dass das Ziel nicht unverbindlich bleibt.
Durch die Anwendung der SMART-Methode erhält das Unternehmen eine klare Orientierung für seine Innovationsstrategie. Führungskräfte können gezielt Maßnahmen ableiten, um die Integration digitaler Technologien voranzutreiben, und Mitarbeitende wissen, welche Schritte zur Verwirklichung der Vision notwendig sind. Die Methode trägt somit dazu bei, langfristige strategische Ziele mit konkreten, greifbaren Maßnahmen zu verbinden, die sowohl überprüfbar als auch motivierend sind.
Tool 2: Storytelling als Mittel zur emotionalen Aufladung
Storytelling ist ein Mittel, um Visionen nicht nur zu formulieren, sondern sie erlebbar zu machen, denn Geschichten haben eine starke emotionale Wirkung, da sie Menschen helfen, sich mit einem Thema zu identifizieren und abstrakte Konzepte in konkrete, nachvollziehbare Erlebnisse zu übersetzen. Während Zahlen und Fakten oft schnell vergessen werden, bleiben gut erzählte Geschichten in Erinnerung.