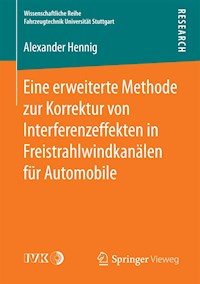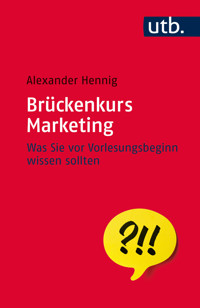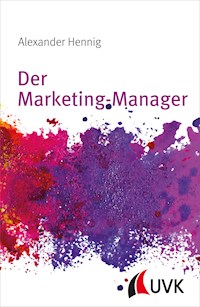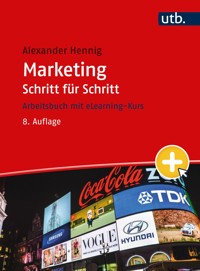
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schritt für Schritt
- Sprache: Deutsch
Produktpolitik, Corporate Identity und Sponsoring - das sind nur einige Begriffe, die in einer Marketingvorlesung zu finden sind. Das Arbeitsbuch bietet einen verständlichen Überblick über dieses spannende Thema und führt Schritt für Schritt in die wichtigsten Grundlagen ein: Marktforschung, Konsumentenverhalten, strategisches Marketing, Produkt- und Programmpolitik, Markenpolitik, Preis- und Konditionenpolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik sowie Controlling. Zahlreiche Übersichten, Merksätze und Zusammenfassungen erleichtern das Verständnis. Die aktuelle Auflage wurde überarbeitet und um aktuelle Aspekte der Inflation und der Nachhaltigkeit erweitert. utb+: Begleitend zum Buch steht den Leser:innen ein E-Learning-Kurs für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. Erhältlich über utb.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
utb 8711
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Alexander Hennig ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Handelsmanagement und leitet den Studiengang Digital Commerce Management an der Dualen Hochschule Mannheim.
Alexander Hennig
MarketingSchritt für Schritt
Arbeitsbuch mit eLearning-Kurs
8., überarbeitete und erweiterte Auflage
Umschlagabbildung: © OfirPeretz, iStock
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
7., überarbeitete Auflage 2022
6., überarbeitete Auflage 2021
5., überarbeitete Auflage 2020
4., überarbeitete Auflage 2019
3., vollständig überarbeitete Auflage 2018
2., bearbeitete Auflage 2017
1. Auflage 2013
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838588230
© UVK Verlag 2023
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: [email protected]
eMail: info.narr.de
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
CPI books GmbH, Leck
utb-Nr. 8711
ISBN 978-3-8252-8823-5 (Print)
ISBN 978-3-8385-8823-0 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-8823-5 (ePub)
Vorwort
Schon seit vielen Jahrzehnten gehört das Marketing in den Unternehmen zu den wichtigsten Aufgaben. Unternehmen stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die dieselben Kunden erreichen möchten.
Grundlegende und vertiefende Vorlesungen zum Marketing gehören daher zum Vorlesungsprogramm aller wirtschaftswissenschaftlichen und auch vieler nichtökonomischer Studiengänge. In vielen Berufsfeldern – auch außerhalb der Marketing- und Vertriebsabteilungen – sind Kenntnisse im Marketing heute gefragt und notwendig für die Erfüllung der gestellten Aufgaben.
In diesem Arbeitsbuch findet man alle wesentlichen Inhalte zum Thema Marketing. Besonders wichtig ist dem Buch dabei, durch Überblicksdarstellungen, Aufzählungen und Prozessschritte die Struktur des Marketings deutlich zu machen. Jedes Lernkapitel ist auf die Prüfung zugeschnitten. Neben den wichtigen Stichworten findet man wertvolle und themenbezogene Prüfungstipps. Nach jedem Kapitel kann der Leser seinen Wissensstand überprüfen.
Am Ende des Buches findet man ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen.
Vorab ein allgemeiner und besonders wichtiger Prüfungstipp für alle Marketing-Vorlesungen: Wirklich jeder kann viel vom Marketing in der Praxis sehen und lernen, wenn er mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht. Weil sich das Marketing an uns als Kunden richtet, ist es für uns alle erfahrbar – jeden Tag. Genau deswegen werden in diesem Buch die theoretischen Inhalte immer auch an (kursiv gedruckten) Beispielen aus der Realität angewendet und verdeutlicht. Weil sich das Marketing stetig weiterentwickelt, enthält auch diese Auflage wieder neue und aktuelle Beispiele. Suchen Sie auch selbst in der Realität Marketing-Strategien und -Instrumente und stellen Sie die Verbindung zu den hier genannten Fachbegriffen der Betriebswirtschaftslehre her!
Und hier noch ein weiterer Tipp: Das Marketing-System lernen Sie am einfachsten, indem Sie Unternehmen aus ihrem Umfeld nehmen und sich überlegen, welches Marketing sie machen. Sie nehmen zum Beispiel den Marketing-Mix, von dem hier im Buch viel die Rede ist, und wenden ihn auf ein Unternehmen an, das Sie kennen. So erkennen Sie schnell, wie Marketing funktioniert.
Denn: Die Welt ist voller Marketing!
Zu diesem Buch gibt es einen ergänzenden eLearning-Kurs aus 150 Fragen.
Mithilfe des Kurses können Sie online überprüfen, inwieweit Sie die Themen des Buches verinnerlicht haben. Gleichzeitig festigt die Wiederholung in Quiz-Form den Lernstoff.
Der eLearning-Kurs kann Ihnen dabei helfen, sich gezielt auf Prüfungssituationen vorzubereiten.
Der eLearning-Kurs ist eng mit vorliegendem Buch verknüpft. Sie finden im Folgenden zu den wichtigen Kapiteln QR-Codes, die Sie direkt zum dazugehörigen Fragenkomplex bringen. Andersherum erhalten Sie innerhalb des eLearning-Kurses am Ende eines Fragendurchlaufs neben der Auswertung der Lernstandskontrolle auch konkrete Hinweise, wo Sie das Thema bei Bedarf genauer nachlesen bzw. vertiefen können. Diese enge Verzahnung von Buch und eLearning-Kurs soll Ihnen dabei helfen, unkompliziert zwischen den Medien zu wechseln, und unterstützt so einen gezielten Lernfortschritt.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Schritt 1: Grundbegriffe des Marketings
Schritt 2: Marktforschung
Schritt 3: Konsumentenverhalten
Schritt 4: Strategisches Marketing
Schritt 5: Produkt- und Programmpolitik
Schritt 6: Markenpolitik
Schritt 7: Preis- und Konditionenpolitik
Schritt 8: Distributionspolitik
Schritt 9: Kommunikationspolitik
Schritt 10: Marketing-Controlling
Glossar
Literatur
Stichwortverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schritt 1: Grundbegriffe des Marketings
Lernhinweise
1.1Definition des Marketings
1.2Doppelfunktion des Marketings
1.3Unternehmensführung
1.4Marketing in der Unternehmensführung
1.5Prüfungstipps
Schritt 2: Marktforschung
Lernhinweise
2.1Primär- und Sekundärforschung
2.2Umweltanalyse des Marketings
2.3Marktsegmentierung
2.4Prüfungstipps
Schritt 3: Konsumentenverhalten
Lernhinweise
3.1S-O-R-Modell
3.2Kaufentscheidungsprozesse
3.3Organisationelles Kaufverhalten
3.4Kundenzufriedenheit
3.5Kundenbindung
3.6Prüfungstipps
Schritt 4: Strategisches Marketing
Lernhinweise
4.1Wettbewerbsvorteile
4.2Differenzierungsstrategie
4.3Kostenführerschaftsstrategie
4.4Marktbearbeitungsstrategien
4.5Lebenszyklus-Analyse
4.6Portfolio-Analyse
4.7SWOT-Analyse
4.8Prüfungstipps
Schritt 5: Produkt- und Programmpolitik
Lernhinweise
5.1Begriff
5.2Nutzentreiber
5.3Produktvariation und Produktdifferenzierung
5.4Gender-Marketing und Ethno-Marketing
5.5Servicepolitik
5.6Verpackungspolitik
5.7Sortimentspolitik
5.8Programmpolitik
5.9Prüfungstipps
Schritt 6: Markenpolitik
Lernhinweise
6.1Begriffe
6.2Funktionen einer Marke
6.3Markenstrategien
6.4Prüfungstipps
Schritt 7: Preis- und Konditionenpolitik
Lernhinweise
7.1Grundlagen
7.2Preisbestimmung
7.3Preisstrategien
7.4Aspekte der Preispolitik
7.5Reaktion auf Preissenkungen
7.6Preisdifferenzierung
7.7Konditionenpolitik
7.8Prüfungstipps
Schritt 8: Distributionspolitik
Lernhinweise
8.1Aufgaben der Distributionspolitik
8.2Physische Distribution
8.3Interne Distributionsorgane
8.4Externe Distributionsorgane
8.5Großhandel
8.6Einzelhandel
8.7Marktveranstaltungen
8.8Absatzwegepolitik
8.9Verkaufstypologie
8.10Prüfungstipps
Schritt 9: Kommunikationspolitik
Lernhinweise
9.1Funktionen der Kommunikationspolitik
9.2Instrumente der Kommunikationspolitik
9.3Push- und Pull-Strategie
9.4Werbung
9.5Verkaufsförderung
9.6Öffentlichkeitsarbeit
9.7Sponsoring
9.8Weitere kommunikationspolitische Instrumente
9.9Corporate Identity
9.10Prüfungstipps
Schritt 10: Marketing-Controlling
Lernhinweise
10.1Definition des Marketing-Controllings
10.2Marketing-Audit
10.3Ergebnisorientiertes Marketing-Controlling
10.4Kennzahlenanalyse
10.5Prüfungstipps
Glossar
Literatur
Stichwortverzeichnis
Schritt 1:
Grundbegriffe des Marketings
Lernhinweise
Was erwartet mich in diesem Kapitel?
In diesem Kapitel lernt man, was Marketing bedeutet, welche verschiedenen Arten des Marketings es heute gibt, wie Unternehmensführung allgemein funktioniert und was das für das Marketing bedeutet. Außerdem wird der Marketing-Mix erklärt.
Welche Schlagwörter lerne ich kennen?
Marketing Absatzmarketing Beschaffungsmarketing Personalmarketing Non-Profit-Marketing De-Marketing Selbstmarketing Unternehmensführung Marketing-Regelkreis Marketing-Ziele Marketing-Strategien Marketing-Mix Produkt- und Programmpolitik Preis- und Konditionenpolitik Distributionspolitik Kommunikationspolitik Green Marketing
Wofür benötige ich dieses Wissen?
Dieses Wissen ist nötig, um die wichtigsten Begriffe wie Marketing, Ziele, Strategien und Marketing-Mix zu kennen und erklären zu können. In der wissenschaftlichen Theorie und der betrieblichen Praxis werden diese Begriffe häufig verwendet. Der Marketing-Mix ist die wichtigste Sortierung der Marketing-Instrumente, die es im Bereich des Marketings gibt.
Die Lernfragen zu diesem Kapitel finden Sie unter:
https://narr.kwaest.io/s/1135
1.1Definition des Marketings
Der Begriff Marketing ist mit Sicherheit einer der am häufigsten genutzten Begriffe in der modernen Betriebswirtschaftslehre. Die Definitionen in den Marketing-Lehrbüchern unterscheiden sich nur wenig und können auf einfache Weise so zusammengefasst werden:
Marketing (enge Definition als Absatzmarketing)
Marketing ist alles das, was ein Unternehmen tut, damit der Kunde dessen Produkte kauft.
Wenn nur von Marketing die Rede ist, ist meist nur das soeben definierte Absatzmarketing gemeint. Der Kern des Marketings liegt also in der konsequenten Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten eines Unternehmens an den Bedürfnissen des Marktes. Angesichts des intensiven Wettbewerbs, der heute auf fast allen Konsumgüter- und Investitionsgütermärkten herrscht, ist dies für Unternehmen zwingend notwendig. Ausführlicher gesagt, können unter dem Begriff Marketing alle Entscheidungen und Maßnahmen eines Unternehmens zusammengefasst werden, die einen Kunden, sei es einen Privatkunden, ein Unternehmen oder den Staat, direkt oder indirekt dazu bewegen sollen, Produkte vom marketingtreibenden Unternehmen zu erwerben.
Als Produkte wird dabei alles das bezeichnet, was ein Unternehmen herstellt. Dies können sein:
Sachgüter (z. B. Lebensmittel, Katzenfutter, Gebäude, Notebook, Hochgeschwindigkeitszug, Wasserkraftwerk)
Dienstleistungen (z. B. Handwerkerleistungen, ärztliche Behandlungen, Massage, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung)
Rechte (z. B. Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga, Urheberrechte an Büchern und Musik, Patentrecht für einen neuen Impfstoff, Markenrecht für ein bekanntes Markenzeichen (Unternehmens-Logo, Produktname).
Die absatzwirtschaftliche Definition des Marketings hat in den letzten Jahrzehnten eine Erweiterung erfahren, weil nicht mehr nur Unternehmen Marketing betreiben und weil auch andere Handlungen als der Kauf von Produkten durch Marketing erreicht werden sollen. Die folgende weite Definition des Marketings trägt dem Rechnung:
Marketing (weite Definition)
Marketing ist alles das, was jemand tut, damit jemand anderes etwas tut.
Mit dieser Definition lässt sich der Begriff des Marketings in weiteren Kontexten nutzen:
Beim Beschaffungsmarketing geht es um die Entscheidungen und Maßnahmen eines Unternehmens, die einen begehrten Lieferanten dazu bewegen sollen, an das Unternehmen und vielleicht nicht an andere zu liefern. (z. B. durch Pflege des Kontakts zum Lieferanten und Teilnahme an Beschaffungsmessen)
Das Personalmarketing umfasst alle Entscheidungen und Maßnahmen eines Unternehmens, die dazu dienen, gute neue Mitarbeiter zu gewinnen. (z. B. durch Teilnahme an Ausbildungsmessen, Plakatwerbung an Hochschulen, Angebot von Praktika, Casting-Tage von Unternehmen, Youtube-Videos über die Aufgaben für Mitarbeiter, Karriere-Homepages von Unternehmen mit Stellenangeboten und Online-Bewerbungsmöglichkeiten)
Das B-to-B-Marketing (Business-to-Business-Marketing) ist das Marketing von Unternehmen gegenüber anderen Organisationen wie Herstellern, Handelsunternehmen und öffentlichen Institutionen. Es handelt sich also um eine besondere Form des Absatzmarketings. Das Kaufverhalten von Organisationen unterscheidet sich stark vom Kaufverhalten der Konsumenten. (z. B. bei einem Elektronikkonzern, der Hochgeschwindigkeitszüge an Bahnunternehmen und Turbinen an Elektrizitätsgesellschaften verkauft)
Nicht gewinnorientierte Institutionen wie Behörden und Nichtregierungsorganisationen betreiben Non-Profit-Marketing, um Bürger oder Unternehmen zu einem bestimmten Handeln zu bringen. (z. B. beim Roten Kreuz, das Bürger mit Plakatwerbung und Blutspendebussen auf öffentlichen Plätzen zur Blutspende animieren möchte, oder bei einer Gesundheitsbehörde, die durch Plakat- und Kinowerbung sowie die Verteilung von Kondomen für deren Nutzung zwecks AIDS-Prävention werben möchte)
Beim De-Marketing dienen die Entscheidungen und Maßnahmen dazu, dass jemand anderes etwas unterlassen soll. De-Marketing-Maßnahmen sind oft Teil eines Non-Profit-Marketings. (wenn z. B. Plakate oder schockierende Youtube-Videos dazu bewegen sollen, dass Autofahrer auf der Autobahn nicht rasen oder während der Fahrt nicht auf das Smartphone schauen)
Auch der Begriff des Selbstmarketings lässt sich in diese abstrakte Formel einbauen: Hier sind es dann Entscheidungen und Maßnahmen, die eine Privatperson trifft, damit jemand anderes wie gewünscht handelt. (damit z. B. ein Unternehmen die Bewerberin als Mitarbeiterin einstellt oder eine andere Person beim Abendessen Sympathie für jemanden empfindet, damit man als Mietinteressent den Zuschlag für die begehrte Mietwohnung bekommt)
Wenn im Folgenden von Marketing die Rede ist, ist das Marketing in der engen Definition, also als Absatzmarketing, gemeint.
1.2Doppelfunktion des Marketings
Abb. 1: Doppelfunktion des Marketings
Das moderne Marketing hat in Unternehmen eine Doppelfunktion zu übernehmen, die sich in zwei Aufgaben äußert:
Marketing als Leitkonzept der Unternehmensführung
Marketing als Unternehmensfunktion
Unter dem Marketing als Leitkonzept der Unternehmensführung versteht man die Grundhaltung, dass sämtliche Unternehmensaktivitäten konsequent an den Anforderungen der Märkte und hier insbesondere der Kunden und der Wettbewerber auszurichten sind (Markierung I in Abb. 1).
Alle unternehmerischen wertschöpfenden Funktionen, wie sie im Wertschöpfungsmodell in der Abbildung gegliedert sind, sollen ihre Funktionserfüllung unter der Maxime der Kundenorientierung ausüben und so handeln, dass es den Verkauf der Sachgüter und Dienstleistungen ermöglicht und befördert.
Handelsunternehmen z. B. richten auch ihre Infrastruktur (Filialarchitektur, Ladengestaltung, Parkplätze) an den Bedürfnissen der Kunden aus. Herstellende Unternehmen gestalten die Produktionsprozesse derart, dass sich daraus später weitere Verkaufsargumente (z. B. umweltschonende Produktion) ergeben. Der Kundenservice, der nach dem Kauf der Produkte geleistet wird, wird als Argument bereits vor dem Kauf eingesetzt. Die Mitarbeiter werden auch im Hinblick darauf ausgesucht, welche Bedürfnisse die Kunden haben.
Angesichts dieses Dominanzanspruchs steht Marketing nicht selten im Konflikt zu anderen betrieblichen Funktionen (Beschaffung, Produktion, Finanzen, Personal, Forschung und Entwicklung).
Die Marketing-Abteilung z. B. fordert im Regelfall zahlreiche Produktvarianten, wohingegen die Produktionsabteilung aus Gründen der Komplexitätsreduktion wenige Varianten bevorzugt. Das Marketing zielt typischerweise auf einen möglichst hohen Marktanteil, die Finanzabteilung hingegen auf einen möglichst hohen Gewinn. Während die Marketing-Abteilung von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kurze Entwicklungszyklen fordert, setzt sich jene für lange Entwicklungszeiträume ein.
Außerdem dürfen der Dominanzanspruch des Marketings und damit die Fokussierung des Unternehmens auf den Kunden nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Erfolg eines Unternehmens noch von anderen Faktoren beeinflusst wird (z. B. herausragende Stärken in der Beschaffung, der Forschung und Entwicklung, der Logistik oder der Finanzierung).
Das Marketing als Unternehmensfunktion hingegen betrifft die konkrete Ausgestaltung der Absatzfunktion und entspricht damit weitgehend dem Einsatz von absatzwirtschaftlichen Instrumenten, wie sie das Operative Marketing im Marketing-Mix kennt (Markierung II in Abb. 1).
In dieser Doppelfunktion des Marketings und damit dem Wandel von einer funktionsorientierten zu einer unternehmensbezogenen Denkhaltung ist der entscheidende Unterschied zur „klassischen“ Absatzwirtschaft zu sehen. Sie verstand sich lediglich als eine betriebliche Funktion „am Ende des Fließbandes“, die in der Verwertung von Sach- und Dienstleitungen auf den Märkten besteht und Unternehmensfunktionen wie z. B. Beschaffung, Produktion, Finanzierung unter- oder gleichgeordnet ist.
Wie auch in allen anderen Funktionsbereichen des Unternehmens hat auch beim Marketing die Bedeutung der Nachhaltigkeit in den letzten Jahren deutlich zugenommen (Green Marketing).
Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht mittlerweile ein ernstes Anliegen geworden, was viel damit zu tun hat, dass es bei den Kunden des Unternehmens genauso ist. Bei privaten Verbrauchern spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, wenngleich auch festgestellt werden kann, dass es bei den Einstellungen und Absichten relevanter ist als bei den tatsächlichen Kaufentscheidungen. Auch bei gewerblichen und staatlichen Kunden spielt Nachhaltigkeit bei Produkten und Prozessen bei der Kaufentscheidung eine immer größere Rolle, weil sich diese Organisationen immer öfter selbst Nachhaltigkeitsziele und damit verbundene Standards geben oder sich diesen unterwerfen.
Unternehmen, welche die Nachhaltigkeit bei ihren Produkten und Prozessen erhöhen, erlangen Wettbewerbsvorteile gegenüber den Unternehmen, die dies nicht tun, können neue Zielgruppen gewinnen, denen Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, erhöhen die Reputation ihrer Marken und binden mitunter auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei der Auswahl ihres Arbeitgebers auf Nachhaltigkeit achten. Allerdings hat der Fokus auf Nachhaltigkeit auch Nachteile: Nachhaltige Produkte und Prozesse sind oft teurer, Preise müssen vielleicht erhöht werden, und bisherige Kunden reagieren mit Widerstand auf die Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit.
Handelt es sich nicht um tatsächliche Bemühungen um Nachhaltigkeit bei Produkten und Prozessen, sondern nur um die Darstellung vermeintlicher Nachhaltigkeit, spricht man vom Greenwashing. Werden Unternehmen des Greenwashings überführt, z. B. durch staatliche Stellen oder Nichtregierungsorganisationen, droht ein großer Imageschaden und der Verlust jener Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist.
1.3Unternehmensführung
Die folgende Abbildung zeigt eine idealtypische Sichtweise von Unternehmensführung, den so genannten Regelkreis der Unternehmensführung.
Abb. 2: Regelkreis der Unternehmensführung
Am Beginn einer rationalen Unternehmensführung müssen die Ziele des Unternehmens stehen. Die Ziele leiten sich aus dem Unternehmensleitbild ab, einer abstrakten Handlungsmaxime des Unternehmens, die meist von den Gründern, den Eigentümern und der Unternehmensgeschichte geprägt ist.
Nach Definition der Ziele und mit Blick darauf muss das Unternehmen die Strategien festlegen. Das bedeutet einen wenig konkreten, langfristig orientierten Aufbau von Potenzialen, die durch die Taktik im nächsten Schritt ausgeschöpft werden sollen.
Die amerikanische Literatur versteht es, den Unterschied zwischen Strategie und Taktik auf den Punkt zu bringen:
Strategie ist, „die richtigen Dinge zu tun“.
Taktik ist, „die Dinge richtig zu tun“.
Nur wenn die „richtigen Dinge“ „richtig“ getan werden, kann das Ziel erreicht werden. Die gedankliche und praktische Unterscheidung von Strategie und Taktik in der Unternehmensführung ist für die Erreichung der Ziele von grundlegender Bedeutung.
Die praktische Durchführung der auf diese Weise systematisch beschlossenen Maßnahmen wird auch als Operationalisierung bezeichnet.
Darauf folgt das Controlling, das zwei Aufgaben hat:
Zum einen soll es durch einen Soll-Ist-Vergleich im Nachhinein überprüfen, inwiefern es zu Abweichungen zwischen dem Gewünschten (Soll, Ziele) und dem Erreichten (Ist) gekommen ist.
Zum anderen übernimmt das Controlling Steuerungs- und Planungsaufgaben, indem die Maßnahmen und Entscheidungen der Operationalisierung, der Taktik und der Strategie mit Blick auf die Ursachenanalyse kontinuierlich justiert werden. Dies geschieht üblicherweise in umgekehrter Reihenfolge: Zunächst wird das Unternehmen versuchen, durch Änderungen bei der Operationalisierung die Soll-Ist-Abweichungen zu verringern. Bleibt dies ohne Erfolg, wird es taktische Veränderungen vornehmen. Sollten auch diese nicht in gewünschtem Maße wirken, werden – in unregelmäßigen Zyklen – auch die Strategien des Unternehmens angepasst. Selbst die Ziele können Gegenstand einer Veränderung sein. Das Controlling ist also jener Teil der Unternehmensführung, der für den Kreislaufcharakter von Unternehmensführung sorgt.
Dieser Regelkreis der Unternehmensführung wird vollständig durch zwei Analysefelder, die sich mit den Stärken und Schwächen des Unternehmens selbst (Unternehmensanalyse) sowie mit den Chancen und Risiken der Unternehmensumwelt (Umweltanalyse) auseinandersetzen.
1.4Marketing in der Unternehmensführung
Der idealtypische Aufbau der Marketing-Konzeption in einem Unternehmen entspricht der Anwendung der idealtypischen Unternehmensführung mit Bezug auf das Marketing. Das Marketing wird also in den Regelkreis der Unternehmensführung integriert, so dass auch von einem Marketing-Regelkreis gesprochen werden kann.
Vereinfacht ausgedrückt geben
Marketing-Ziele den Wunschort (Wohin?)
das Strategische Marketing die Route (Wie?)
die Marktforschung die Landkarte und Stadtpläne und
der Marketing-Mix das jeweilige Beförderungsmittel (Womit?) vor.
Abb. 3: Marketing-Regelkreis
Am Anfang stehen die Marketing-Ziele als angestrebte Sollzustände in der Zukunft, die mittels Marketing erreicht werden sollen. Dies können quantitative Zielgrößen wie Umsatz, Deckungsbeitrag, Marktanteil oder Zahl der Neukunden sein, aber auch nicht-quantitative psychographische, d. h. mit der Psyche der Kunden zusammenhängende Zielgrößen wie Bekanntheit, Image, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.
Abgeleitet von den festgelegten Marketing-Zielen, die auch Teil des gesamten Zielkatalogs eines Unternehmens sind, wird im Strategischen Marketing festgelegt, mithilfe welcher Potenziale das Unternehmen die Ziele erreichen möchte.
Mithilfe der Differenzierungsstrategie möchte das Unternehmen Wettbewerbsvorteile erlangen, indem es vom Kunden aufgrund bestimmter Produkt-, Marken- oder Unternehmenseigenschaften als einzigartig wahrgenommen wird.
Mithilfe der Kostenführerschaftsstrategie möchte das Unternehmen auf den Märkten einen Preisvorteil als Wettbewerbsvorteil erreichen.
Um die Frage beantworten zu können, mit welchen Strategien die gewünschten Ziele erreicht werden können, braucht es die Marktforschung. Sie hat die Aufgabe, das Kaufverhalten von Privatpersonen, Unternehmen und anderen Institutionen zu analysieren und die Umweltbedingungen in Makro- und Mikroumwelt zu erforschen, die das Unternehmen beeinflussen.
Die konkrete Umsetzung der Marketing-Strategien wird im Operativen Marketing geplant und umgesetzt. Hierzu gehören alle Instrumente, die zum Zwecke des Marketings von Unternehmen eingesetzt werden können und in ihrer „Mischung“ als Marketing-Mix bezeichnet werden. Die Einteilung, die in Wissenschaft und Praxis am häufigsten verwendet wird, ist die Struktur der „vier P’s“, die der amerikanische Betriebswirt McCarthy formuliert hat:
Die Produkt- und Programmpolitik (product) umfasst alle Entscheidungen, welche die Gestaltung des Leistungsprogramms eines Unternehmens betreffen. In diesen Bereich fallen z.B. die Analyse, Planung und Umsetzung von Produktveränderungen und Serviceleistungen, die Forschung und Entwicklung neuer Produkte, die Produktvariation und Produktdifferenzierung, die Verpackungsgestaltung, die Gestaltung flankierender Serviceleistungen sowie die Zusammenfassung der Produkte zu einem Produktprogramm mit teilweise einheitlichen Merkmalen.
Im Rahmen der Preis- und Konditionenpolitik (price) werden alle Bedingungen festgelegt, die dazu dienen, die (monetären) Gegenleistungen der Käufer für die von einem Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu gestalten und durchzusetzen. Zur Preispolitik gehören die Festlegung der Preise, Entscheidungen über Preisstrategien und Preisdifferenzierungen. Zur Konditionenpolitik zählen sämtliche Vereinbarungen, die neben dem Preis im Vertrag über das Leistungsangebot festgehalten werden. Im Wesentlichen sind das Rabatte, Boni und Skonti, Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie Kredit- und Leasingvereinbarungen.
Bei der Distributionspolitik (place) geht es um die Gestaltung der akquisitorischen und der physischen Distribution, bei der entschieden wird, auf welchem Wege der Kunde rechtlich und tatsächlich an das Produkt gelangen soll. Zentral sind die Fragen, welche Distributionsorgane für den Vertrieb der Sachgüter und Dienstleistungen eingesetzt werden, welche und wie viele Absatzwege genutzt werden und welches der optimale externe und interne Standort ist.
Die Kommunikationspolitik (promotion) umfasst alle Maßnahmen, die der Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen aktuellen und potenziellen Kunden, aktuellen und potenziellen Mitarbeitern, Lieferanten, Investoren, Anwohnern und anderen Bezugsgruppen (sog. Stake-Holders) dienen. Zu diesem Zweck werden die klassischen Instrumente Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch innovative Instrumente, die von Sponsoring und Product-Placement über Direktmarketing bis hin zu Viralem Marketing und Ambush-Marketing reichen, eingesetzt.
Neben den 4 P's wird häufig heute noch ein weiterer Bereich, die Markenpolitik (Branding) abgetrennt, der Instrumente aus allen vier Bereichen enthält und deswegen als Querschnittsbereich gesehen werden kann. Die Markenpolitik beschäftigt sich mit der Gestaltung von Marken.
In den letzten Jahrzehnten wurden neben den klassischen vier Instrumentenbereichen noch weitere P-Felder formuliert, die sich jedoch in Theorie und Praxis (mit Ausnahme von People (Personal) im Dienstleistungssektor) kaum etablieren konnten, sondern stattdessen in die vorhandenen Felder eingeordnet werden. Hierzu zählen:
Packaging (Verpackung)
Physics (Unternehmensidentität)
Physical Evidence (Ladengestaltung)
Politics (Einflussnahme von Unternehmen auf die Politik durch Lobbyismus)
Position (Positionierung des Unternehmens und seiner Leistungen)
Processes (Prozessmanagement)
Public Voice (Kommunikation in Blogs, Communities und über Multiplikatoren)
Der letzte Schritt in der Marketing-Konzeption nach der Durchführung von Marketing-Maßnahmen ist das Marketing-Controlling, das dieselben Aufgaben wie das Controlling in der Unternehmensführung hat und den Kreislauf der Marketing-Konzeption schließt, indem es die Formulierung der Marketing-Ziele, des Strategischen Marketings und des Operativen Marketings beeinflusst.
Der verschärfte Wettbewerb, ein sich veränderndes Konsumentenverhalten und der technologische Fortschritt stellen den Erfolg eines Unternehmens und damit die Marketingleistungen des Managements in immer kürzer werdenden Zyklen auf den Prüfstand. Dazu braucht es ein funktionierendes Marketing-Controlling.
1.5Prüfungstipps
Welchen Prüfungstipp kann ich aus diesem Abschnitt ziehen?
In Prüfungen wird häufig gefordert, das Marketing allgemein zu definieren und Unterarten zu benennen konkrete Beispiele für die Unterarten des Marketings zu nennen den Unternehmensregelkreis oder den Marketing-Regelkreis grafisch darzustellen die Systematik des Marketing-Mixes zu erläutern.