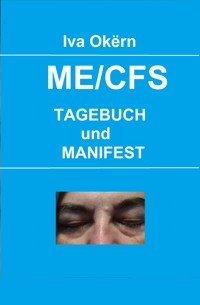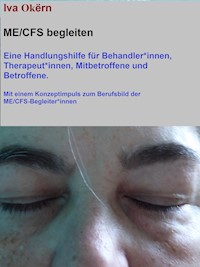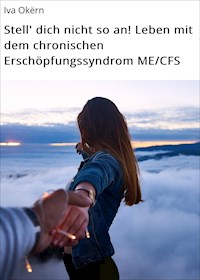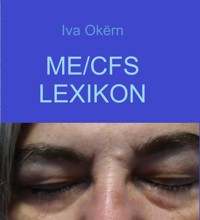
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die multisystemische Erkrankung ME/CFS, deren Fälle seit der Corona-Pandemie stark ansteigen, ist kaum erforscht; ihre Ursache liegt im Dunkeln. Immer noch kennt sich das Personal unseres Gesundheits- und Sozialsystems zu wenig mit der Erkrankung aus - mit teils katastrophalen Folgen für die meist hausgebundenen oder bettlägerigen Patient*innen. ME/CFS beschneidet die Lebensqualität aller Betroffenen extrem, isoliert sie und lässt sie aus der Öffentlichkeit verschwinden. Dieses Lexikon soll Interessierten als eine erste Informationsquelle dienen. Es soll die Not der an ME/CFS leidenden Menschen vor Augen führen, die lange genug ungehört um Hilfe gerufen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Iva Okërn
ME/CFS Lexikon
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Aus Not ein Lexikon. Vorbemerkung
A (wie Autoimmun-erkrankungen, zu denen ME/CFS gehört)
B (wie Bett – ME/CFS-Betroffene müssen die meiste Zeit liegen)
C (wie chronisch – ME/CFS ist eine chronische Erkrankung)
D (wie Diskriminierung, der ME/CFS-Betroffene ausgesetzt sind)
E (wie Energie, die ME/CFS-Betroffenen fehlt)
F (wie Forschung, die die Betroffenen einfordern)
G (wie G93.3, der ICD10-Code von ME/CFS)
H (wie hausgebunden – der Lebensstatus der meisten ME/CFS-Betroffenen)
I (wie Immunsystem-Defekt – mögliche Ursache der ME/CFS)
J (Jahrelanges Leiden, das einer ME/CFS-Diagnose oft vorangeht)
K (wie K.O.-Virus, eine von vielen diskriminierenden Bezeichnungen für ME/CFS)
L (wie Lebensqualität, die ME/CFS-Betroffenen fehlt)
N (wie die neuroimmunologische Erkrankung ME/CFS)
O (wie Ohnmacht, die ME/CFS angesichts politischer Untätigkeit fühlen)
P (wie PENE, das Hauptmerkmal der ME/CFS)
Q (wie Quadratur des Kreises – ME/CFS scheint für das Gesundheitssystem eine solche unlösbare Aufgabe zu sein)
R (wie Rettung der Betroffenen durch Forschung und adäquate Versorgung)
S (wie somatisch – ME/CFS ist eine somatische Erkrankung)
T (wie Tragödien, die hinter den Einzel-schicksalen stehen)
U (wie Unkenntnis, die leider bei vielen Mediziner*innen über ME/CFS besteht)
V (wie Versorgungsnotstand)
W (wie wirtschaftlicher Schaden, der langfristig entsteht, wenn ME/CFS-Patientinnen nicht angemessen versorgt werden)
Y (wie Yuppie-Grippe, diskriminierende Bezeichnung für ME/CFS)
Z (wie Zuversicht, die allen ME/CFS-Betroffenen zu wünschen ist)
Anhang: Texte, die passen
Literatur
Autorin
Impressum neobooks
Aus Not ein Lexikon. Vorbemerkung
Wie die Betroffenen und Mitbetroffenen, aber auch viele Angehörige gesundheitlicher Berufe wissen, gibt es bisher nur wenige gesicherte Erkenntnisse über die postvirale, multisystemische und somatische Erkrankung ME/CFS.
Die Erkrankung ist kaum erforscht, was nicht etwa an der Bereitschaft der Wissenschaftler*innen, sondern der Verfügung über Forschungsgelder liegt; es fließen aktuell zu wenig Gelder in Forschungen und Studien, obwohl vorsichtige Einschätzungen von inzwischen ca. 500.000 Betroffenen in Deutschland ausgehen, wobei die Zahlen seit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 exponentiell ansteigen und die Dunkelziffer entsprechend hoch ist.
Das Profil der Erkrankung ist demnach noch lückenhaft. Ihre Ursache ist nach wie vor unbekannt; Biomarker wurden bislang nicht so eindeutig identifiziert, um die Erkrankung mittels Laborbefundung nachzuweisen. Daher kommt es häufig zu Fehleinschätzungen der Erkrankung und oft kontraproduktiven Therapieversuchen, basierend auf unzureichenden Informationen über ME/CFS. Akuthilfen wie spezielle Rehaeinrichtungen, Aufklärung von Hausärzt*innen und dringend angezeigte medizinische Fortbildungsangebote geschehen eher unsystematisch und sind quantitativ unzureichend.
Dabei kann ME/CFS inzwischen relativ sicher und unkompliziert diagnostiziert werden; es gibt weltweite Studien, Guidelines und Empfehlungen, was den Patient*innen hilft, nicht zuletzt ein enormes Wissen über ihre Behandlung und Pflege von den Betroffenen und Mitbetroffenen selbst, das die Medizin für sich abschöpfen könnte - würde sie nur wollen.
Lediglich zwei Kliniken in Deutschland sind verlässliche Anlaufstellen für Betroffene: die Berliner →Charité, an der das Team rund um Frau Professor Carmen Scheibenbogen über die Erkrankung forscht und sich engagiert für ME/CFS-Betroffene einsetzt, und das Klinikum der Technischen Universität München, wo sich das interdisziplinäre Team um Frau Professor Uta Behrends um an ME/CFS erkrankte Kinder und Jugendliche kümmert und für das Wohl aller Betroffenen eintritt.
Hier und da in Deutschland praktizieren Mediziner*innen, die sich in ihren Praxen auch auf ME/CFS spezialisiert haben, aber angesichts der Betroffenenzahlen und der Einzugsgebiete, die es abzudecken gälte, sind viel zu wenige Ärzte* und Ärztinnen* mit dieser schweren Erkrankung vertraut, vor allem viel zu wenige Hausärzt*innen - bei einem Krankheitsverdacht stets die ersten Ansprechpartner*innen.
Die meisten Betroffenen – und das ist, um es auch an dieser Stelle deutlich auszusprechen, ein gesellschaftlicher Skandal – bleiben medizinisch und sozialgesundheitlich unversorgt bzw. unterversorgt. Mehrheitlich übernehmen Familienmitglieder die Versorgung der Kranken. Zu der Erkrankung, die ca. 60% der Betroffenen in die Berufsunfähigkeit und ungefähr 20% in die Bettlägerigkeit treibt, kommen gesellschaftliche Stigmatisierung, Ausgrenzung, Existenznot und finanzielle Sorge.
Die Betroffenen und Mitbetroffenen finden lediglich in →Betroffenenvereinigungen wie der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS oder Fatigatio e.V. (Bundesverband ME/CFS) Informationen und Unterstützung, sowie in den entsprechenden Foren und Communitys der sozialen Medien. Die Literatur über ME/CFS ist spärlich, zumal für medizinische und biomedizinische Laien.
Nach dem Motto - das die Betroffenen zur Genüge kennen - sich selbst zu helfen, habe ich mich dazu entschlossen, ein erstes Lexikon über ME/CFS zu erstellen.
Wir Betroffene müssen uns nämlich unsere Informationen mühsam selbst zusammensuchen und begegnen dann oft unbekannten Kürzeln und Begriffen.
Ich wünsche mir, dass dieses schmale Nachschlagewerk die Erstinformation sowohl für die Erkrankten als auch für Fachkräfte und Studierende sozialer und medizinischer Berufe etwas erleichtert.
Zugleich verdeutlicht das Lexikon noch einmal, welcher enorme Handlungsbedarf besteht und was für eine schwere Erkrankung ME/CFS ist, für die es bisher keine Heilung gibt, nur die Beschwerden lindernde Therapien.
Für mich als Pädagogin und Philosophin, gleichwohl interessiert an den Naturwissenschaften, ist die Medizin ein relativ fremdes Terrain, darauf möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich hinweisen: ich schreibe als Betroffene.
Und ich bitte gleich um Entschuldigung für Rechtschreibe- sowie Flüchtigkeitsfehler, die geschehen können, wenn →Schmerzen, Konzentrationsschwäche, Wort-findungsprobleme und →Vigilanzstörungen (→brainfog) und so weiter einem das Leben schwer machen.
Ich danke dem Biomedizintechnologen und der Biomediziner*in von Herzen, die mir beim Redigieren der Artikel unter die Arme gegriffen haben! :)
Münster, Dezember 2023
PS: In meinem ersten Buch habe ich eine Kontaktmöglichkeit angegeben, um Betroffene weitergehend zu unterstützen; das wurde zweckentfremdet und so musste ich bedauerlicherweise die Kontaktoption abbrechen – es tut mir aufrichtig leid für diejenigen, die sich nun vergeblich mit Ratsuche oder konstruktiver Kritik an mich gewendet haben.
A (wie Autoimmun-erkrankungen, zu denen ME/CFS gehört)
AAI
Atlanto-axiale Instabilität.
Instabilität der ersten beiden Halswirbel (Atlas und Axis). Ist der Übergang zum Schädel mitbetroffen, handelt es sich um →CCI.
AAI kann eine Begleiterscheinung von →ME/CFS sein.
Siehe auch →HWS.
AAk-Wert
Autoantikörper-Wert.
Autoantikörper sind Immunglobuline, die sich gegen den eigenen Körper richten. Die Bestimmung ihrer Art und Höhe dient der Diagnostik verschiedener Autoimmunerkrank-ungen.
Bei ca. 30% der ME/CFS-Patient*innen sind Autoantikörper im Spiel. Bei der Diagnostik sollte daher der AAk-Wert bestimmt werden.
Siehe auch: →IgE, →IgG4
Abakteriell
Krankheiten, als deren Verursacher keine Bakterien nachweisbar sind werden als ‚abakteriell‘ bezeichnet. Diese Erkrankungen sind stattdessen häufig von →Viren bedingt.
Lange galten nur Viren als Auslöser von →ME/CFS. Mittlerweile ist bekannt, dass auch Bakterien wie Borrelien (→Lyme), Legionellen, Coxiellen und Chlamydien, wenn sie Infektionen mit schweren Verläufen auslösen, verantwortlich für →ME/CFS sein können.
Abduktoren
Abduktoren sind die Muskeln, die zur Bewegung vom Körper weg benötigt werden: den Arm seitlich nach außen zu bewegen, die Beine seitlich abzuspreizen.
Manchmal zeigt sich zeitweilig bereits bei leichter →ME/CFS eine beeinträchtigte Leistung der Abduktoren. Das kann als Frühwarnzeichen für eine mögliche ME/CFS-Erkrankung gedeutet werden.
Siehe auch: →Muskulatur
Abwaschung
Indem der Körper oder einzelne Körperteile in kreisenden Bewegungen feuchtkalt oder lauwarm abgewaschen werden, wird der Kreislauf angeregt.
Für ME/CFS-Betroffene ohne Beteiligung von →Fibromyalgie kann das eine Wohltat sein.
Acetylcholin
Acetylcholin ist ein Neurotransmitter. Er vermittelt zwischen Nerven und Muskeln. Seine Hauptfunktion ist die motorische Kontrolle.
Adaption
Dt.: Anpassung
Der Organismus passt sich ständig an die wechselnden Umweltbedingungen an, um in →Homöostase, in Balance zu bleiben. Dazu benötigt der Körper viel →Energie.
Bei ME/CFS-Betroffenen mangelt es an der Energiebereitstellung, daher gelingt die Anpassung ihres Organismus an äußere Reize wie z.B. Licht, Lärm und Temperatur oft nicht oder kaum.
Siehe auch: →Reizverarbeitung, →Stress, →Temperaturempfinden.
Adaption ist zudem ein soziologischer und psychologischer Begriff und meint die Anpassung des Menschen an seinen Lebensraum und -ereignisse.
Oft wird ME/CFS-Erkrankten von behandelnden Psychologen oder Psychotherapeuten eine Anpassungs-störung zugewiesen. Das heißt, ein belastendes Lebensereignis kann nicht bewältigt werden, der Betreffende kann dem seinen Gemütszustand und/oder sein Sozialverhalten nicht anpassen.
Die →Diagnose Anpassungsstörung (→ICD 10-F43.2) ist vielfach eine Verlegenheitsdiagnose, wenn die somatische Erkrankung →ME/CFS nicht als solche erkannt wird.
Adipositas
Als Adipositas, Fettleibigkeit, wird schweres Übergewicht verstanden, das über einem →BMI von 30 liegt.
Da bei →ME/CFS gleich mehrere Körpersysteme wie z.B. der Metabolismus betroffen sind, kann es zu starker Gewichtszunahme oder -abnahme kommen, die nicht durch eine veränderte, ungesunde Ernährungs-weise zu erklären sind.
Siehe auch: →Ernährung.
Adynamie
Extreme Muskelschwäche, Kraft- und Antriebslosigkeit.
Ätiologie
Ursache.
Auf den Vermerk „unbekannter Ätiologie“ stoßen ME/CFS-Betroffene häufig in ihren ärztlichen Unterlagen. Die Ursache für die Erkrankung ist noch nicht zufriedenstellend geklärt.
Akustik-Stellwand
Ein flexibler Schallschutz.
ME/CFS-Betroffene sind geräusch-sensitiv. Die →Reizverarbeitung im Gehirn kostet →Energie, die der Körper eines ME/CFS-Betroffenen u.U. nicht zur Verfügung hat. Der Körper reagiert dann mit Belastungssymptomen wie Kopfschmerzen, Erschöpfung und Myalgien oder deren Verstärkung. Einige Betroffene entwickeln in der Folge Misophonien (Hass auf bestimmte Geräusche).
Viele Betroffene nutzen daher Kapsel- oder Stöpsel-Gehörschutz, um die Hörreize zu minimieren.
An Orten, an denen kaum Schallschutz besteht, empfiehlt sich der Einsatz einer Akustik-Stellwand, z.B. im Mehrbett-zimmer eines Krankenhauses zwischen den Betten positioniert, oder hinter der Wohnungstür/ vor Wohnungsfenstern.
Aktivierung
Während es bei vielen Erkrankungen wie z.B. nach einer Krebserkrankung oder bei einer →Depression angezeigt ist, die Patient*innen in behutsamen Schritten zu aktivieren, um eine gesundheitliche Verbesserung zu erreichen, ist eine Aktivierung der ME/CFS-Betroffenen kontraproduktiv, in vielen Fällen sogar schädigend. Der →multisystemisch angegriffene Körper von ME/CFS-Erkrankten reagiert mit extremer Erschöpfung und →Symptomen wie Lähmungs-erscheinungen, plötzlichem →Blut-hochdruck und starken →Schmerzen auf Aktivierungsversuche, die die Belastungsgrenze der Betroffenen überschreiten.
Die Belastungsgrenze ist individuell verschieden. Behandelnde Mediziner* innen und Therapeut*innen müssen gemeinsam mit dem Betroffenen dessen Grenzen ausloten und unbedingt wahren. Der Körper eines ME/CFS-Erkrankten benötigt vor allem Pausen, Ruhe- und Entspannungs-phasen. Eine sich steigernde Aktivierung respektiert diese überlebenswichtigen Ruhephasen nicht.
Es ist ME/CFS-Betroffenen vorge-worfen worden – und wird ihnen trotz besseren Wissens immer noch vorgeworfen -, dass sie inaktiv seien und sich aus nicht ersichtlichen Gründen jeder Aktivierung verweigerten.
Dem ist entgegenzuhalten, dass Vergleiche der Lebenswege Betroffener ergaben, dass es sich bei ihnen mehrheitlich um vor ihrer Erkrankung sehr aktive, beruflich wie privat engagierte, kreative, leistungswillige und -starke Persönlichkeiten handele. Es fehle keineswegs an mangelndem Willen, sich zu bewegen und aktiv zu sein, sondern am körperlichen Unvermögen, ausreichend →Energie bereitzustellen.
Das körperlich evozierte Ruheverlangen der Betroffenen, das Drängen des Körpers, unnötigem Energieverlust vorzubeugen, ist aktuell ihre einzige Überlebenschance.
Akuthilfe
Wenn bei Patient*innen der Verdacht auf →ME/CFS besteht, weil sie ihre Hausärztin/ ihren Hausarzt aufgrund von dauerhafter Erschöpfung, Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit nach Aktivität und →Schmerzen aufsuchen und in der Vergangenheit bereits durch mehrere Infektions-krankheiten, auf Parasitenbefall und/oder →Allergien behandelt wurden, dann muss sofort gehandelt werden:
die Patient*innen brauchen so-fort absolute Ruhe über längere Dauer, liegend
sie sollen Reize wie Lärm und starkes Licht vermeiden
sie müssen auf das →Pacing hingewiesen werden
sie müssen gegen Schmerzen medikamentös versorgt werden.
Allergien
ME/CFS-Betroffene weisen eine höhere Neigung zu Allergien und Erkrankungen des →Immunsystem wie Neurodermitis auf.
Wie viele andere Körpersysteme ist auch die Funktion des →Immunsystems bei einer →ME/CFS gestört.
Allgemeines Krankheitsgefühl
Ein Symptom der Erkrankung, die schon sehr früh im Verlauf der Krankheit als eines der ersten →Symptome beschrieben wird, ist ein allgemeines, nicht näher bestimmbares Krankheitsgefühl. Die Betroffenen fühlen sich abgeschlagen und ähnlich wie am Beginn einer Erkältung oder Grippe.
Allodynie
Allodynie bezeichnet eine gesteigerte Schmerzempfindlichkeit.
Schon geringfügige Reize, z.B. taktile Reize (Berührungen), lösen starke →Schmerzen aus. Das liegt an einer fehlgesteuerten →Reizverarbeitung wie es bei vielen ME/CFS-Patient*innen der Fall ist und an einer subjektiven Wahrnehmung von Schmerz.
Die wenigsten ME/CFS-Betroffenen ertragen z.B. →Massagen oder auch physiotherapeutische Anwendungen, denn sie sind u.U. mit Schmerzen verbunden und können die →baseline überschreiten.
Alltag
Menschen mit →ME/CFS können aufgrund ihrer engen Belastungs-grenzen meist nicht, bzw. nicht vollständig am Alltagsleben teilhaben. Selbst für nur leicht oder moderat Betroffene werden schon die alltäglichsten Handlungen, wie zum Beispiel die Morgenroutine, zu einer Herausforderung, die überbelasten und die →Symptome verstärken kann.
Die Betroffenen versuchen in den Anfangsstadien der Erkrankung, ihren Alltag möglichst lange aufrecht zu erhalten.
Meistens verzichten sie zunächst auf jede Freizeitgestaltung und schränken ihr Privatleben drastisch ein, um all ihre Kraft und →Energie für ihre →Arbeit (und Familie) aufzuwenden. Möglicherweise leisten sie ihren Vollzeitberuf, können danach aber nichts anderes mehr tun, als zu liegen, unter →Schmerzen und mit allen anderen Symptomen der Erkrankung. Es gibt eindrucksvolle Schilderungen von Erkrankten, deren Leben sich auf die sich wiederholende Formel ‚Morgenroutine-Frühstück-Arbeit-→Crash‘ bringen lässt.
Mit Hilfe des →Pacings können Erkrankte ihre individuellen Belastungsgrenzen einhalten, Über-belastung vermeiden und einen diesen Grenzen drastisch angepassten ‚Alltag‘ bewältigen. Das bedeutet je nach Schweregrad, das Arbeitspensum zu reduzieren oder auf Null zu bringen, kräftezehrende Aktivitäten einzu-schränken, abzugeben und neue Prioritäten zu setzen.
Oft erleichtern schon kleinste Veränderungen den Alltag, wie zum Beispiel ausreichende Ruhe-möglichkeiten auch im Treppenhaus, Flur oder Bad (das zur Metapher gewordene Zähneputzen im Sitzen) oder schwere, licht- und geräuschdämmende Vorhänge vor den Fenstern und viele andere →Hilfsmittel.
Anästhesie
ME/CFS-Patient*innen reagieren stark auf die Anästhesie, die für ihren Körper eine Belastungssituation darstellt. Sie wachen bspw. schwerer aus einer Narkose auf, ihr Blutdruck ist länger erhöht usw. ME/CFS-Patient*innen müssen intensiver überwacht werden als andere Patient*innen.
Eine Narkose kann zu einem →Crash führen. Daher ist der Zustand der Patient*innen nach einer Anästhesie länger zu beobachten als üblich. Diese Patient*innen brauchen noch Tage nach der Narkose absolute →Ruhe, am besten in schallgedämpften und abgedunkelten Einzelzimmern.
ME/CFS-Patient*innen sind in der Regel Allergiker. Es kann vorkommen, dass sie sich über eine →Allergie gegen bestimmte Anästhetika nicht bewusst sind. Anästhesisten sollten unbedingt darauf vorbereitet sein.
Anamnese
Eine aufmerksam und sorgfältig durchgeführte Anamnese ist für die Diagnosestellung →ME/CFS von großer Bedeutung.
Haus- und Familienärzt*innen sollten bei den folgenden Hinweisen eine ME/CFS in ihre diagnostischen Überlegungen mit einbeziehen:
Patient*innen berichten von körperlicher Erschöpfung und Abgeschlagenheit nach Aktivitäten.
Die Erschöpfung tritt auch bei positiv empfundenen Aktivitäten auf (Ausschlussindiz: →Burn-out).
Patient*innen berichten von häufigen Infektionen, →Aller-gien, Unverträglichkeiten, bzw. sind damit schon öfter vorstellig geworden.
Die Betroffenen klagen über Muskel-, Gelenk- und/oder Knochenschmerzen, lokal wechselnd und von unterschiedlicher Intensität und Qualität.
Die →Symptome werden nicht mit Angst in Verbindung gesetzt (Ausschlussindiz: →Angst-störung).
Es werden Zustände wie: Sehprobleme, Wahrnehmungs-schwierigkeiten,→Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen und Reizempfindlichkeit beklagt.
Es fällt, so oder ähnlich, der Satz: „Ich will/möchte gerne dies und jenes, aber ich kann/schaffe es körperlich nicht.“ (Optimistische, motivierte Grundhaltung; Ausschlussindiz: →Depression).
ME/CFS geht mit einer Vielzahl verschiedener Symptome einher, die angemessen bewertet werden müssen; aktuell wird von bis zu 60 Symptomen gesprochen.
Angststörung
Oft wird die →ME/CFS mit einer Angststörung verwechselt, da auch eine Angststörung →Symptome wie unkontrollierte →Schweißausbrüche, →Schlafstörungen, →Erschöpfung, Herzrhythmusstörungen usw. mit sich bringen kann.
Patient*innen mit Angststörungen haben jedoch ein Bewusstsein ihrer Angst, bzw. diese wird im Laufe einer psychologischen Therapie erkannt und steht im Vordergrund des Leidenden.
Zur ME/CFS-Symptomatik gehört kein im Fokus stehendes Angstgefühl.
Angehörigen-Schulung
Den Angehörigen der Betroffenen kommt eine wichtige Rolle zu: sie sind die derzeit einzigen verlässlichen Versorger der Erkrankten.
Auf den Angehörigen ruht die Last der →Pflege und oft sind sie damit ganz auf sich gestellt. Aus skandalöser und beschämender Unkenntnis über die Erkrankung kommt es regelmäßig zu Fehlentscheidungen bei der Zuerkennung von Pflege- und Schwerbehinderungsgraden. Die Probleme u.a. einer nicht auf →ME/CFS zugeschnittenen →Rehabilitation ziehen Schwierig-keiten bei der Beantragung von Erwerbsminderungsrenten nach sich. Letzten Endes tragen die Angehörigen nicht nur die pflegerische, sondern auch die finanzielle Belastung allein.
Hier benötigen die Angehörigen dringend Beratung und Unterstützung, nicht nur wie bisher von Seiten der →Selbsthilfeorganisationen, sondern von staatlichen Organen ausgehend.
Der Umgang mit den Erkrankten ist nicht einfach, zumal es weder wirksame Therapien noch Medikamente gibt; das macht die pflegenden Angehörigen noch hilfloser und ist eine enorme psychische Belastung. Der Druck, der auf ihnen lastet, kann sich in verbalen und physischen Aggressionen gegen die Erkrankten äußern. Beleidigungen und Vorwürfe wie „Stell‘ dich nicht so an“, „Du musst nur wollen“ etc. können die Beziehung zwischen den Angehörigen und dem Erkrankten nachhaltig stören, was wiederum Konsequenzen für den Gesundheitszustand und die →Lebensqualität der Erkrankten nach sich zieht – neben den körperlichen Leiden kommen die psychischen Quälereien, denen der Erkrankte meist wehrlos ausgeliefert ist. Nicht zuletzt sind es Beziehungskonflikte, die ME/CFS-Erkrankte in den Suizid führen.
Angehörige brauchen deshalb eine Schulung über die Erkrankung und den angemessenen Umgang mit ihren erkrankten Familienmitgliedern; sie benötigen ihrerseits Ansprech-partner*innen bei Konflikten und Schwierigkeiten; sie benötigen Reflexionshilfe und, ganz wichtig, sie brauchen Entlastung und dürfen nicht allein gelassen werden.
Siehe auch →Fürsorgepflicht.
Anis
Pimpinella anisum
Das pflanzliche Heilmittel wirkt krampflindernd, ebenso wie Arnika.
Anistee ist bei Krämpfen der Rumpf-Muskulatur empfehlenswert.
Anorexia nervosa
Anorexie ist eine Essstörung: die Betroffenen nehmen über die Nahrung so wenig →Energie wie möglich auf, aus Angst, dick zu werden.
Anorexia nervosa betrifft vor allem weibliche Jugendliche. Es kann zu Verwechselungen mit →ME/CFS kommen, wenn Mädchen/junge Frauen mit →ME/CFS kaum noch in der Lage sind zu kauen und zu schlucken und u.a. aus diesem Grund stark abnehmen und viele Speisen vermeiden. In einer aufmerksamen Anamnese kann jedoch deutlich werden, dass Menschen mit ME/CFS essen würden, wenn sie kräftemäßig und körperlich dazu in der Lage wären.
Aphasie
Das Unvermögen zu sprechen.
Wenn die Sprech- oder Atemmuskulatur zu schwach ist, kann Sprache nicht mehr oder nur noch unverständlich produziert werden.
Sind sie erschöpft, wird die Sprache der Betroffenen undeutlich und verwaschen. Manchmal äußern sie sich unzusammenhängend, ähnlich wie Schlaganfallpatient*innen.
Apherese
Die Apherese ist eine Blutreinigung, bei der überzählige und krankmachende Stoffe aus dem Blut oder dem Blutplasma gewaschen werden.
Dabei wird das Blut (Plasma) durch die Armvene über ein Schlauchsystem in das Filtergerät geführt und das gereinigte Blut (Plasma) dem Körper wieder zugeführt.
Wenn bei ME/CFS-Patient*innen erhöhte Antikörper im Blut festzustellen sind, kann es eine Therapieoption sein, die Antikörper auszuwaschen.
Arbeit
60% der Betroffenen sind aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigungen arbeitsunfähig. Wir sprechen hier von aktuell ca. 500.000 Erkrankten in D. Seit der Corona-Pandemie steigt die Zahl der Betroffenen stetig. Zukünftig, so prognostizieren Biologen und Virologen, werden wir verstärkt mit virusverursachten Pandemien zu rechnen haben. Was die Zahlen jetzt schon für eine wirtschaftliche Bedeutung haben und in Zukunft haben werden, kann sich jeder vorstellen. Der volkswirtschaftliche Schaden durch →ME/CFS ist immens. Es besteht daher dringender Forschungsbedarf.
Von den ca. 40% der noch arbeitsfähigen Betroffenen kann der größte Part aufgrund der starken Beeinträchtigungen nur in Teilzeit arbeiten. Eine Work-Life-Balance besteht für diese Arbeitnehmer nicht, denn sie konzentrieren die wenige ihnen zur Verfügung stehende Kraft auf ihre Arbeit.
Aus Sorge, dass ihnen ihre Be-einträchtigungen oder Fehlzeiten als Unmotiviertheit ausgelegt werden, überbelasten sich die werktätigen ME/CFS-Betroffenen oftmals und geraten dadurch in einen Teufelskreis ihrer Erkrankung. Aus Angst vor Kündigung und Existenzsorge geben viele von ihnen ihre Be-hinderung/→Schwerbehinderung nicht bekannt.
Arbeitgeber sind gehalten, Be-lastungsspitzen für den ME/CFS-erkrankten Mitarbeitenden zu vermeiden, z.B. durch →Homeoffice-Tage, Stundenreduktion, Schicht-dienstverbot, Vermeiden von Mehrarbeit, individuelle und flexiblere Arbeitsplatzgestaltung, Rekreations-tage, digitale Alternativen wie Videokonferenzen usw. ME/CFS-Betroffene sind in der Regel sehr kreative und engagierte Mitarbeitende; ihnen mangelt es weder an Motivation noch Wille, es fehlt ihnen nur an körperlicher Leistungskraft.
Das Verhältnis Arbeit und ME/CFS bedarf dringend der sozial- und gesellschafts-wissenschaftlichen Auf-arbeitung!
Aromatherapie
In der Aromatherapie werden ätherische Öle zur Linderung von Beschwerden und zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt. Sie ist Bestandteil der →Phytotherapie.
Aromatherapien sollten aufgrund ihrer entspannenden Wirkung in ein auf ME/CFS-Betroffene zugeschnittenes →Rehabilitation—Konzept aufge-nommen werden, allerdings unter der strikten Maßgabe, dass sie mit geruchssensiblen Betroffen abge-sprochen werden muss, da die olfaktorischen Reize (Geruchsreize) die Belastungsgrenze bei einigen Erkrankten übersteigen kann.
Wenn geruchsunempfindlichere ME/CFS-Betroffene über die Möglichkeit verfügen, sollten sie sich ein Kräuterbeet oder Kräutertöpfe im Garten oder auf dem Balkon gönnen. Die Düfte der →Heilkräuter wirken beruhigend; die Kräuter können in der Küche, als Tees oder Aufgüsse Verwendung finden. Empfehlenswerte Kräuter sind: →Huflattich, →Lavendel, →Melisse, →Rosmarin, Thymian und →Quendel.
Arthrose
Bei einer Arthrose verändert sich die Knorpelschicht, die die Knochen-gelenke umgibt; sie wird rau, reibt sich ab und kann sich schließlich völlig auflösen. Das nun ungeschützte Gelenk schmerzt stechend und versteift.
Dauerhafte Überbelastung der Gelenke, Fehlstellungen, Alter und Übergewicht können eine Arthrose auslösen.
Arthrose gehört zur Ausschluss-diagnostik bei →ME/CFS, wenn die Betroffenen sehr über Gelenk-schmerzen klagen,
Arthrose unterscheidet sich von ME/CFS dadurch, dass bei ME/CFS nicht nur die Gelenke betroffen sind. Eine Arthrose kann als Komorbidität zu ME/CFS auftreten.
ASMR
Autonomous Sensory Meridian Response.
Ein angenehmes Kribbelgefühl bei entspanntem Wohlbefinden.
Für ME/CFS-Betroffene von Selten-heitswert.
ASS
ASS steht für: Acetylsalicylsäure.
Das Medikament mildert →Schmerzen und Entzündungen. Es kann Teil einer →Schmerztherapie bei →ME/CFS sein, die ärztlich verordnet, begleitet und kontrolliert werden muss.
Ataxie
Ist eine Störung der Bewegungs-koordination, verursacht durch Störungen des Nervensystems.
Die Bewegungen vieler ME/CFS-Erkrankter sind zumindest in der →PENE verlangsamt und steif.
ATP
Adaptive Pacing Therapy.
Eine Strategie, den Alltag an das eigene Befinden und die Körperkraft anzupassen, um Überbelastung zu vermeiden. Dazu gehört das Symptommanagement, d.h. der Umgang mit den →Symptomen mit dem Ziel, diese abzumildern, z.B. eine →Schmerztherapie bei →Schmerzen.
Adenosintriphosphat.
ATP (ein Molekül) liefert die →Energie für die →Muskulatur. Es wird in den →Mitochondrien, den Energie-kraftzellen des Körpers aus der Nahrung und Fetten gebildet.
Es gibt deutliche Hinweise, dass die ATP-Bereitstellung bei ME/CFS-Erkrankten gestört ist.
Aufrichthilfen
Selbst bei einer leichten →ME/CFS haben die Betroffenen Schwierigkeiten, sich aus der Liege- oder Sitzposition aufzurichten, zumal dieser Bewegungsablauf häufig Lagerungs-schwindel auslöst. Aufrichthilfen wie zum Beispiel Bettgalgen oder Katapultsitze gehören zu den notwendigsten Hilfsmitteln.
Augenringe
Dunkle Augenringe und eine blasse Gesichtshaut gehören zum typischen Erscheinungsbild ME/CFS-Kranker.
Die dünne Haut unter dem Auge zieht sich zudem bei Erschöpfung häufig in winzigen Fältchen zusammen (Papierhaut). Manchmal zuckt diese dünne Haut. Dafür sind die vielen Muskeln rund ums Auge verantwortlich, die krampfen oder stark erschlaffen können (→Faszikulation) – Muskelkrämpfe oder -schwäche sind starke →Symptome einer ME/CFS.
Autofahren
Auch wenn es von der Körperkraft her noch möglich sein sollte und die Medikation es erlaubt: ME/CFS-Erkrankte sollten gut abwägen, ob sie nicht konsequent auf das Autofahren (Fahrzeugführen) verzichten wollen.
Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ein Höchstmaß an Konzentration und →Vigilanz; das Steuern eines Fahrzeugs beansprucht die →Muskulatur, vom Sehmuskel bis hin zu den Fuß- und Zehenmuskeln. Es gibt ME/CFS-Betroffene, die nach wenigen Minuten Fahrzeit nicht mehr in der Lage sind, das Lenkrad zu halten oder deren Beinmuskulatur plötzlich erschlafft und reaktionsschnelles Bremsen oder Beschleunigen unmöglich macht.
Autofahrenden ME/CFS-Betroffenen fällt ihre beginnende Erkrankung oft durch Konzentrationsschwierigkeiten im Straßenverkehr auf, wobei es zu Fahrfehlern aus Unachtsamkeit kommen kann.
Betroffene fordern auch deshalb die Anerkennung einer →Schwer-behinderung mit dem Kennzeichen G.
autogenesTraining
Durch mentale Selbstbeeinflussung und verschiedene Bewegungs- und Haltungs-Übungen wird versucht, sich zu entspannen, den Puls zu senken und die Atmung zu beruhigen.
Ziel des autogenen Trainings ist es, Puls und Blutdruck abzusenken, regelmäßig ruhig zu atmen, Spannungen z.B. in der →Muskulatur zu lösen, sich zu konzentrieren und neu zu orientieren.
Autogene Trainings gehören unbedingt in ein Rehabilitationskonzept zu →ME/CFS.
Das autogene Training wurde durch den Nervenarzt Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) entwickelt.
Autosuggestion
Selbstüberredung.
In begrenzter Weise können körperliche und seelische Vorgänge durch Überredung (Suggestion) beeinflusst werden.
Mithilfe der Autosuggestion versuchen viele ME/CFS-Erkrankte, ihr Alltags- und/oder Arbeitsleben so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.
Avatar
Künstliche Person/Figur.
Kinder und Jugendliche mit moderater und →severer →ME/CFS sind nicht in der Lage, am Schulunterricht vor Ort teilzunehmen.
Ein Schulavatar (Telepräsenzroboter) ermöglicht ihnen und anderen chronisch kranken Kindern und Jugendlichen, von zuhause aus am Schulalltag teilzunehmen.
Der Roboter sitzt mit in der Klasse, überträgt per Kamera und Lautsprecher den Unterricht und reagiert auf Bewegungen im Raum, während am anderen Ende das erkrankte Kind am Tablet den Unterricht verfolgen und sich über Lautsprecher beteiligen kann (Fragen stellen, Antworten geben).
AWMF
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-lichen Medizinischen Fachgemein-schaften e.V.
Die Arbeitsgemeinschaft entwickelt in D die medizinischen →Leitlinien. Dabei orientiert sie sich auch an den Leitlinien anderer Staaten, z.B. dem →NICE in Großbritannien, das über einen sehr hohen Qualitätsstandart verfügt.
Axilla
Dt.: Achselhöhle.
Durch die Achselhöhle verlaufen viele Nerven, Gefäße und Lymphgefäße. ME/CFS-Betroffene berichten von schmerzenden Achselhöhlen – die Lymphe kann sich stauen und schmerzhaft anschwellen.
Siehe auch: →Lymphdrüsen.
B (wie Bett – ME/CFS-Betroffene müssen die meiste Zeit liegen)
B12
Vitamingruppe, die über Fleisch- und Fischnahrung aufgenommen wird.
B12 ist nicht nur wichtig für die Zellteilung, sondern auch für das Nervensystem: es bildet und repariert Schäden an der Nervenhülle, der sog. Myelinscheide. Störungen des Nervensystems können auf einen Vitamin B12- Mangel zurückzuführen sein.
Vitamin B12 stärkt und beruhigt die Nerven; bei vielen ME/CFS-Betroffenen bewirken B12-Injektionen (trotz ‚normalen‘ B12-Wertes) eine Milderung des →brain-fog.
B12 ist außerdem bei der Melatoninregulation beteiligt. Es wirkt also auf den Schlaf-Wach-Rhythmus.
Da sich viele ME/CFS-Betroffene aufgrund der Entzündungsproblematik fleischlos ernähren, sollte zusätzlich B12 aufgenommen werden.
Bäder
Vielen Betroffenen sind warme Bäder angenehm bei Gelenk- und Muskelschmerzen. Moor- und Solebäder werden empfohlen.
Bei der Temperierung ist auf das oft irritierte →Temperaturempfinden der Erkrankten zu achten.
Bei den Badezusätzen ist die Geruchssensitivität vieler Betroffener zu beachten. Parfümierte/stark duftende Bäder eigenen sich daher nicht für ME/CFS-Patient*innen.
Baldrian
Valerian officinalis
Baldrian ist ein pflanzliches Heilmittel bei Schlaflosigkeit und →Unruhe.
Barfuß
Barfußlaufen ist nicht nur gut zur Stärkung der Fuß- und Zehenmuskulatur (bei →ME/CFS dringend notwendig), sondern hat eine ganzheitliche Wirkung auf die Wahrnehmung, die →Reizverarbeitung und wirkt außerdem beruhigend.
Zu einer →Reha bei ME/CFS gehört das Barfußlaufen (für Patient*innen, die noch gehfähig sind) über einen Barfußparcour. Es muss dabei vor allem auf die entspannende Wirkung gesetzt werden, nicht auf eine →Aktivierung der Betroffenen.
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit meint den ungehinderten Zugang zur gesellschaftlichen →Teilhabe, ohne dafür fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Barrierefreiheit kann räumlich sein, zum Beispiel Rampen für Rollstuhlfahrer, oder Blindenleit-systeme, oder auch im Einsatz einfacher Sprache bestehen u.v.m.
ME/CFS-Betroffene sind in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe fast völlig eingeschränkt. Ihre Barriere beginnt außerhalb der eigenen vier Wände, bzw. außerhalb ihres Bettes.
Barrierefreiheit für ME/CFS-Betroffene heißt, ihnen die notwendigen Hilfsmittel wie z.B. Elektrorollstühle zu gewähren, digitale Unterstützung wie freien Internetzugang oder →Avatare anzubieten und Hilfe bei wichtiger Kommunikation (z.B. Ämter, Versicherungen) zu geben, da die kognitiven Einschränkungen zuweilen Verständnisschwierigkeiten hervor-rufen. (Lebens)wichtige Barrierefreiheit für ME/CFS-Betroffene sind →Hausbesuche der behandelnden Mediziner*innen und Therapeut*innen. ME/CFS-Kranke bräuchten eine spezielle Begleitung, die über Alltagshilfe hinaus geht (→ME/CFS-Begleiter*innen).
Bartholinsche Drüsen
Die Drüsen an den großen Schamlippen der Frauen sorgen bei sexueller Erregung für Sekretabsonderungen, um die Scheide zu befeuchten.
Bei →ME/CFS kann auch das Drüsensystem in Mitleidenschaft gezogen sein; das betrifft vor allem die →Lymphdrüsen, die bartholinschen Drüsen und die Bauchspeicheldrüse.
Die →Libido der ME/CFS-Betroffenen ist gestört. Mit ein Grund ist die Scheidentrockenheit bei ME/CFS-Patient*innen.
Die bartholinschen Drüsen sind nach ihrem Entdecker, dem Anatomen Caspar Bartholin (1655-1738) benannt.
baseline
Unter ‚baseline‘ wird die individuelle Belastungsgrenze eines ME/CFS-Betroffenen verstanden.
Im →Selbstmanagement (→Pacing) muss herausgefunden werden, wo diese Belastungsgrenze liegt und wie vermieden werden kann, sie zu überschreiten, um nicht zu viel →Energie und Kraft zu verlieren.
Batterie
Um ihre Erkrankung zu erklären, greifen die Betroffenen auf die Batterie als Metapher zurück.