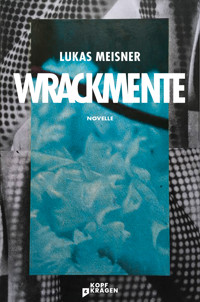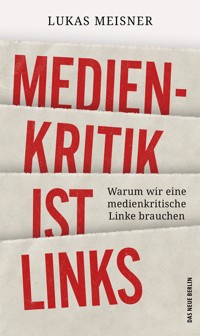
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Wut gegen das System ist als gerechtfertigt anzuerkennen – nämlich, um sie von links zu fundieren statt von rechts zu instrumentalisieren.« In festgefahrenen Positionen und versteifter Polemik befangen, offenbart sich die heutige Debattenkultur als handfeste Krise der Öffentlichkeit. In seinem Buch »Medienkritik ist links« bricht Lukas Meisner mit dem Schweigen der Linken. Er zeigt nicht nur die Risiken pauschaler Dämonisierung der Leitmedien als »Lügenpresse« auf, sondern weist nach, warum die Verunglimpfung jeglicher Medienkritik als »rechtspopulistisch« nicht weniger demokratiegefährdend ist. Er macht klar: Was lange fehlte und was es wieder braucht, ist eine medienkritische Linke, die – anders als rechtes Geplärr – im Sinne der Demokratie und nicht gegen sie vorgeht; die aber – anders als Liberale – gerade den gesellschaftlichen Rechtsruck historisch-materialistisch als Ausdruck ökonomischer Krisen erkennt. Diese politische Streitschrift erhebt die Stimme für eine linke Medienkritik und ist Beleg dafür, warum es eine medienkritische Linke braucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lukas Meisner
Medienkritik ist links
Warum wir einemedienkritische Linkebrauchen
Das Neue Berlin
Über das Buch:
Die heutige Mediendebatte kennt zwei Lager. Während die Medienkritiker vor allem rechte Polemik entfalten, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, reagieren liberale Medienhäuser mit vorauseilender Verhöhnung jeglicher Kritik. Was weithin fehlt, ist eine linke Positionierung. Inwiefern dies mit der grundsätzlichen Krise der Linken zusammenhängt, ergründet Lukas Meisner. Der wiedererstarkende Nationalismus bietet Anlass genug, neu bewusst zu machen, dass allein die Linke – als emanzipatorische, antirassistische, solidarische – die Stimme der Mehrheit vertritt. Ernstzunehmende Kritik am Hegemonialen muss von jenen ausgeübt werden, die sie auch mit diesen Idealen verbindet. Darauf zielt dieses Plädoyer für die inhaltliche Rückeroberung einer vormals klassisch-linken Kernkompetenz. Medienkritik als Systemkritik, d. h. Kapitalismuskritik!
Über den Autor:
Lukas Meisner, geboren 1993, studierte Philosophie, Soziologie und Komparatistik in Tübingen, Berlin und London. Anschließend promovierte er zur kritischen Theorie u. a. am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien. Zur Zeit lehrt er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Neben Büchern publizierte er in Literatur- und Fachzeitschriften sowie Anthologien.
»Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden materiellen Verhältnisse; also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft.«
– Karl Marx, Die deutsche Ideologie (1846)
»Zu jedem Zeitpunkt gibt es eine Orthodoxie, eine Reihe von Ideen, von denen man annimmt, dass alle vernünftig denkenden Menschen sie fraglos akzeptieren werden. Es ist nicht unbedingt verboten, dieses oder jenes zu sagen, aber es ist ‚nicht angebracht‘, es zu sagen, so wie es in der Mitte des viktorianischen Zeitalters ‚nicht angebracht‘ war, in Gegenwart einer Dame von Hosen zu sprechen. Jeder, der die vorherrschende Orthodoxie in Frage stellt, wird mit überraschender Effektivität zum Schweigen gebracht.«
– George Orwell, The Freedom of the Press (1945)
»Das Faktum, dass die radikale Linke keinen gleichen Zugang zu den großen Informations- und Indoktrinationsketten hat, ist weitläufig verantwortlich für ihre Isolierung.«
– Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt (1972)
»Wenn die Linke schwach ist oder von den Mainstream-Medien und kapitalistischen politischen Parteien daran gehindert wird, sich politisch zu äußern, wird die Wut der Bevölkerung von anderen zum Ausdruck gebracht, die bereit sind, das System anzugreifen. Gegenwärtig sind diese anderen die extremen Rechten.«
– Jodi Dean, Neofeudalism: The End of Capitalism? (2020)
»Der Aufbau einer pluralen, weder Konzerneigentümer*innen noch dem Staat verpflichteten Medienlandschaft wäre eine zentrale Voraussetzung für eine egalitäre Verteilung politischer Macht.«
– Raul Zelik, Wir Untoten des Kapitals. Über politische Monster und grünen Sozialismus (2021)
Inhalt
I. Einführung: Warum die Linke medienkritisch sein muss – und Medienkritik links
Die Mär vom Linkssein der Medien
Linke Medienkritik und der Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus
Linke Medienkritik statt rechter Verschwörungsmythologie
II. Vom Linken und Allzulinken – Zur Substantialisierung eines Begriffs
Links ist nicht alles, was sich so nennt: Interventionen
Für eine mutige Linke
Eine (ideen-)geschichtliche Einordnung: Postmoderne als Privatisierung des Politischen
Jenseits des Identitätsprinzips
Gegen Wagenknechts Scheinalternative
Die ganz große Koalition gegen die Linke als Blaupause der AfD
Plädoyers für eine neueste Linke: Kritischer Marxismus und demokratischer Sozialismus
Vom Universalismus der 99 %
Von Intersektionalität zu Totalität
Emanzipatorische Vernunft und rationale Gesellschaft
Marx als Pionier des Postkolonialismus und der Ökologie
Erst Postmangel wäre Postwachstum
III. Linke Medienkritik in und an der Krise der Öffentlichkeit
Die Krise der klassischen Öffentlichkeit: Eingriffe in die Grammophonmentalität massenmedialer Leitmedien
Die Krise der Öffentlichkeit
Vom Für und Wider des Zweifels
Deutsche Öffentlichkeit zwischen Desorientierung und Polarisierung
Zur Kritik des reinen Ressentiments
Linke Medienkritik im Kriegszustand
Privatisierte Öffentlichkeit und veröffentlichte Privatheit: Sozialisation durch unsoziale Medien und die Propagandaabteilungen des Marktes
Vom Divide et Impera der Neo-Öffentlichkeit
Das Medium als frohe Botschaft
Die Öffentlichkeitsarbeit der Privatisierung: Werbung und Mode
IV. Schluss: Linke Medien- als marxistische Ideologiekritik
Post-Theorie und Neo-Mythologie: Verschwörungstheorien sind Postmoderne fürs Volk
Die Alternative: Kritische Marxistische Theorie
Zur exemplarischen Hegemonie des Antikommunismus
Für eine neueste Linke jenseits der Krise der Öffentlichkeit
Anhang:
I. Einführung: Warum die Linke medienkritisch sein muss – und Medienkritik links
Die Mär vom Linkssein der Medien
Weit ist die Vorstellung verbreitet, dass Medien, Kulturbranche und Wissenschaftsbetrieb dieser Tage links seien, dass die letzten Jahre also eine linke Hegemonie heraufgezogen sei, der sich zu widersetzen kaum noch wem gelinge. Diese Vorstellung ist eine Entstellung und eine Mär. Selbst wenn es stimmt, dass Leitmedien inzwischen weitaus weniger homophob und misogyn berichten als ehedem, dass Preise im Kultursektor häufiger als früher zu jenen fliegen, die sich mit Identitätspolitik einen Namen machen oder dass der Genderstern für viele Publikationen mittlerweile verpflichtend ist, reicht all das eben noch nicht hin zum Linkssein. Eher schon und besser lässt es sich als linksliberal einordnen. Auch Linksliberale aber sind Liberale. Linksliberale jedoch sind keine Linken, weil es streng genommen keine linken Liberalen gibt. Das Substantiv frisst hier das Adjektiv. Die beiden sind nicht zu vereinen. Warum, ist einfach zu erklären.
Mit Karl Marx wissen wir, dass der Liberalismus die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft und damit die der besitzenden über die besitzlosen Klassen ist. Darauf werden wir im Verlauf des Buches zurückkommen, denn daran hat sich nichts verändert. Verändert hat sich, dass heute auch Frauen, People of Colour, Queere und andere marginalisierte Personen teils häufiger bis in Machtpositionen vorrücken können als früher. Das ist löblich, nur bleibt es innerhalb des Kapitalismus und damit innerhalb eines patriarchalen und kolonialen Systems, weshalb es einzig unter Ausklammerung struktureller Zusammenhänge als feministische oder antirassistische Errungenschaft beansprucht werden kann. Hinter der paradigmatischen Leitkultur, die diese Zusammenhänge mehr verschleiert als aufdeckt, stecken die allgemein bekannten Ideale der Meinungsfreiheit, der Chancengleichheit, der Leistungsgerechtigkeit und des Minderheitenschutzes. Diese Ideale haben teils viel Gutes, doch spiegeln auch sie nicht linke, sondern liberale Werte wider. Die primäre Funktion liberaler Werte aber bleibt de facto, das kapitalistische System mittels scheinmoralischer Deko zu beschönigen. Solche ästhetische Rechtfertigung des Unrechtmäßigen sollten Linke nicht unwidersprochen mittragen. Und das nicht, weil sie etwas gegen Moral haben, sondern weil sie das Ornament, das systematisch Verbrechen verschleiert, nicht als wahr, gut oder schön beglaubigen und absegnen sollten.
Was aber ist der inhaltliche Unterschied zwischen linken und liberalen Werten? Linke gehen über liberale Werte weit hinaus, weil sie deren kapitalistische Formatierung zurückweisen, was sie wiederum dazu befähigt, auch über den Kapitalismus selbst hinauszuwachsen. Statt lediglich Meinungsfreiheit, Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Minderheitenschutz ist dann zu fordern: Freiheit nicht nur der bis ins Wirkungslose atomisierten Meinung, sondern ein übers Ganze wirksames Mitsprechen und Mithandeln aller; wirkliche und folglich insbesondere ökonomische Gleichheit der Menschen untereinander und nicht bloß die meritokratisch relativierte ihrer sogenannten Chancen; Gerechtigkeit weniger gegenüber dem disziplinierenden Leistungs- und Performanzprinzip als gegenüber den Bedürfnissen realer Lebewesen in all ihrer Verletzlichkeit und Angewiesenheit; und substanziell demokratische Durchsetzung der Interessen der Mehrheit bei gleichzeitigem Schutz der Minoritäten statt Ignoranz gegenüber ersteren unter dem Deckmantel der Verteidigung letzterer.
Dabei lässt sich durchaus vertreten, dass diese linken Ideale liberale Phrasen ernst und beim Wort nehmen und sie so aus ihrer ideologischen Einebnung befreien wollen, um wirklich den Menschen und nicht gegebenen Strukturen und ihren Profiteur*innen zu dienen. Engels hatte die Arbeiter*innenklasse im 19. Jahrhundert als neues progressives Subjekt dem Bürgertum auch deshalb gegenübergestellt, weil das Bürgertum die Gesellschaft um seine eigenen Errungenschaften prellte. Marx zeichnete im Detail nach, wie der Schein der Verwirklichtheit bürgerlicher Ideale über das jenen Idealen widersprechende Sein des Produktionszusammenhangs hinwegtäuscht, indem sich der liberale Blick in den oberflächlichen Wundern des Konsums verfängt. Erst also, wenn hier Schein und Sein politisch zusammengeführt würden, ließen sich linke Ideale auch in der Basis und damit jenseits ihrer ideologischen – liberal eingehegten – Funktion verwirklichen.
Insofern enthält der rechtspopulistische Vorwurf, dass der Liberalismus Heuchelei sei, einen Wahrheitskern. Was er verschweigt, um sich zu verlautbaren jedoch, ist seine eigene Heuchelei. Während er sich als der Rächer der Gerechten aufspielt, ist er nur die Rache der Regelgerechten und als solche synonym mit Entrechtung durch Selbstgerechtigkeit. Rechtes und liberales Gemüt mögen sich stark unterscheiden – rechter und liberaler (Un-)Geist ähneln sich umso mehr. Zwar reproduziert der Rechtspopulismus nicht das Selbstverständnis oder den Habitus des Liberalismus, dafür aber viele seiner Prämissen und besonders die Bandbreite dessen, was er verschweigt. Gemeinsam verschwiegen wird das zentrale Anliegen der Linken, nämlich die soziale Frage der politischen Ökonomie mitsamt ihrer Substantialisierung des Freiheits- und Gleichheitsideals. Dieses Anliegen wird von Rechten bloß anders verschoben und verdreht, versteckt und verdeckt als von Liberalen. Statt die soziale Frage anzugehen, hetzt die Rechte den »kleinen Mann von der Straße« zur Scheinvendetta gegen die Schwächsten und damit die größten Opfer des Bestehenden auf, während die Liberalen ihm eine Moralpredigt dazu halten, sich nicht verführen zu lassen, sondern sein schweres Los demütig zu ertragen. Indem sie den Kapitalismus als Grund allen Übels gemeinsam unberührt lassen, kommen Rechte und Liberale kurzum zusammen. Darum befinden sie sich in einer Wahlverwandtschaft. Diese Wahlverwandtschaft von rechten und liberalen Paradigmen ist es, welche die kapitalistische Infrastruktur trotz ihrer oberflächlich-politischen Widersprüche eint. Dass Kirchen durch ein Schisma getrennt sind, heißt schließlich nicht, dass sie soziologisch nicht dieselbe Funktion ausübten. So viel ökumenische Religionskritik sollte sich die Linke wieder zutrauen gegen den Schein verfeindeter Konventionen.
Die Kirche des Kapitals teilt sich aktuell vor allem in zwei Glaubensgemeinschaften auf, nämlich ins wirtschaftsliberal-eigentümelnde bis linksliberal-identitätspolitische Lager auf der einen und ins konservativ-bornierte bis rechtsextrem-misanthropische Lager auf der anderen Seite. Ein ernstzunehmend linkes Lager indessen fehlt weitläufig. Die Vorstellung, dass die heutige Medienlandschaft, die heutige Kulturbranche, der heutige Wissenschaftsbetrieb links seien, ist damit die genaue Verkehrung der Wirklichkeit. Wer Gegenteiliges behauptet, müsste mittlerweile davon sprechen, dass das Militär links sei, weil es trotz Uniform diverser werde, oder dass der Kapitalismus links sei, weil er die Regenbogenflagge fürs Image hisse. Dergleichen festzustellen wäre allerdings so widersinnig wie kontrafaktisch.
Das vorliegende Buch wird nachweisen, dass, wer etwa glaubt, deutsche Leitmedien oder die Partei der Grünen oder die SPD seien heutzutage links, objektiv genauso irrt wie alle, die meinen, eins und eins ergäben nicht zwei. Links, Mitte und Rechts nämlich sind nicht willkürlich ausfüllbare leere Worthülsen, sondern begrifflich eindeutige Orientierungshilfen politischer Urteilskraft. Diese Rationalität politischer Begriffe müssen wir in ihrer inhärenten Bedeutung verteidigen schon, da sie unser einziger Kompass in einer Welt sind, die zu sprachlos macht, um mit den eigenen Reaktionsweisen noch adäquat umgehen zu können. Wenn die Verteidigung der Rationalität politischer Begrifflichkeit diesem Buch gelingt, dann wird sich leicht feststellen lassen, dass und warum Medien, Kultur und Wissenschaft heutzutage in weiten Teilen eben nicht links, sondern eher dessen Gegenteil sind. Genau aber, weil sie nicht links sind, werden jene Wähler*innen, die über keine ausgefeilten Bewährungsstrategien kognitiver Dissonanz verfügen, in politische Obdachlosigkeit gezwungen. Hierin in erster Linie liegt der Erfolg der Rechten, die den Liberalen den Stab aus der Hand nehmen, um ans selbe Ziel zu gelangen. Nur mit noch mehr Verheerung auf dem Weg dorthin.
Linke Medienkritik und der Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Übergang des Laissez-faire- in den Monopolkapitalismus gerieten die bürgerlichen Ideale der Individualität, Pluralität und Autonomie in eine Krise, sodass linke Medienkritik bereits auftreten musste, um liberale Werte gegen ihr eigenes Wirtschaftssystem und dessen technologische Neuerungen in Stellung zu bringen. Zeitgleich mit dem Aufkommen der Massenmedien ist linke Medienkritik zudem auf die Bühne getreten, um die Massen gegen die Medien und die kritische Öffentlichkeit gegen das Monopol zu verteidigen. In diesem Sinn fragt linke Medienkritik von Anbeginn, ob sich die demokratiezersetzende Massenpsychologie des Faschismus ohne das Medium des Volksempfängers und ob sich der Massenkonsumismus des Fordismus ohne die Medienwelt Hollywoods je derart hätten durchsetzen können. Die Antwort lautet: Nein, da zwischen beiden Phänomenen, d. h. zwischen Monopolkapitalismus und Faschismus einerseits und zwischen Massenproduktion bzw. -konsumption und Massenpsychologie andererseits, eine unterschwellige Kontinuität festzustellen ist. Diese Kontinuität hoben Denker wie Max Horkheimer oder Antonio Gramsci früh hervor, woran wir kürzlich noch einmal durch Wolfgang Schivelbuschs These von der »entfernten Verwandtschaft« zwischen New Deal und Nationalsozialismus erinnert wurden. Karl Kraus hat besagte Kontinuität in seiner Dritten Walpurgisnacht ohne Rücksichtnahme auf die liebsten Fiktionen liberaler Selbstinterpretation auf den Punkt gebracht mit der These, dass nicht nur die Medien von den Nazis gleichgeschaltet wurden, sondern dass die Nazis ohne massenmediale Breitenwirkung bis in die Wohnzimmer des Reichs nie an die Macht gekommen wären. »Denn der Nationalsozialismus hat die Presse nicht vernichtet, sondern die Presse hat den Nationalsozialismus erschaffen. Scheinbar nur als Reaktion, in Wahrheit auch als Fortsetzung.« (Kraus 1989, 307.) Dieser zweite Teil der Wahrheit wird von Seiten bürgerlicher Deutungen für gewöhnlich unterschlagen. Das ändert aber nichts daran, dass das faschistische »Ornament der Masse« (Kracauer) nie von oben herab hätte collagiert werden können ohne massenmediale Choreografie. Tatsächlich sind die amorphen Massen zur selben Zeit entstanden wie die hilflos Vereinzelten. Die beiden Phänomene bilden damit eine kapitalistische Dialektik, die erst vermittelt wird über das Zusammenspiel von massenweise entfremdeter Arbeit und massenpsychologisch angekurbeltem Konsum. So ohnmächtig verloren nämlich die Vereinzelten sind, so einfach lenkbar sind sie als Masse.
Solange Individuum und Gesellschaft nicht wirklich demokratisch vermittelt werden, weil die Sphäre der Privatheit politisch außen vor bleibt, so lange gibt es beide nicht im emphatischen Sinn. Die atomisierten Privaten sind lediglich Privatisierte einer monadologisierten Masse (»lonely crowd«), die erst massenmedial wirklich Kontur annimmt. Wenn es aber stimmt, dass es einen doppelten Zusammenhang gibt zwischen Kapitalismus und Faschismus wie zwischen Faschismus und Massenmedien, dann ist die erste und wichtigste Forderung linker Medienkritik die nach Medien, die den Faschismus zu verhindern suchen, indem sie dessen Geburtshelfer – den Kapitalismus – in ihren Berichten, Analysen und Kommentaren klar benennen. Wenn das gegebene Feld der Medien diesen Geburtshelfer dagegen strukturell unerwähnt lässt, dann muss linke Medienkritik dieses Feld für jenes fahrlässige Verschweigen scharf kritisieren. Andersherum hat aber auch die Linke medienkritisch zu sein, und zwar schon, weil sie sonst keine Mehrheiten gewinnen kann, um über besagten Kausalnexus von Kapitalismus und Faschismus auch realpolitisch hinauszugelangen. Wollte sie hingegen nicht medienkritisch sein, um diese Mehrheiten zu gewinnen, müsste sie agitatorisch, propagandistisch oder anderweitig manipulativ statt rational verfahren, um Menschen für sich einzunehmen. Sofern die Linke jedoch auf das demokratische Mündigkeitsprinzip und damit auf paritätische Teilhabe setzt, kommt sie nicht darum herum, fundamentale Medienkritik als intrinsischen Bestandteil ihrer dringlichsten Aufgaben zu begreifen.
Bezeichnenderweise steht Medienkritik jedoch seit einigen Jahren unter dem Generalverdacht, ausgerechnet rechts und autoritär zu sein. Diesen Verdacht äußert insbesondere das rechts- bis linksliberale Gros der Leitmedien. Jener leitmediale Mainstream nimmt sich selbst und insbesondere die bürgerliche Presse aus dem Fadenkreuz der Kritik, indem er – zirkulär wie sonst nur die Bibel – Medienkritik als per se illegitim zurückweist. Schließlich sei Medienkritik, die doch über viele Dekaden Sparte linker Ideologiekritik war, im Eigentlichen ein bloß rechtes Verschwörungsnarrativ (Stichwort: »Lügenpresse« als Unwort des Jahres 2014). Diese Unterstellung ist eine Absurdität, die ihresgleichen sucht. Kurt Tucholskys, Heinrich Bölls oder Rudi Dutschkes Kritik an dem, was sie mitunter Journaille nannten; das Kulturindustriekapitel aus der Dialektik der Aufklärung ebenso wie die Studien zur Hegemonie aus Antonio Gramscis Gefängnisheften; Jürgen Habermas‘ Strukturwandel der Öffentlichkeit, Hans-Magnus Enzensbergers Spitzen gegen die »Bewusstseinsindustrie«, Guy Debords Texte gegen die Gesellschaft des Spektakels oder Noam Chomskys Manufactering Consent sind allesamt glänzende Beispiele linker Medienkritik. Jene Beispiele verdeutlichen erneut das soeben bereits erläuterte Argument, warum Medienkritik notwendig und warum sie notwendigerweise links ist: nämlich, damit liberale Imagepflege nicht in rechten Bildersturm umschlagen muss. Wer Medien – also nicht nur die Presse, sondern auch Radio, Fernsehen und Kino, Werbung, Mode, Internet und all ihre Formate – von links kritisiert, tut dies darum nicht gegen, sondern für die Demokratie. Jedoch für eine solche Demokratie, über die nicht mehr marktkonform vorentschieden wird, sondern die ans eigene deliberative Ideal noch heranreichen möchte.
Politikverdrossenheit und Populismus sind selbstverständlich ein Problem, doch dafür ist das bürgerliche Establishment mindestens so sehr verantwortlich wie seine selbsternannten Alternativen von rechts. Dasselbe Establishment erklärt uns derweil in vollendeter Auto-Immunisierung, dass die Verantwortung für Politikverdrossenheit und Populismus nur die Demagog*innen der politischen Extreme trügen, keinesfalls aber es selbst. Führen wir zur Widerlegung dieser Behauptung zwei willkürlich ausgewählte Beispiele der letzten Jahre ins Feld. Wer etwa mitbekommen hat, wie der systematische Sozialstaatsabbau der rot-grünen Koalition Anfang bis Mitte der 2000er leitmedial als Sachzwang dargestellt wurde, als zwingender Schluss, der aus Globalisierung bzw. Standortwettbewerb und demographischem Wandel bzw. Überalterung der Gesellschaft zu folgen hatte, der wird all jene, die sich das Populäre nicht gar so leicht als populistisch ausreden lassen wollen, ausgesprochen gut nachvollziehen können. Und wer die Jahre darauf erlitten hat, wie Die Linke (also der organisierte Widerstand gegen die Agenda 2010) seit ihrer Gründung von allen privaten Sendern und dem sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskreditiert wurde, um ein ernsthaft linkes Bündnis mit Regierungsverantwortung nachhaltig zu verhindern – und das ausgerechnet, indem der Partei abgesprochen wurde, Regierungsverantwortung zu übernehmen, bloß weil sie nicht in den Krieg ziehen oder den Sozialstaat verabschieden wollte –, der wird mit Bürger*innen, die im Angesicht dessen politikverdrossen wurden, recht deutlich mitempfinden können. Vor allem aber wird, wer diese Manöver als linksbewegter Mensch erlebte, linke Medienkritik an den Leitmedien und an deren bürgerlicher Presse als notwendige Bedingung gerade gegen Politikverdrossenheit und populistischen Defätismus betrachten müssen. Denn die heutige Gesellschaft, speziell in ihrem fundamentalen Rechtsruck, ist zu einem hohen Grad das Ergebnis der systematischen – auch medialen – Verdrängung linker Alternativen bei gleichzeitiger Verschärfung kapitalinduzierter Krisen.
Linke Medienkritik statt rechter Verschwörungsmythologie
Wie eingangs zitiert, hat uns Marx die Einsicht vermittelt, dass die herrschende Meinung der Meinung der Herrschenden und insbesondere der herrschaftlichen Meinung meistens recht nahekommt. Andererseits gibt es eine Differenz zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung, d. h. zwischen leitmedial ausgedrückten und statistisch nachweisbaren Haltungen in der Bevölkerung. Dennoch stehen letztere unter dem Gestaltungswillen ersterer. Linke müssen bereits deshalb medienkritisch sein, weil die berechtigte Kritik an der veröffentlichten Meinung und ihrem Abweichen von der öffentlichen Meinung so wenig den Rechten überlassen werden darf wie die nicht minder berechtigte Kritik an »denen da oben«. Andernfalls entsteht mehr und mehr der falsche Eindruck, dass die einzige (Schein-)Opposition eine rechte wäre. Dann aber wählt das Volk rechts, zwar gegen seine eigenen Interessen, doch ausgestellt als vermeintlich oppositionellen, im Eigentlichen selbstzerstörerischen Denkzettel ans Establishment. Die legitime Wut, die nachvollziehbare Enttäuschung, die Verweigerung der Bürger*innen allerdings ist nicht abzulehnen, sondern links zu besetzen, rational zu fundieren und politisch zu substantialisieren. Um dazu in der Lage zu sein, ist die grundsätzliche Differenz zwischen linker und rechter Medienkritik klar hervorzuheben.
Während das rechts konnotierte Kampfwort »Lügenpresse« weltumspannende Verschwörungen geeinter Eliten wittert, die grundsätzliche Problemlage zu Hintermännern im Dunkeln personifiziert und somit Minderheiten paranoid dämonisieren muss, analysiert linke Medienkritik die anonymen Strukturen und objektiven Interessen der bestehenden gesellschaftlichen Formation inklusive ihrer Widersprüche sowie den dialektischen Zusammenhang von Basis und Überbau, um deren innere Verflechtungen theoretisch fundiert nach außen zu kehren und so als praktisch veränderbar darstellen zu können. Während die Rechte ihr grenzenloses Misstrauen auf eine ihres Erachtens geschlossene Welt projiziert, wirbt die Linke für eine rettende Kritik affektiver, selten nur unberechtigter, wenngleich oft fehlgeleiteter politischer Reaktionen auf diese Welt in ihrer fatalen, jedoch nicht fatalistischen Beschaffenheit.
Linke Medienkritik hält sich darum zurück mit Allaussagen wie der, dass die Presse lüge, als hätte man es mit einem bündigen Block zu tun, der als durchprogrammierter Leviathan agiere und, nur sich selbst transparent, die Menschheit hinters Licht führe. Auch gibt es für linke Medienkritik keine »Verschwörung«, zumindest wenn Verschwörung nicht als das eine profane Gemisch aus Dummheit, Konformität und Vetternwirtschaft verstanden werden soll, das letztlich hinter den meisten Erfolgen steckt. Linke Medienkritik weiß stattdessen, dass es weder Murdochs und Berlusconis bräuchte noch Bertelsmann und Springer, wo schon das Fähnchen im Wind hinreicht zur tendenziellen Homogenisierung des Meinungsbilds im öffentlichen Raum. Insbesondere aber braucht es dafür keine Steuerung von oben, sondern lediglich Immersion in der eigenen Ingroup. Journalist*innen stehen darum keinesfalls als geschlossene Klientel gegen die Mehrheitsgesellschaft, sondern müssen ihrerseits gegen eine Front an Gatekeeper-Opportunismus ankämpfen; nicht zuletzt, weil ihre Kolleg*innen und Chef*innen das offiziell geteilte Ethos des kritischen Journalismus mit Füßen treten. Denn die öffentliche Meinung, von der abzuweichen letztere sich fürchten, ist zu verstehen als veröffentlichte, welche zwar vom Großteil des Medienbetriebs geteilt werden mag, darum aber längst nicht vom Großteil der wahlberechtigten Bevölkerung, noch von allen Publizierenden. Was gemeinhin als Krise der Öffentlichkeit bezeichnet wird, hat ihren Hintergrund also nicht zuletzt in dem weit verbreiteten Mangel an Mut, sich seines eigenen Verstandes auch öffentlich zu bedienen und ihn nicht an den Nagel zu hängen, sobald Widerspruch im eigenen Milieu zu erwarten ist.