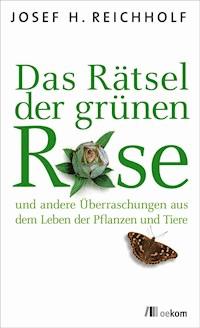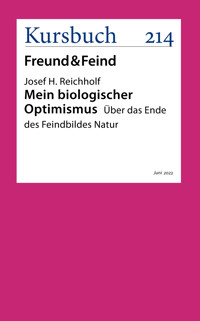
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Kursbuch 214 widmet sich sowohl den widersprüchlichen Romantiken von Freundschaft als auch den differenzierten Abgründen von Feindschaft. Aktueller könnte ein Thema fast nicht sein. Das Denken in Freund-/Feind-Schemata ist auf der Tagesordnung zurück, mit all seinen Untiefen, seinen Risiken, seinen normativen Implikationen und seinen Konsequenzen. Der Biologe Josef H. Reichholf, nimmt »feindliche« Antagonismen in der Natur in den Blick. Das biologische Wesen Mensch gehört in diese Reihe – und trotz allem formuliert Reichholf in einer positiven Grundstimmung: »Ob die Menschheit zur kosmischen Katastrophe wird und damit die Menschenzeit, das Anthropozän, erdgeschichtlich charakterisiert, sei dahingestellt. Warnende Anzeichen gibt es genug. Den Menschen als ›sapiens‹ zu bezeichnen, war voreilig. Aber möglich ist es, dass die Trennung von Freund und Feind überwunden, die Menschheit friedlicher und in ihrer Einwirkung auf den großen Rest der Natur moderater wird. Das ist zugegebenermaßen (m)ein ›biologischer Optimismus‹.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 25
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Josef H. ReichholfMein biologischer OptimismusÜber das Ende des Feindbildes Natur
Der Autor
Impressum
Josef H. ReichholfMein biologischer OptimismusÜber das Ende des Feindbildes Natur
Cave canem
Damit warnten die alten Römer Fremde vor ihren gefährlichen Hunden, die sich ihren Besitzungen näherten. Jahrtausende davor schon wachte »der Menschen bester Freund«, verbellte Fremde und knurrte sie drohend an, so sie es wagten, näher zu kommen. Dieses Verhalten ist uns so geläufig, dass kaum jemals darüber nachgedacht wird, warum es so ist und weshalb die Sonderung von Freund (= vertraut) und Feind (= fremd) in der Hund-Mensch-Beziehung ganz von selbst zustande kommen konnte.
Die verhaltensbiologische Erklärung klingt einfach und überzeugend: Der Hund überträgt als Abkömmling des Wolfes dessen familiäres Gruppenverhalten auf die Menschen, bei denen er lebt. Er schafft sich gleichsam eine eigene Familie aus Personen, denen er sich zugehörig fühlt und die er unter Einsatz des eigenen Lebens bereit ist zu verteidigen. Doch diese Differenzierung von Freund und Feind fällt bei weitem nicht so klar aus, wie es sich begrifflich anhört. In subtiler Form bezieht der Hund ihm bekannt gewordene Personen mit ein, akzeptiert ihr Kommen, lässt sie passieren, achtet aber darauf, dass alles seine Richtigkeit hat, und spielt unter Umständen mit den Gästen. Zwischen zugehörig, vertraut und fremd entsteht ein Kontinuum. Scharf grenzt der Hund in der Regel nur die Menschen seiner Kernfamilie, die den Zugehörigen zum Wolfsrudel entsprechen, von den ganz Fremden ab. Manche mag der Hund einfach nicht, wie es heißt, ohne Genaueres zu kennen.
Er ähnelt damit uns Menschen und unseren Beziehungen, die vom intimen über distanziert freundlichen zum ablehnenden Verhalten reichen. Sogar jene für uns selbst oft rätselhaften Fälle treten auf, in denen der Hund fremden Personen regelrecht zuläuft und um ihre Gunst buhlt. Was uns bekanntlich auch widerfahren kann. Klar und scharf definiert sind »Freund« und »Feind« jedenfalls nicht, weder beim Hund noch bei uns Menschen, die das Hundeverhalten vielleicht einfach kopieren.
Wie es dazu kam, ist eine lange Geschichte voller Annahmen und mehr oder weniger plausibler Begründungen. Ziemlich sicher geschah die Hundwerdung von Wölfen nicht durch Zwang. Eher wahrscheinlich ist eine über große Zeiträume anhaltende Wechselwirkung, in der sich Wolfsrudel den in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler lebenden Menschen angenähert und schließlich angeschlossen hatten. Eine Selbstdomestikation von Wölfen zu Anfang der Hundwerdung und danach eine gezielte Auslesezucht auf bestimmte Eigenschaften der »Hundwölfe«, wie sie formal genannt werden, die erst mit dem Sesshaftwerden der Menschen einsetzte, können nach gegenwärtigem Stand der Forschungen eine plausible Geschichte ergeben.
Nehmen wir an, sie ist in ihren Grundzügen richtig, dann wirft sie dennoch die tiefergehende Frage auf, weshalb sie überhaupt vor Zehntausenden von Jahren hatte anfangen können. Anders gefragt: Ist der Hund ein Sonderfall, ein Unikat, wie der Mensch selbst? Dies anzunehmen liegt nahe, empfiehlt es sich doch für alle Tiere nennenswerter Größe, also solchen, die uns wahrnehmen können, dem Prinzip zu folgen: Cave hominem