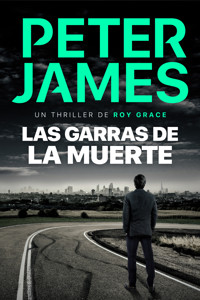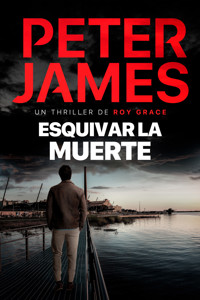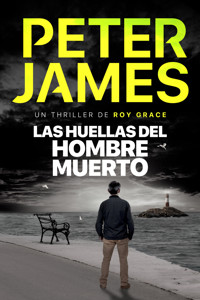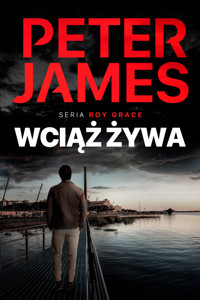6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mein bis in den Tod: Ein packender Psychothriller über die dunklen Abgründe einer scheinbar perfekten Ehe. Faith führt ein Leben in Luxus – doch der Preis dafür ist hoch. Ihr herrischer Ehemann Ross, ein erfolgreicher Schönheitschirurg, will sie nach seinen eigenen Idealen von Vollkommenheit umoperieren lassen. Als Faith einen Ausweg aus dieser toxischen Beziehung sucht, muss sie feststellen, dass Ross ein diabolischer Widersacher ist, der vor nichts zurückschreckt, um seine Ziele zu erreichen. In Mein bis in den Tod entwirft Bestsellerautor Peter James das fesselnde Psychogramm einer Ehe, in der Liebe längst in Besessenheit umgeschlagen ist. Ein nervenaufreibender Thriller, der bis zur letzten Seite in Atem hält und die erschreckende Frage aufwirft, wie gut wir die Menschen wirklich kennen, die wir am meisten lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Peter James
Mein bis in den Tod
Thriller
Aus dem Englischenvon Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Für Faith könnte das Leben nicht besser sein, denn sie hat alles, was das Herz begehrt: Geld im Überfluss, ein riesiges Haus, einen wundervollen Sohn. Ihr Mann Ross, ein Schönheitschirurg, liest ihr jeden Wunsch von den Lippen ab – doch dafür zahlt Faith auch einen hohen Preis: sie soll der Inbegriff von Schönheit für ihren Mann sein, doch seit einiger Zeit plagt sie ständig Übelkeit, die nicht enden will, und sie fühlt sich seltsam müde …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
Epilog
Dank
Zum Gedenken an meine Mutter Cornelia,
eine abwesende beste Freundin
Prolog
Irgendjemand hatte Maddy Williams gesagt, dass man es wisse, wenn man sterbe. Vielleicht hatte sie es auch irgendwo gelesen. In einer Zeitung? Einer Zeitschrift? Sie las jede Menge Frauenzeitschriften. Vor allem die Ratgeberseiten für ängstliche Menschen wie sie selbst, die wegen ihres Aussehens – allzu lange Nasen, allzu hängende Brüste, Segelohren, schmale Lippen – unter Komplexen litten.
Es gab Autos mit Mängeln, bekannt als Montagsautos. Vielleicht gab es ja auch »Freitagsmenschen« – Menschen, in deren Genen kleine Teile fehlten, was sich in zu eng stehenden Augen, nicht vorhandenen Fingern oder einer Hasenscharte zeigte oder, wie bei ihr, in einem portweinroten Muttermal in Gestalt des Staates Texas, das ihr halbes Gesicht bedeckte. Defekte, die die Betroffenen für den Rest ihres Lebens für alle sichtbar mit sich herumtragen, als ob sie ein Plakat mit der Aufschrift hochhielten: Das haben meine Gene mir angetan.
Doch Maddy Williams hatte genug davon. Seit ihrem zehnten Lebensjahr, als sie im Fernsehen eine Dokumentation über Schönheitschirurgie gesehen hatte, und seit Danny Burton und alle anderen in ihrer Klasse und fast jeder Fremde, dem sie je begegnet war, sie auf eine Art angestarrt hatten, dass sie sich wie ein Schreckgespenst fühlte, sparte sie für eine Reihe von Operationen, die ihr Leben völlig verändern sollten. Und die ein ganz berühmter Schönheitschirurg durchführen sollte.
Vor einigen Monaten hatte er ihr im Besprechungszimmer auf Papier skizziert und am Computer gezeigt, wie sie mit ihrem neuen Gesicht aussehen würde. Vor drei Wochen hatte sie die erste Operation gehabt. Nicht nur Texas verschwand, auch ihre Hakennase verwandelte sich in ein Cameron-Diaz-Näschen, ihre Lippen wurden aufgespritzt, ihre Wangenknochen in Form gebracht. Nach 31 Jahren der Hölle würde sie sich grundlegend wandeln!
Und nun, auf dem Operationstisch, benebelt durch die Prämedikation, wagte sie kaum zu glauben, dass das alles passierte … dass es wirklich passierte! Denn noch nie war ihr etwas Gutes widerfahren, das war ihr Schicksal. Immer wenn es so aussah, als ob ihr etwas zu glücken schien, ging irgendetwas schief. Auch darüber hatte sie viel gelesen, über Menschen, die vom Pech verfolgt sind. Gab es vielleicht ein Pech-Gen?
Tatsächlich waren die beiden Operationen, die bisher gemacht worden waren, nicht so toll verlaufen, wie sie es sich erhofft hatte. Sie war von ihrer Nase enttäuscht, die Nasenflügel waren allzu gewölbt, aber das wollte der Operateur nun ändern. Nur ein winziger Eingriff heute, Prämedikation und örtliche Betäubung, ein bisschen Herumzupfen, und schon wär’s vorbei.
Wenn ich damit durch bin, habe ich ein Näschen wie Cameron Diaz.
Bald werde ich genau so aussehen, wie ich immer wollte. Normal. Ich werde ein ganz normaler Mensch sein. Genau so wie alle anderen.
Die Zimmerdecke über ihr bestand aus cremefarbenem Gips, sie wirkte abgenutzt, die Art Decke, auf der sich Spinnen tummeln und Käfer krabbeln. Ich bin eine Puppe, zusammengerollt in einem Kokon, und werde als schöner Schmetterling herausschlüpfen.
Der Tisch wackelte leicht unter ihr, ein leises Rumpeln – Räder? Wie ein Trommelwirbel. Jetzt lag sie unter hellen Lampen. Sie spürte ihre Wärme. Lass dich bräunen!, dachte sie.
Über ihr standen zwei Gestalten in grünen Operationskitteln, die Gesichter versteckt hinter dem Mundschutz und den Operationshauben. Die OP-Schwester und der Chirurg. Er sah sie an. Beim letzten Mal hatten seine Augen voll Wärme und Humor geblitzt, jetzt aber wirkten sie kalt, bar jeden Gefühls. Ein eisiger Wind fegte durch sie hindurch, und die leise Beklommenheit, die sie vor einigen Minuten verspürt hatte, steigerte sich zu der furchtbaren Ahnung, den Eingriff nicht zu überleben.
Die Leute wissen es, wenn sie sterben.
Aber sie brauchte keine Angst zu haben. Der Arzt war doch ein netter Kerl! Er hatte ihr gezeigt, wie schön er sie machen konnte, hatte ihr die Hand gehalten, um sie zu beruhigen, hatte sogar alles getan, um sie davon zu überzeugen, dass sie gut aussah, so wie sie war, dass sie keine Operation benötigte, dass das Mal in ihrem Gesicht und der Knick in ihrer Nase sie nur interessanter machten …
Doch heute wirkte der Chirurg so anders – oder bildete sie sich das nur ein? Hilfe suchend sah sie die Krankenschwester an. Warmherzige, besorgte Augen erwiderten ihren Blick. Sie war sich nicht bewusst, dass da irgendetwas nicht stimmte. Aber …
Man weiß es, wenn man stirbt.
Die Worte kreischten in ihr. Sie würde diese Operation nicht überleben, sie musste raus hier, sofort, in dieser Minute, alles rückgängig machen, den Plan fallen lassen.
Maddy bemühte sich, etwas zu sagen, doch gleichzeitig beugte sich der Chirurg über sie, er hielt in der behandschuhten Hand einen Baumwolltupfer und begann, diesen erst in ihrem linken, dann in ihrem rechten Nasenloch zu bewegen. Sie versuchte, sich abzuwenden, den Kopf zu schütteln, zu schreien, aber es kam ihr vor, als habe jemand ihren Körper von ihrem Gehirn getrennt.
Bitte helft mir! O Gott, bitte helft mir doch!
Dunkelheit senkte sich herab und verschlang ihre letzten Gedanken, bevor sie sich ganz gebildet hatten, bevor sie sich in Worte verwandeln konnten. Und jetzt, während sie den Blick des Chirurgen erwiderte, sah sie ein Lächeln darin, als habe er etwas vor ihr verborgen gehalten und müsse das jetzt nicht mehr.
Und da wusste sie, dass sie heute sterben würde.
1
Spät an einem regnerischen Nachmittag ging Faith Ransome in den Erdgeschosszimmern ihres Hauses umher, suchte nach herumliegenden Legosteinen und dachte: Ist das alles? Ist das mein Leben? Gibt es da nicht mehr?
Aus der Küche rief Alec: »Mami, Mamiii! Komm, sieh mal!«
Zu ihrer Erleichterung fand sie ein gelbes Eckstück hinter dem Sofa. Ross hätte den Stein bestimmt entdeckt. Und dann …
Sie fröstelte, und ihr war ein wenig übel. Es kam ihr kalt vor in England, nachdem sie drei Wochen unter Thailands heißer, trockener Sonne Urlaub gemacht hatten. Seit vier Tagen waren sie wieder zu Hause, aber es erschien ihr viel länger. Wie vier Jahrhunderte.
»Mamiii!«
Sie ignorierte Alec und ging in den ersten Stock. Es war ein Ritual. Sie überprüfte jede Stufe nach Flecken, Schmutz, Pfotenabdrücken und die Wände nach neuen Flecken, inspizierte die Lampen nach durchgebrannten Glühbirnen. Sie ließ den Blick über den Teppich im Flur schweifen und hob einen weiteren Legostein auf, ging in Alecs Zimmer und legte die beiden Teile in einen Karton auf dem Tisch. Sie sah sich genau um, hob einen Robot-Spacewalker auf, stellte Alecs Turnschuhe in den Schrank und schloss die Tür, strich die Star-Wars-Tagesdecke glatt und stellte die Kuscheltiere in einer geraden Reihe aufs Kopfkissen.
Spike, Alecs dicker Hamster, rannte in dem Laufrad in seinem Käfig. Sie hob ein paar verschüttete Körner vom Tisch und warf sie in den Papierkorb.
Auf einmal hörte sie Rasputin, ihren schwarzen Labrador, laut bellen, mit kleinen Pausen.
Dann das unverkennbare Knirschen von Autoreifen auf Kies. Plötzlich ein Adrenalinstoß …
Aber es war kein angenehm-wohliges Gefühl – eher so, als ob sich die Wellen einer sturmgepeitschten See in ihr brächen. Ununterbrochen bellend trottete Rasputin aus der Küche durch die Halle ins Wohnzimmer, wo er – wie Faith wusste – auf seinen Stuhl vor dem Erkerfenster sprang, damit er sein Herrchen sehen konnte.
Er kam früher als sonst von der Arbeit.
»Alec! Daddy ist zu Hause!« Sie lief zum Schlafzimmer, schaute hinein, sah nach. Das Eichen-Himmelbett war gemacht. Schuhe, Hausschuhe, herumliegende Kleidungsstücke waren schon an ihrem Platz. Angrenzendes Badezimmer. Das Waschbecken sauber. Die Handtücher so aufgehängt, wie Ross es gefiel.
Hastig zog sie ihre Jeans, das Sweatshirt und die Turnschuhe aus, die Sachen, die sie tagsüber trug. Aber nicht, weil sie Lust hatte, sich zur Begrüßung ihres Mannes schick anzuziehen, sondern um Kritik zu vermeiden.
Im Bad betrachtete sie sich kurz im Spiegel. In dem Schränkchen befand sich eine kleine Plastikdose mit Tabletten. Ihren Glückspillen. Es war über einen Monat her, dass sie eine genommen hatte, und sie war entschlossen, sich von ihnen fern zu halten. Entschlossen, die Depressionen zu besiegen, die sie in den letzten sechs Jahren, seit der Geburt ihres Sohnes, immer wieder überfallen hatten – sie ein für alle Mal auszuradieren!
Sie trug ein wenig Lidschatten, Wimperntusche, einen Hauch Rouge auf, tupfte etwas Puder auf ihr perfektes Näschen (das Werk ihres Mannes, nicht ihrer Gene) und zog eine schwarze Karen-Millen-Hose, eine weiße Bluse, eine hellgrüne Betty-Barclay-Strickjacke und schwarze Pumps an.
Dann kontrollierte sie ihre Frisur im Spiegel. Sie war blond von Natur aus und bevorzugte klassische Frisuren. Im Augenblick trug sie das Haar zu einer Seite, schulterlang und schräg über die Stirn gekämmt.
Für eine 32-jährige Mutter siehst du eigentlich gar nicht schlecht aus.
Einiges davon hatte sie natürlich Ross zu verdanken.
Der Schlüssel knackte im Schloss.
Und nun eilte sie die Treppe hinunter, während die Tür aufging: ein Wirbel von herumspringendem Hund, wirbelndem Burberry-Regenmantel, schwingender schwarzer Tasche – und ein bekümmert dreinblickender Ross.
Sie nahm ihm die Tasche und den Regenmantel ab, die er ihr reichte, als wäre sie eine Garderobenfrau, und hielt ihm die Wange für einen flüchtigen Kuss hin.
»Hi. Wie war dein Tag?«
»Die absolute Hölle. Ich habe jemanden verloren. Ist mir einfach unter den Händen weggestorben.«
Wut und Schmerz in der Stimme, als er die Tür hinter sich zuschlug.
Ross – knapp einsneunzig groß, die schwarzen Haare mit Gel zu glänzenden Locken zurückgekämmt, nach Seife riechend – sah aus wie ein attraktiver Gangster: gestärktes weißes Hemd, rot-goldene Krawatte, maßgeschneiderter marineblauer Anzug, die Hose mit messerscharfen Bügelfalten, schwarze Halbschuhe mit Lochornamenten, militärisch perfekt geputzt. Er schien den Tränen nahe.
Als er seinen Sohn sah, hellte sich sein Gesicht auf.
»Daddy, Daddy!«
Alec, dessen Gesicht nach dem Urlaub in Thailand gebräunt war, sprang ihm in die Arme.
»Hallo, großer Junge!« Ross drückte ihn so fest an seine Brust, als hielte er mit seinem Sohn jede Hoffnung und jeden Traum in der Welt umschlungen.
»Hey! Was hast du gemacht? Wie war dein Tag?«
Faith lächelte. Wie niedergedrückt sie auch war – wenn sie die Liebe zwischen Vater und Sohn sah, war sie entschlossen, ihre Ehe am Laufen zu halten.
Sie hängte Ross’ Mantel auf, stellte die Tasche ab und ging in die Küche. Im Fernsehen wurde Homer Simpson gerade von seinem Boss gescholten. Sie schenkte einen Macallan drei Finger hoch ins Glas und drückte es gegen den Eisspender am Kühlschrank. Vier Würfel fielen klirrend ins Glas.
Ross folgte ihr in die Küche und setzte Alec ab, der seine Aufmerksamkeit sofort wieder dem Fernseher zuwandte.
»Wer ist gestorben?«, fragte Faith und reichte ihrem Mann das Glas. »Eine Patientin?«
Er hielt das Glas ins Gegenlicht, kontrollierte es auf Schmutz, Lippenstift und was auch immer, wonach er die Ränder von Gläsern überprüfte, bevor er sie an seine heiligen Lippen führte.
Trank einen Fingerbreit. Sie lockerte seine Krawatte, legte halbherzig den Arm um ihn, das Äußerste, was sie sich abringen konnte, und zog den Arm wieder zurück.
»Ich habe heute zwei Tore geschossen, Daddy!«
»Hat er wirklich!«, bestätigte Faith stolz.
»Toll!« Ross stellte sich hinter seinen Sohn und schlang wieder die Arme um ihn. »Zwei Tore?«
Alec nickte, hin und her gerissen zwischen dem Lob und der Fernsehsendung.
Dann wich das Lächeln aus Ross’ Gesicht. Er rief noch einmal »Zwei Tore!«, aber das Funkeln in seinen Augen war verschwunden. Er tätschelte Alec den Kopf, sagte »Einfach super!«, ging durch die Halle in sein Arbeitszimmer und setzte sich, unüblicherweise immer noch im Jackett, in seinen bequemen Parker-Knoll-Ledersessel. Er kippte ihn in die Position, in der er die Beine hochlegen konnte, und schloss die Augen.
Faith beobachtete ihn. Er litt, aber sie empfand nichts für ihn. Ein Teil von ihr wollte immer noch, dass zwischen ihnen alles so wäre wie früher, wenn auch eher wegen Alec als um ihretwillen.
»Gestorben. Nicht zu fassen, dass sie mir das angetan hat.«
Ruhig fragte sie: »Eine Patientin?«
»Herrgott, ja. Warum zum Teufel musste sie mir unter den Händen wegsterben?«
»Was ist denn passiert?«
»Allergische Reaktion auf das Narkosemittel. Das ist schon der zweite Fall in diesem Jahr. Himmel noch mal!«
»Derselbe Anästhesist? Tommy?«
»Nein, Tommy ist in Urlaub. Ich habe keinen eingesetzt. Es war nur eine winzige Korrektur – nur die Nasenflügel. Ich habe ein Lokalanästhetikum benutzt – dafür brauchte ich keinen Anästhesisten. Könntest du mir eine Zigarre holen?«
Faith ging zum Humidor im Esszimmer, nahm eine Montecristo No. 3 heraus, knipste das Ende so ab, wie Ross es mochte, und ging ins Wohnzimmer zurück. Dann hielt sie ihm die Flamme des Dupont-Feuerzeugs hin, während er mehrere tiefe Züge tat und die Zigarre drehte, bis sie gleichmäßig brannte.
Er stieß eine lange Rauchfahne zur Decke, dann fragte er, mit geschlossenen Augen: »Und wie war dein Tag?«
Am liebsten hätte sie erwidert: »Beschissen, so wie die meisten Tage«, aber sie sagte: »Ganz okay. Gut.«
Er nickte schweigend. Nach einigen Augenblicken sagte er: »Ich liebe dich, Faith. Ich könnte ohne dich nicht leben. Das weißt du doch, oder?«
Ja, dachte sie. Und das ist ein großes Problem.
2
Der kleine Junge stand in einer Gasse im Dunkel, das jenseits des Lichts der Straßenlaterne lag. Es war eine warme Septembernacht. Über ihm fiel der schwache Schein einer Glühbirne durch den Vorhangspalt hinter einem offenen Fenster.
Auf der Straße beschleunigte ein Auto, und er drückte sich flach gegen die Mauer. Ein Gang wurde gewechselt, dann fuhr es vorbei. Irgendwo weiter unten auf der Straße lief im Radio ein neuer Song mit dem Titel »Love Me Do«. Er rümpfte die Nase, wegen des Gestanks, der aus den Mülltonnen neben ihm drang.
Ein Windstoß bauschte die Vorhänge, und ein Lichtstrahl huschte über die fensterlose Seitenmauer neben ihm. Irgendwo in der Nähe bellte ein Hund, dann war es still. Und in dieser Stille hörte er eine Frauenstimme. »O ja, oh, ja, ja! Fester, fick mich fester, oh, ja, o ja, o ja!«
In der rechten Hand hielt der Junge einen schweren rechteckigen Ölkanister mit einem runden Drehverschluss und einem dünnen, scharfkantigen Metallgriff, der ihm schmerzhaft in die Handfläche schnitt. Auf der Seite standen die Wörter SHELL OIL. Der Kanister roch nach Automotoren. Er enthielt fast fünf Liter Benzin, das er aus dem Tank des Morris seines Vaters abgesaugt hatte.
In seiner Hosentasche hatte er ein Päckchen Streichhölzer.
In seinem Herzen loderte Hass.
3
Ross’ Sperma tröpfelte zwischen ihre Beine. Faith lag schweigend da und horchte auf das Plätschern seines Urinstrahls. Graues Tageslicht drang durch die offenen Vorhänge, die Umrisse der dicht belaubten Buchen erhoben sich am Horizont. Im leicht verstellten Radiowecker liefen die Nachrichten, düstere Meldungen über Tote im Kosovokrieg. Dann ein Blick auf die Uhr: 6.25, Mittwoch, 12. Mai.
Sie griff nach ihren Kontaktlinsen, nahm das kleine Behältnis in die Hand und öffnete den Deckel. In zwanzig Minuten musste sie Alec wecken, ihm Essen machen, ihn zur Schule fahren, und dann …?
Die Übelkeit, die sie in den letzten Tagen verspürt hatte, war heute Morgen anscheinend schlimmer, und ihr kam ein Gedanke.
Schwanger?
O nein, bitte nicht.
Ein Jahr nach Alecs Geburt hatten sie versucht, ein zweites Kind zu bekommen, aber es hatte nicht geklappt. Nach einem weiteren Jahr hatte Ross Tests machen lassen, die gezeigt hatten, dass bei ihr alles in Ordnung war. Offenbar lag das Problem bei ihm, doch er wollte das nicht akzeptieren und weigerte sich standhaft, einen Spezialisten aufzusuchen.
Zunächst hatte Faith sich darüber geärgert, doch mit der Zeit hatte sie es als eine Art Segen empfunden. Sie liebte Ross über alles, aber er war schwierig, und zwar ständig, außerdem war sie so energielos gewesen, dass sie mit einem weiteren Kind wahrscheinlich gar nicht fertig geworden wäre.
Und ihr war auch klar, dass sie größtenteils deshalb an ihrer Ehe festhielt, weil sie sich ein Leben ohne Alec nicht vorstellen konnte. So depressiv, wie sie war, hätte Ross es niemals zugelassen, dass Alec bei ihr blieb, und allein wäre sie in ihrem Zustand vermutlich nicht sehr gut mit ihm zu Rande gekommen. Dabei bestand an Ross’ Liebe zu Alec nicht der geringste Zweifel. Doch diese Liebe würde sich auf Alec auswirken. Zudem trug er Ross’ Gene in sich. Vielleicht konnte sie ja durch liebevolle Erziehung das Gute in ihm hervorbringen, das er von Ross geerbt hatte, und das Schlechte abmildern.
Aus dem Badezimmer rief Ross: »Was ziehst du heute Abend an, Liebling?«
Schnell schaltete sie innerlich um. »Ich dachte an das dunkelblaue Kleid – das von Vivienne Westwood, das du mir geschenkt hast.«
»Kannst du es mal kurz überziehen?«
Sie zog es an. Er kam aus dem Badezimmer, stand da, nackt, mit nassen Haaren, Zahnbürste im Mund, und musterte sie. »Nein. Das passt nicht. Zu aufreizend für heute Abend.«
»Mein schwarzes von Donna Karan – das aus Taft?«
»Zeig mal.«
Er ging ins Bad zurück, kam wieder heraus, Rasierschaum im Gesicht, ein Streifen sauber rasiert.
Sie drehte sich zu ihm um.
»Nein – das eignet sich besser für einen Ball. Heute Abend – das ist nur ein Dinner.« Er marschierte zu Faiths Kleiderschrank, ging schnell die Bügel durch, zog ein Kleid heraus und warf es auf die Chaiselongue, dann noch eins und noch eins.
»Ich muss Alec wecken.«
»Probier die hier mal an. Du musst passend angezogen sein – der Abend ist wirklich wichtig.«
Leise fluchend wandte sie sich ab. Immer war alles wirklich wichtig. Doch sie zog das Kleid an. Und noch eins. Keines der Spiegelbilder gefiel ihr. Schlechter Tag für die Frisur, die Haare lagen nicht richtig, obendrein hatte das nasskalte Wetter in den letzten drei Wochen das meiste der übrig gebliebenen Sonnenbräune weggebleicht, so dass ihr Teint wieder fast so blass war wie immer morgens gleich nach dem Aufstehen. Vor ein paar Jahren hatte ihre Freundin Sammy Harrison mal gesagt, an einem guten Tag sähe sie aus wie Meg Ryan an einem schlechten. Und heute war kein guter Tag.
»Muss ich zusammen mit den Schuhen sehen«, rief er, während er sie im Spiegel betrachtete und sich den letzten Schaum wegrasierte. »Und der Handtasche.«
Zehn vor sieben; er war fertig angezogen und betupfte einen kleinen Blutfleck am Kinn. Auf dem Bett lagen fein säuberlich das Kleid, die Schuhe, die Handtasche, das Halsband, die Ohrringe. Alec schlief noch.
»Okay, gut. Trag das Haar hochgesteckt.« Er nahm ihr Gesicht in die Hände, küsste sie leicht auf die Lippen – und ging hinaus.
Das Leben ist die Hölle, dachte Faith, aber nicht, weil man stirbt, sondern weil man, ohne es überhaupt zu bemerken, zu jemandem wird, der man nie sein wollte.
All die Träume, die man in der Schulzeit hatte, all die Biografien in den Hochglanz-Zeitschriften von Menschen, die alles zu haben schienen. Aber sie hatte das nie interessiert, sie war nie neidisch gewesen auf diese Leute. Ihr Vater, ein sanfter Mann, der sich nie beklagt hatte, war ihre ganze Kindheit hindurch bettlägerig gewesen, und solange sie zurückdenken konnte, hatte sie mitverdient, um ihrer Mutter zu helfen, die Familie durchzubringen. An den Wochenenden hatte sie im Wohnzimmer für die Handschuhfabrik am Ort, in der ihre Mutter halbtags arbeitete, Daumen an Fäustlinge genäht, und ab ihrem zwölften Lebensjahr war sie jeden Morgen um Viertel vor sechs aus dem Haus gegangen, um Zeitungen auszutragen.
Sie hatte nie nach Reichtum gestrebt. Alles, was sie im Leben erreichen wollte, war, ein fürsorglicher Mensch zu werden und etwas Positives in der Welt zu bewirken. Es gab da keinen Lebensplan, es war ganz einfach ihre Einstellung. Wenn sie Kinder hätte, hatte sie immer gehofft, würde sie ihnen beibringen, ihre Umwelt zu respektieren, ihnen eine glücklichere Kindheit ermöglichen, als sie gehabt hatte, und sie zu guten Menschen erziehen.
Doch jetzt, mit 32, hatte sich ihr Leben so weit von ihrer einfachen Herkunft entfernt wie von ihren Träumen. Sie war mit einem Schönheitschirurgen verheiratet, einem wirklich reichen Perfektionisten, und sie bewohnten ein absurd großes Haus. Sicher, sie sollte eigentlich dankbar sein für das, was sie hatte, wie ihre Mutter immer sagte. Aber sie beide würden wohl immer unterschiedlicher Meinung sein.
Sie beschloss, die kleine Apotheke im Dorf zu meiden, und fuhr stattdessen nach Burgess Hill, dem nächstgelegenen Städtchen, in der es eine große Drogerie mit Apotheken-Abteilung gab. Während sie in der Schlange vor der Schranke zum Parkplatz wartete, blickte sie in den wolkenverhangenen Himmel und spürte förmlich, wie er sie niederdrückte. Als sie mit dem Fingernagel gegen einen Vorderzahn tippte, merkte sie, dass sie vor Nervosität leicht zitterte. Die undefinierbare dunkle Angst, die Teil ihrer Depressionen war, neben dem gelegentlichen, extrem beängstigenden Gefühl, nicht ganz in ihrem Körper zu sein, ließ sie nie lange los. Zum Glück lagen die Prozac-Kapseln im Badezimmerschrank. Hätte sie welche dabeigehabt, hätte sie jetzt eine genommen.
Im Auto vor ihr saß eine ältere Frau am Steuer, die nicht nahe genug an den Ticketautomaten herangefahren war und deshalb die Tür öffnen musste, um an den Parkschein heranzukommen. Faith warf einen Blick auf den Tacho: 8,2 Meilen. Sie multiplizierte die Zahl mit zwei, für die Heimfahrt. 16,4 Meilen, über die sie Rechenschaft ablegen musste – Ross überprüfte den Tachostand täglich.
Damit sie ihm gegenüber die Fahrt begründen konnte, kaufte sie in Waitrose Lebensmittel ein. Es war einfacher, sich Wege auszudenken, den Minen und getarnten Bomben auszuweichen, die er in ihrem gemeinsamen Alltag auslegte. So herrschte ein gewisser Frieden, zumindest in ihrem Wachzustand. Ihre Träume hingegen waren unruhig, und es tauchte dort immer wieder ein und dasselbe Thema auf.
Wann hat mein Leben mit Ross sich zu verändern begonnen?
Hatte es während der letzten zwölf Jahre, in denen sie mit ihm zusammenlebte, einen Punkt gegeben, an dem sich der liebevolle, fürsorgliche, lebenslustige junge Hausmann, den sie über alles liebte, in das übel gelaunte Scheusal verwandelte, dessen Nachhausekommen sie fürchtete? War diese Angst immer da gewesen? Und hatte sie in jener ersten unbeschwerten Zeit die Liebe oder die Aussicht auf ein glamouröses Leben blind dafür gemacht?
Oder hatte er diese Seite bewusst vor ihr verborgen?
Und warum sah eigentlich nur sie diese Seite? Warum erkannten ihre Mutter oder ihre Freundinnen sie nicht? Aber sie kannte die Antwort. Ross bot ihnen keinen Anlass – er konnte unglaublich charmant sein. Obwohl die Medizin nicht vermocht hatte, ihrem Vater den langsamen, schmerzhaften und würdelosen Abstieg in den Tod während zwanzig elender Jahre zu erleichtern, hatte ihre Mutter bis heute gewaltigen Respekt vor Ärzten. Sie bewunderte Ross – war vielleicht sogar selbst ein wenig verliebt in ihn.
Manchmal fragte sich Faith, ob der Fehler bei ihr lag. Erwartete sie zu viel von ihrem Mann? Führten ihre Depressionen dazu, dass sie nur das Schlechte sah und das Gute ignorierte? Denn selbst jetzt noch gab es glückliche Momente und gute Tage mit Ross, auch wenn sein Jähzorn oder seine Kritik an ihr diese am Ende meist kaputtmachten. Während des letzten Urlaubs in Thailand hatte sie versucht, ihre Ehe zu retten und dorthin zurückzukehren, wo sie einst gewesen waren. Sie hatte ihr Bestes gegeben, doch schließlich konnte sie nichts mehr für Ross empfinden.
Es gab eine Grenzlinie im Leben. Man konnte jemanden an sie herandrängen, aber nicht darüber hinaus. Jenseits davon änderte sich alles unwiderruflich. Piloten nennen dies den point of no return: den entscheidenden Augenblick, wenn man den Start nicht mehr abbrechen kann und einem nichts anderes übrig bleibt, als abzuheben. Oder abzustürzen. Und genau an diesem Punkt befand sie sich jetzt. So weit hatte Ross sie gebracht.
In der ersten Zeit hatte sie ihn so sehr geliebt, dass er alles durfte. Sie hatte so vollständig an ihn geglaubt, dass sie die Schmerzen und die Unannehmlichkeiten von sechs Operationen ertragen hatte. Und er hatte sie verwandelt – von einer Frau, die normal gut aussah, in eine, na ja, die besser als normal gut aussah. Und in gewisser Weise war das schmeichelhaft. Als sein kometenhafter beruflicher Aufstieg begann, hatte sie es genossen, dass er sie zu Konferenzen mitnahm, auf denen er auf die Neuformung hinwies, die er an Lippen, Augen, Mund, Nase, Wangen, Kinn und Brüsten vorgenommen hatte. Das war immerhin eine der Zugaben zu zwölf Ehejahren: die enorme Steigerung ihres Selbstbewusstseins, das jetzt beinahe ebenso gründlich untergraben war.
Versteckt in einem Zimmer unterm Dach, das sie selten benutzten, bewahrte sie einen Stapel Bücher und Zeitschriftenartikel über Eheprobleme auf. Sie hatte Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus gelesen und noch einmal gelesen, hatte das Buch sogar im Haus herumliegen lassen in der Hoffnung – richtiger wohl: in dem Irrglauben –, dass Ross das Buch zur Hand nehmen und darin lesen würde. Außerdem war sie kürzlich auf eine Internet-Chatline für misshandelte Ehefrauen gestoßen. Sie hatte den Kopf voller Ratschläge. Und voller Pläne.
Das Leben kann wieder gut werden, dachte sie. Irgendwie finde ich schon einen Weg, dass es gut wird – für Alec und für mich selbst.
In einem plötzlichen Anfall von Extravaganz kaufte sie für das morgige Abendessen im Supermarkt zwei tiefgefrorene Hummer – Ross’ Lieblingsessen –, ein paar gewürzte Hühnerflügel, für die Alec in Thailand eine Vorliebe entwickelt hatte, und seine Lieblingseiscreme: Caramel-Crunch. Dann fiel ihr ein, noch zwei Reispuddings mit Rosinen für ihre Mutter zu kaufen, die am Abend auf Alec aufpassen würde.
Ach, Ross, warum versuche ich immer noch, dich zufrieden zu stellen? Nur um mir damit einige Augenblicke Frieden zu erkaufen? Oder betrüge ich mich selbst, wenn ich glaube, du würdest mich freigeben und mir erlauben, meinen Sohn mitzunehmen, wenn ich nur lieb genug zu dir wäre?
Sie bog mit dem Range Rover auf die Auffahrt, vorbei an den großen imposanten Kugeln auf den Säulen und dem schönen Messingschild mit der Aufschrift Little Scaynes Manor. Es war ein großartiger Anblick, wenn man auf das elisabethanische Haus zufuhr, auf dem mit Bäumen und Rhododendren gesäumten Kiesweg bis zur mit Efeu bewachsenen Giebelfassade – früher tat ihr Herz jedes Mal einen kleinen Sprung vor lauter Aufregung.
Es war ein prächtiges Haus, keine Frage, wunderschön gelegen, nahe am Fuß der sanft gewellten Hügel der South Downs. Zehn Schlafräume, dazu Wohnzimmer, Bibliothek, Billardzimmer, ein Esszimmer mit Sitzmöglichkeiten für dreißig Gäste, ein Arbeitszimmer, eine riesige Küche mit Eichendielen sowie eine Vielzahl von Nebengelassen. Doch keines der Zimmer – mit Ausnahme vielleicht des Esszimmers – wirkte zu groß, wenn nur sie beide daheim waren. Das Haus war gerade klein genug, dass es noch gemütlich war, aber groß genug, um Ross’ Kollegen und einen Reporter oder ein Fernsehteam zu beeindrucken, die hin und wieder herkamen.
Das Grundstück umfasste insgesamt über 5,6 Hektar. Früher hatten noch rund hundert Hektar Weide- und Ackerland zum Haus gehört, doch im Lauf der letzten zweihundert Jahre hatten die vorherigen Eigentümer die Nebengebäude und Parzellen nach und nach verkauft. Aber der Rest war immer noch mehr als genug: gepflegte Rasenflächen, ein Obstgarten mit alten Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbäumen, ein kleiner See sowie ein verwildertes Waldstück, das unbedingt zurückgeschnitten werden musste. Den Gästen, die einen Abend oder ein Wochenende zu Besuch kamen, erschienen Haus und Grundstück wie ein Idyll.
Doch im Haus herrschte eine Atmosphäre, die Faith davon abhielt, sich rundum wohl zu fühlen. Und dieses Gefühl wurde noch verstärkt durch die schmalen, von außen schwarz wirkenden Bleiglasfenster, die Fachwerkfassade, die irrsinnig hohen und verzierten Schornsteine – und durch das Gerücht, dass in einem davon eine Frau eingemauert worden sei. Diese sei die Geliebte des Mannes gewesen, der das Haus gebaut hatte, und nachts könne man hören, so die örtliche Legende, wie sie drauflos hämmerte und herauszukommen versuchte. Faith hatte sie nie gehört, obwohl sie den Geisterglauben keineswegs von sich wies, sondern fühlte sich in dem Haus selbst irgendwie eingemauert. Manchmal, wenn sie es betrat, empfand sie die große düstere Halle, das scharfe Ticken der Standuhr unten an der geschnitzten Treppe und die Schlitze in den Helmvisieren der Rüstungen, die Ross sammelte, als wahrhaft gruselig.
Heute war es aber in Ordnung. Es war Mittwoch, und die Putzfrau war im Haus: Faith hörte das Dröhnen des Staubsaugers in einem der Schlafzimmer. Sie war froh, dass Mrs. Fogg da war, aber genauso froh, dass sie oben arbeitete: Die Frau konnte vorzüglich putzen, redete jedoch wie ein Wasserfall, und zwar meistens darüber, dass nur eine Reihe von Katastrophen sie dazu genötigt habe, die Stelle anzunehmen, und sie beileibe keine Reinigungskraft sei.
Rasch trug Faith die Lebensmittel in die Küche, holte den Schwangerschaftstest aus der Drogerie-Tüte und las die Gebrauchsanweisung durch, bevor sie die Einkäufe auspackte.
Über ihr saugte Mrs. Fogg noch immer den Fußboden.
Faith holte aus der Schachtel ein kleines Plastiktöpfchen, eine Pipette und die Testscheibe, trug alles in die Gästetoilette im Erdgeschoss und schloss die Tür hinter sich. Sie urinierte in das Töpfchen, zog ein wenig Urin in die Pipette und gab fünf Tropfen in die Einkerbung der Scheibe, wobei sie sich genau an die Gebrauchsanweisung hielt.
Die Übelkeit war wieder da, und ihr Kopf fühlte sich ein wenig heiß an, als hätte sie leichtes Fieber.
Ein rotes Minuszeichen.
Hoffentlich erschien ein rotes Minuszeichen.
Sie blickte überall hin, nur nicht auf ihre Uhr. Auf die Pferde-Stiche an der Wand, die altmodischen Messingarmaturen am strahlend weißen Waschbecken, die smaragdgrüne Tapete, den Stapel National Geographics auf dem Regal neben dem Toilettensitz. Oben in einer Ecke bemerkte sie eine Spinnwebe und nahm sich vor, Mrs. Fogg darauf hinzuweisen.
Dann blickte sie an sich herunter und hob das Stäbchen an.
Sie musste zweimal hinsehen, um sicherzugehen, dann las sie die Gebrauchsanweisung noch einmal.
Minus!
Ein rotes Minuszeichen füllte das zentrale Fenster der Testscheibe. Und mit ihrer Erleichterung war auch ihre Übelkeit verschwunden.
4
Oliver Cabot wurde an diesem Abend von mancherlei Dingen abgelenkt, hauptsächlich aber von der Frau am Nachbartisch, die zweimal seinen Blick erwidert hatte und von ihren Tischnachbarn offenbar genauso gelangweilt war wie er von seinen.
Er hatte die Einladung zu diesem vom Pharmariesen Bendix Schere veranstalteten Dinner der Royal Society of Medicine nicht aus Liebe zu seinem Beruf oder aus Bewunderung für das Unternehmen des Gastgebers, das er verachtete, angenommen. Vielmehr interessierte es ihn, über die Fortschritte auf dem Feld der Medizin auf dem Laufenden zu bleiben und zu einem Berufsstand Kontakt zu halten, dem er täglich mehr und mehr misstraute. Im Augenblick jedoch erinnerte ihn die Frau mit den glatten blonden Haaren und einem Gesicht, das eher hübsch als im klassischen Sinne schön war, die auf der anderen Seite des runden Tisches mit zwölf Plätzen hinter einer gezackten Reihe aus Weinflaschen und Wasserkrügen saß – an jemanden, aber an wen? Schließlich kam er drauf.
Meg Ryan!
»Wissen Sie, Oliver, es hat zwölf Jahre gedauert, bis wir Tyzolgastrin entwickelt hatten.« Johnny Ying, Vizepräsident, Leiter des Übersee-Marketings, ein Amerikaner chinesischer Abstammung mit Brooklyner Akzent und Meckifrisur, griff in sein Körbchen mit Gebäck. »Sechshundert Millionen für Forschung und Entwicklung. Wissen Sie, wie viele Unternehmen auf der Welt es sich leisten können, so viel Geld auszugeben?«
Tyzolgastrin wurde als revolutionäres Mittel gegen Magengeschwüre gefeiert. Es war kürzlich von der Weltorganisation für Ethische Medizin auf die Liste der hundert wichtigsten medizinischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts gesetzt worden. Nicht viele Leute kannten die Organisation, die ausschließlich von Bendix Schere finanziert wurde.
»Sie hätten gar nicht so viel Geld ausgeben müssen«, bemerkte Oliver.
»Warum nicht?«
»Weil Sie Tyzolgastrin nicht entdeckt, sondern geklaut haben. Sie haben es erst vermarktet, nachdem Sie vierhundert Millionen Dollar mit dem Versuch vergeudet hatten, ein Antibiotikum gegen Magengeschwüre zu entwickeln. Mir können Sie einen solchen Blödsinn nicht erzählen.«
Meg Ryan hörte einem schlanken, glatzköpfigen Mann zu, der enthusiastisch redete, während sie nickte. Ihre Körpersprache verriet Cabot, dass sie den Mann nicht im Geringsten sympathisch fand. Er fragte sich, worüber sie wohl sprachen. Und dann trafen sich erneut ihre Blicke, worauf sie sofort wegschaute.
»Getunt – verstehen Sie? – der Motor hat 2850 ccm Hubraum, aber was habe ich gemacht: Ich hab den Wagen zu einer Firma in Tuscon gebracht und den Motor aufbohren lassen, was 2000 Kubikzentimeter mehr brachte …«
Faith musste einen Blick auf sein Platzkärtchen werfen, um sich an seinen Namen zu erinnern. Deighton Carver, Vizepräsident, Leiter des Marketings. In der letzten Viertelstunde hatte er über Automotoren geredet, davor über seine Scheidung, seine neue Ehefrau, seine alte Ehefrau, seine drei Kinder, sein Haus, sein Power-Boot und sein Fitnessprogramm. Bislang hatte er noch keine einzige Frage an sie gerichtet. Ihr Tischnachbar zur Rechten hatte sich zu Beginn des Essens mit einem kräftigen Handschlag vorgestellt und sich während der fünf bisherigen Gänge mit der Frau rechts von ihm unterhalten.
Das Dessert lag unangerührt auf ihrem Teller. Die leichte Übelkeit, die sie heute Morgen verspürt hatte, war zurückgekehrt, und sie hatte kaum etwas gegessen. Das Dinner zählte zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen, die Ross genoss, aber Faith nicht ausstehen konnte. Mit einzelnen Ärzten war sie gern zusammen, in der Masse jedoch schlossen sie sich auf eine solch elitäre Art zusammen, dass sie sich jedes Mal als Außenseiterin fühlte.
Ross, der Sohn eines Gaswerksangestellten und inzwischen gefeierter Schönheitschirurg, wurde von seinem Berufsstand hofiert und gefeiert. Sein Name stand auf der gedruckten Speisekarte auf der linken Seite, gegenüber dem Lammrücken an Zwiebelmarmelade, dem 93er Bâtard Montrachet und dem 86er Langoa Barton. Neben dem des Gynäkologen der Königin und einer Reihe anderer renommierter Ärzte. Ross gehörte zu den Ehrengästen: Ross Ransome, Dr. med., FRCS (Plast).
Trotz allem war sie stolz, seinen Namen auf der Menükarte zu sehen, denn auf ihre eigene unbedeutende Weise hatte sie etwas zu seinem Erfolg beigetragen. Auf Ross’ Drängen hatte sie Sprechunterricht genommen, um ihren Londoner Vorortakzent ein wenig abzulegen. Seit Jahren las sie sich pflichtschuldig durch die Lektüreliste, die er ihr gegeben hatte: antike Autoren, die großen Dichter, Shakespeare, die bedeutenden Philosophen, alte und neue Geschichte. Manchmal war sie sich dabei wie Eliza Doolittle in My Fair Lady vorgekommen – oder, wie Ross es bevorzugt hätte, in Shaws Pygmalion, das ebenfalls auf der Liste stand. Er legte Wert darauf, dass sie an jedem Dinner-Tisch eine gute Figur abgab.
Im Stillen hatte sie sich oft gefragt, wieso er sich eigentlich in sie verliebt hatte. Er hatte ihr Gesicht verändert, die Brüste, die Nase, die Stimme, und sie einem Umerziehungsprogramm unterzogen. Und manchmal hatte sie gedacht, dass vielleicht genau dies der Grund war: Ross hatte sich zu ihr hingezogen gefühlt, weil sie formbar war. Möglicherweise hatte er sie als Tabula rasa betrachtet, auf die er das Bild seiner idealen Frau malen konnte. Vielleicht brauchte der Kontrollfanatiker in ihm ja genau das.
Jetzt beobachtete er sie. Er saß an dem großen runden Tisch ihr schräg gegenüber, neben einem Mann mit perfekter Sonnenbräune und noch perfekteren Zähnen, der auf ihn einredete und seine Sätze mit einer Seitwärtsbewegung seiner Hand unterstrich. Rechts von ihm saß eine Frau mit toupiertem, gebleichtem Haar, die ein Face-Lifting zu viel hatte machen lassen. Ihre Haut schien der Schwerkraft zu trotzen und stieg von den Gesichtsknochen und -muskeln nach oben, was ihr einen leicht irren, starrenden Blick verlieh und den Mund zu einem humorlosen Dauerlächeln streckte. Ausgeschlossen, dass Ross etwas anderes als ein berufsmäßiges Interesse an ihr entwickeln könnte.
Schade.
Als Faith sich nach vertrauten Gesichtern umsah, erblickte sie einen Mann, der sie schon einmal beobachtet hatte und nun wieder zu ihr herüberschaute. Sie blickte ihn an, aber er war in ein Gespräch vertieft, dann sah sie noch einmal zu ihm hin. Ihre Blicke trafen sich. Er lächelte. Geschmeichelt wandte sie sich ab, unterdrückte ein schuldbewusstes Lächeln. Es war schon lange her, dass sie mit jemandem geflirtet hatte, aber es war ein schönes Gefühl, getrübt nur durch die Aussicht auf Ross’ Zorn, den er später an ihr auslassen würde, wenn er es bemerkte.
Sie blickte erneut zu dem Mann hin, und er sah sie noch immer an. Diesmal senkte sie hastig den Kopf.
»Dann hab ich sämtliche Toleranzen ausgeschöpft – Aufhängung, Stoßdämpfer, Bremsen –, wir haben das alles rausgerissen und ganz von vorne angefangen. Im Grunde haben wir eine Rennwagen-Plattform gebaut …«
Sie ignorierte ihren Tischnachbarn abermals, dann warf sie einen flüchtigen Blick auf den Tisch neben ihrem. Da sich ihr Bewunderer mit einem Asiaten zu seiner Linken unterhielt, bot sich ihr die Möglichkeit, ihn sich genauer anzusehen. Er war ungefähr so alt wie Ross, Mitte bis Ende vierzig, doch etwas unterschied ihn von allen anderen Gästen, wenn sie auch nicht sofort wusste, was.
Er saß da, mit geradem Rücken, groß gewachsen und schlank. Die Brille mit Metallgestell war modisch, das Gesicht unter dem grauen Haarschopf wirkte ernsthaft und intellektuell. Er trug eine größere, weniger perfekte Schleife als die adretten kleinen schwarzen Seidenfliegen, die hier offenbar üblich waren.
Wer bist du? Du siehst wirklich gut aus.
Er könnte Wissenschaftler sein – vielleicht arbeitete er in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der pharmazeutischen Gastgeberfirma.
Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen. Ein Zeremonienmeister in Livree verkündete: »Sehr geehrte Lords, Ladies und Gentlemen, bitte erheben Sie sich zum Toast.«
Nachdem alle wieder Platz genommen hatten, zog Ross ein Röhrchen aus seiner Innentasche, schraubte den Deckel ab und schüttelte eine große Havanna heraus. Sein trockenes, humorloses Lächeln, mit dem er sie ansah, drückte aus: »Ich sehe, dass du ihn anschaust, Sonnenschein. Ich sehe, dass du ihn anschaust.«
5
Das Haus war in zwei Wohnungen unterteilt. Auf der Rückseite befand sich eine Feuerleiter, zu der man von der Küchentür mit Glaseinfassung in die Wohnung im ersten Stock gelangte.
Jetzt stieg der Junge die Feuerleiter hinauf und mühte sich unter dem Gewicht des Benzinkanisters, während er in seinen Turnschuhen leise auf die gusseisernen Stufen trat. Er war elf, groß für sein Alter, aber ein flüchtiger Betrachter hätte ihn für sechzehn halten können. Niemand würde von einem Sechzehnjährigen Notiz nehmen, der um elf Uhr abends durch die ruhigen Straßen im Süden Londons radelte. Niemand würde den Kanister bemerken, den er, unter der Windjacke an die Brust gebunden, bis hierher transportiert hatte.
Noch immer lief der Song »Love Me Do«, von dieser neuen Gruppe, den Beatles, die andauernd im Fernsehen auftraten, außerdem hörte er Schreie und Gelächter, als würde irgendwo weiter unten auf der Straße eine Party gefeiert. Immer wieder ertönte der Refrain, was seinen Hass nur noch verstärkte.
Zwei Stunden zuvor war sein Vater in sein Zimmer gekommen und hatte ihm gute Nacht gesagt. Eine Stunde später hatte er ihn zu Bett gehen gehört. Eine halbe Stunde darauf hatte er sein Schlafzimmerfenster geöffnet und war die Regenrinne hinuntergerutscht. Wenn er zurückkam, würde er den gleichen Weg nehmen.
Er hatte das alles schon seit Monaten geplant, jedes Detail, er hatte an alles gedacht, sogar an einen Fahrradreparatursatz, die Extraglühbirnen für die Fahrradlampen, die, in Papiertaschentücher eingewickelt, in der Satteltasche lagen, und die Küchenhandschuhe, die er sich nun anzog. Er besaß eine gute Beobachtungsgabe und war sehr geschickt mit den Händen.
Immer wieder hatte er geübt, bis er seine Bettdecke so aussehen lassen konnte, dass man meinte, er schliefe darunter. Auf dem Kopfkissen hatte er eine Perücke drapiert, die er in einem Scherzartikelgeschäft gekauft hatte und der er die Haare geschnitten und gefärbt hatte, damit sie aussahen wie seine eigenen.
Dutzende Male war er die Strecke von seinem Zuhause hierher geradelt, hatte die Zeit genommen und sogar geprobt, was er sagen würde, falls ihn ein Polizist anhielt, welchen Namen und welche Adresse er angeben würde. Damit die Fußabdrücke nicht so deutlich waren, hatte er auf eine Nacht ohne Mondschein, aber auch ohne Regen warten müssen.
Als er letzte Nacht wachlag und darüber nachdachte, was alles schief gehen und seine Pläne zunichte machen könnte, war er nervös gewesen. Aber jetzt, da er hier war, fühlte er sich gut, war ganz ruhig.
Ruhiger, als er je im Leben gewesen war.
6
Nachts um Viertel vor eins saß Oliver Cabot im ehemaligen Loft eines Künstlers nahe der Portobello Road an seinem Schreibtisch, den er sich aus der Tür eines zerstörten indischen Tempels hatte anfertigen lassen.
Er starrte auf den Bildschirm seines iMacs mit der abgestumpften Geduld eines erfahrenen Cybertravellers, während das kleine Farbfoto von Ross Ransome widerstrebend zentimeterweise heruntergeladen wurde.
Jetzt war es fast da. Er klickte mit dem Cursor auf die Scroll-Leiste, bewegte ihn hinauf, dann wieder herunter, was aber nichts bewirkte. Bislang war nur die obere Kopfhälfte des Arztes zu sehen und hinter ihm so etwas wie eine Bücherwand.
Er gähnte. In der Stille der Nacht erinnerte ihn das leise Surren des Computerlüfters an den tonlosen Laut in einem Flugzeug. Auf dem Schreibtisch lächelte ihn Jake, erhellt vom Schein der Anglepoise-Lampe, aus einem Schildpatt-Fotorahmen zu.
Der sommersprossige Jake, mit seiner braunen Ponyfrisur und seinem typischen Grinsen – ihm fehlten zwei Schneidezähne, die die Zahn-Fee ihm gestohlen und nie zurückgegeben hatte.
Jake, festgehalten in der Zeit, wie er aus der Tür ihres Hauses am Meer – mit Blick auf einen Kanal, der furchtbar nach Abwässern stank – in Venice, Santa Monica, lief. Jake auf seinem nagelneuen Mountainbike, der noch nicht ahnte, welch grausames Schicksal ihn fünf Tage später ereilen würde.
Wieder diese Enge in der Kehle, die Oliver immer verspürte, wenn er diese Erinnerungen zuließ. Wieder blickte er auf den Bildschirm, bewegte den Cursor, scrollte hinunter. Jetzt sah er das ganze Bild von Ross Ransome – aber zu seiner Enttäuschung war dort sonst niemand zu sehen. Keine Faith Ransome.
He, du Vollidiot, was für eine Art trauriger Mistkerl bist du eigentlich! Da surfst du mitten in der Nacht im Internet und suchst nach dem Foto der Ehefrau eines anderen, einer Frau, mit der du noch nicht einmal ein Wort gewechselt hast.
7
Schweigen im Auto. Ross fuhr schnell. Vor ihnen in der Dunkelheit spulte sich die Straße ab, ein endloses Band, manchmal erhellt von Scheinwerfern, dann wieder Leere. Im Radio lief Brahms, trauervolle Geigenklänge, wie das Präludium zu etwas Schlimmem. Der Geruch der Zigarre und der Lederbezüge erfüllten den Aston Martin, Ross’ Macho-Kokon.
Faiths Vater hatte auch Zigarren geraucht, deshalb musste sie bei dem Geruch immer an ihn und das kleine Doppelhaus denken, in dem sie aufgewachsen war. Sie erinnerte sich an die Zeit, als ihr Vater die Arme nicht mehr bewegen konnte und sie neben seinem Bett saß. Den matschigen Stummel zwischen die Lippen geklemmt, hatte er verzweifelt lächelnd zu ihr aufgeblickt, als wollte er sagen: »Wenigstens mein Mund funktioniert noch, immerhin kann ich Gott immer noch dafür danken, dass er mich geschaffen hat.«
Faith kehrte in Gedanken zu dem Mann zurück, dem Fremden im Gedrängel an der Bar, nachdem die Reden gehalten worden waren. Er war ohne Begleitung gekommen. Nur vier Schritte hätte sie gehen müssen, dann hätte sie direkt vor ihm gestanden. Ross war nicht an die Bar gekommen, sondern an seinem Tisch sitzen geblieben und hatte sich mit jemandem unterhalten. Nur vier Schritte. Stattdessen hatte sie sich unauffällig davongestohlen und sich in ein Gespräch zwischen Felicity Beard, der Frau eines mit Ross bekannten Gynäkologen – eine der wenigen Arztfrauen, die sie sympathisch fand –, und einer anderen Frau eingemischt. Sie hatten fast nur über den Thailand-Urlaub gesprochen, als Ross auftauchte und sagte, er wolle gehen, weil er am nächsten Morgen früh rausmüsse.
»Ich habe dich beobachtet«, sagte er ruhig.
»Und was hast du gesehen?«
Wieder Schweigen. Nur die Geigen und die Nacht. Ein Straßenschild nach Brighton zuckte vorbei. Achtzehn Meilen. Sie wusste, was er meinte. Es hatte keinen Sinn, sich dumm zu stellen. Ross wirkte ruhig, aber in seinem Inneren herrschte brütendes Schweigen. Am besten ließ sie ihn in Ruhe, und wenn sie zu Hause ankamen, war er vielleicht zu müde, das Ganze aufzubauschen. Außerdem fühlte sie sich nicht gut genug, um mit ihm zu streiten.
Sie dachte an Alec, der inzwischen längst im Bett lag und schlief. Es ging ihm bestimmt gut, er himmelte seine Großmutter an, die ihn verzog. Sie genoss es, über Nacht zu bleiben – Ross hatte ihr eine ganze Zimmerflucht im Haus eingeräumt. Wahrscheinlich war sie noch wach, saß kettenrauchend vor dem 60-Zoll-Fernseher, den er ihr gekauft hatte, und sah sich bis frühmorgens Spielfilme an, so wie während Faiths Kindheit, als sie Faiths bettlägerigem, unter Schlaflosigkeit leidenden Vater Gesellschaft leistete.
Aufgrund von Gesprächen mit verschiedenen Leuten wusste sie, dass viele Frauen mit ihren Schwiegersöhnen schlecht auskamen. Aber ihre Mutter hatte sich von Anfang an gut mit Ross verstanden, denn er war zu ihr – und ihrem Vater in dessen letzten Lebensjahren – immer gut gewesen. Allerdings brachte das ein Problem mit sich: Es fiel Faith schwer, mit ihrer Mutter über Schwierigkeiten in ihrer Ehe zu sprechen. Ihre Standardantwort lautete nämlich, dass es in jeder Ehe Probleme gebe, und Faith sich über das, was sie hatte, freuen und Ross’ Gebaren als Folge der Belastung eines Mannes in seiner Position akzeptieren solle.
Es war zwanzig nach zwölf. Wieder dachte sie an den Fremden beim Dinner. Wie das Leben mit einem anderen Mann, einem anderen Ehemann wohl aussehen würde? Wie könnte sie Ross’ Umklammerung entkommen? Wie würde Alec –? Plötzlich wurde ihr schlecht. »Halt an! Ross, schnell, fahr links ran!«
Sie hatte das Gefühl, als schlösse sich das Wageninnere um sie. Die Hand auf den Mund gepresst, konnte sie nur eines denken, als Ross an den Straßenrand fuhr: Ich darf nicht … Nicht im Auto …
Der Wagen kam mit einem Ruck zum Stehen. Sie öffnete den Sicherheitsgurt, fand den Türgriff, schob die Tür auf und taumelte hinaus in die kalte Nachtluft. Dann saß sie auf den Knien auf dem Asphalt und übergab sich.
Augenblicke später lag Ross’ Hand auf ihrer Stirn. »Mein Baby, Liebling, ist ja alles gut.«
Sie schwitzte, erbrach sich nochmals. Ross presste seine Handfläche fest gegen ihre Stirn, so wie es ihre Mutter getan hatte, als Faith ein Kind war. Dann wischte er ihr mit seinem Taschentuch den Mund ab.
Als sie wieder im Wagen saß, der Sitz war zurückgestellt, die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht, sagte Ross: »Wahrscheinlich der Meeresfrüchte-Cocktail. Verdorbene Garnelen oder dergleichen.«
Sie wollte ihm entgegnen, dass er sich irre. Sie fühlte sich schon seit einigen Tagen so, aber sie hatte Angst, es anzusprechen, weil sie sich dann vielleicht erneut übergab. Sie lehnte sich zurück – um sie herum drehten sich das Dunkel und die Lichter, ihre Kontaktlinsen fühlten sich rau und unbequem an – und war sich der Bewegungen des Wagens und des sich ändernden Klangs der Reifen nur vage bewusst, während sie sich ihrem Zuhause näherten.
Und einem Glas Wasser.
Sie saß an dem breiten Kieferntisch vor dem gusseisernen Kaminofen und lauschte Rasputin, der irgendwo im Garten ein Kaninchen jagte und von Ross ins Haus zurückgerufen wurde. Die Uhr an der Küchenwand zeigte zehn nach eins.
Sie hörte das Tappen von Pfoten, dann legte Rasputin ihr die Schnauze auf den Schoß. »Na, wie geht’s, alter Junge?« Während sie ihm über das seidige Haar strich, blickte er erwartungsvoll zu ihr auf: zwei große, seelenvolle Augen. Dann stupste er sie sanft an. Lächelnd sagte sie: »Möchtest du einen Keks?« Sie schob ihn von sich fort und holte einen Keks aus dem Vorratsschrank, ließ ihn Sitz machen und steckte ihm den Keks ins Maul. Dann ging sie, während er zufrieden kaute, zur Spüle und wusch sich den Mund mit Wasser aus, um den sauren Geschmack des Erbrochenen loszuwerden.
Ein Schlüssel klapperte. Augenblicke später hörte sie das Gerassel der Sicherheitskette: Ross schloss das Haus für die Nacht ab. Er trat hinter sie, legte ihr die Hände auf die Schulter und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Alec schläft. Wie geht’s dir jetzt?«
»Etwas besser, danke.«
»Wirken die Tabletten schon?«
»Ich glaube ja. Was sind das für Pillen?«
»Sie beruhigen den Organismus.«
Es ärgerte sie, dass er ihr nie sagte, was für Tabletten er ihr gab. Als wäre sie ein Kind.
Er kniete nieder, untersuchte ihre Augen, sagte, sie solle die Zunge herausstrecken, und untersuchte auch diese mit sorgenvoller Miene.
»Was habe ich?«
»Nichts.« Er lächelte. »Du musst ins Bett. Aber ich möchte dir noch etwas zeigen, bevor wir nach oben gehen – es dauert nur eine Sekunde.«
Wieder entdeckte sie hinter seinem Lächeln eine leichte Unsicherheit. »Was hast du an meiner Zunge gesehen?«
Nach kurzem Zögern sagte er voller Überzeugung: »Nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest.«
Sie hob ihre kleine Handtasche vom Küchentisch und folgte Ross den Flur entlang – an den Wänden hingen Stiche mit historischen Militäruniformen, dazwischen Schilde und Schwerter – in sein Arbeitszimmer. Es ging ihr entschieden besser, aber ob es daran lag, dass sie sich erbrochen hatte, oder an den Tabletten, wusste sie nicht. Außerdem war sie hellwach.
Ross ging zu seinem Computer und drückte eine Taste auf der Tastatur; der Bildschirm leuchtete auf. Dann schaltete er die Schreibtischlampe an, ließ seine Aktenmappe aufspringen, nahm eine Diskette heraus und schob sie ins Laufwerk. Einst hatte Faith die maskuline, gediegene Atmosphäre gemocht, aber heute war ihr unbehaglich zumute, wie einer Schülerin im Zimmer des Schulleiters.
Der makellos saubere Raum war mit tiefen Ledersesseln und einem Ledersofa eingerichtet. An den Wänden hingen erlesene viktorianische Gemälde mit maritimen Motiven, auf einem kleinen Sockel stand eine Büste des Sokrates, in den Bücherregalen reihten sich medizinische Fachbücher und Fachzeitschriften aneinander. Ross arbeitete an einem schönen antiken Schreibtisch aus Walnussholz, den sie ihm kurz nach dem Umzug hierher zum Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte ein ziemliches Loch in ihre Ersparnisse gerissen, die sie während ihrer kurzen Zeit im Catering-Business angesammelt hatte.
Weil Ross darauf bestand, hatte sie kurz vor ihrer Heirat aufgehört zu arbeiten. Ihr hatten der Job, wo sie meist für die Mittagsmenüs von Geschäftsführern zuständig war, und die kleine Firma, bei der sie nach dem Hauswirtschafts-College angefangen hatte, sehr gut gefallen. Trotzdem war sie glücklich und zufrieden gewesen, für sie beide ein Zuhause zu schaffen. Sobald sie sich eingelebt hatten, konnte sie immer noch ihr Wunschstudium aufnehmen: Ernährungswissenschaft.
Aber Ross hatte sowohl die Idee, dass sie wieder zur Uni ging, als auch die Annahme einer Teilzeitbeschäftigung abgelehnt. Er hatte ein großes Thema daraus gemacht und gesagt, sie solle sich doch nicht durch Studium oder Beruf kaputtmachen. Inzwischen war ihr allerdings klar, dass er sie ans Haus fesseln wollte.
Stattdessen hatte sie sich ins Gemeindeleben gestürzt. Der benachbarte Weiler Little Scaynes bestand aus kaum mehr als ein paar viktorianischen Cottages. Ursprünglich waren sie für die Eisenbahnarbeiter errichtet worden, die die Strecke London–Brighton bauten. Der Ort war eine planlose Ansammlung größerer und neuerer Häuser und einer normannischen Kirche, die sich einiger schöner Fresken, Trockenfäule, einer blühenden Kolonie von Holzwürmern sowie eines Pfarrers rühmte, dessen falsches Gebiss klapperte, wenn er vor seiner winzigen Gemeinde predigte.
In Little Scaynes gab es kein Lebensmittelgeschäft. Der einzige Pub hatte 1874 geschlossen, als die wichtigste Straße zwischen Lewes und London drei Meilen nach Süden verlegt worden war. Die nächste Einkaufsmöglichkeit lag zwei Meilen entfernt, ein Dorfladen, der wegen eines Supermarkts in der Nähe kurz vor der Schließung stand. Obwohl Faith wie alle andern – und ebenso schuldbewusst – dort nur Noteinkäufe tätigte, war sie in das Komitee zur Rettung des kleinen Ladens gewählt worden.
Trotz seiner geringen Größe war Little Scaynes allerdings eine Hochburg der Lokalpolitik, bevölkert von einem Heer von Aktivisten mit Tweedröcken, festen Schuhen und eisernen Frisuren. Faith hatte den Eindruck, als verbrächten die Menschen auf dem Lande die meiste Zeit entweder damit, Dinge zu bewahren, oder mit dem Versuch, den Fortschritt aufzuhalten. Seit sie vor zehn Jahren in das Haus gezogen war, hatte sie an mehreren derartigen Vorhaben teilgenommen, um einen Beitrag zum Gemeindeleben zu leisten und um Freundschaften zu schließen, aber auch, weil es ihr schon immer schwer gefallen war, nein zu sagen.
Im Augenblick war sie Mitglied in verschiedenen Komitees: zur Rettung des Kirchendachs, der örtlichen Bücherei, eines sehr alten kleinen Buchenwäldchens, das von einer Neubausiedlung bedroht war, sowie eines öffentlichen Fußwegs, den ein sturer Bauer seit Jahren blockierte. Außerdem war sie aktives Mitglied der Ortsgruppe des nationalen Kinderschutzbundes NSPCC. Seit Jahren beteiligte sie sich darüber hinaus an den Bemühungen, die Modernisierung einer alten Scheune am Dorfrand zu stoppen, die Zustimmung zu einer neuen Umgehung rückgängig zu machen, den Bau eines weiteren Golfplatzes zu vereiteln und den Zusammenschluss ihres Gemeinderates mit dem einer Nachbargemeinde zu verhindern.
Am meisten Befriedigung hatte ihr in den letzten Jahren jedoch die Mithilfe bei der Sammlung für die an Leukämie erkrankte Tochter eines Schäfers geschenkt. Über 50 000 Pfund waren zusammengekommen, um das Mädchen zu einer Operation in die USA zu schicken, die der Fünfjährigen das Leben gerettet hatte. Ross hatte hinter den Kulissen gewirkt.
Ihr eigenes Gesicht erschien auf dem Computerbildschirm. Unmittelbar darauf wurde es durch ein Foto ersetzt, das ihr Gesicht im Profil zeigte.
»So siehst du heute aus«, sagte Ross.
Sie gähnte, und eine bleierne Müdigkeit überfiel sie. Sie versuchte sich zu erinnern, wo die Fotos gemacht worden waren. Als sie den Hintergrund betrachtete, fiel es ihr wieder ein: am Strand vor ihrem Hotel in Phuket, vor drei Wochen.
Ross zeigte auf ihre Nase und beschrieb am Bildschirm mit dem Finger eine Kurve an ihrem Nasenrücken entlang. »Ein kleiner Eingriff, nur ein paar Tage leichte Beschwerden, und dann …« Er tippte auf die Tastatur, Faiths Gesicht verschwand, dann tauchte es im Profil auf, nun allerdings mit einer neuen Nase.
Obwohl sie nach den Bemerkungen, die Ross in letzter Zeit fallen gelassen hatte, mit so etwas gerechnet hatte, schockierte es sie doch, dass er jetzt darauf zu sprechen kam, wo es ihr so schlecht ging. Aber wahrscheinlich hatte er gerade deshalb diesen Augenblick gewählt.
»Können wir morgen früh darüber sprechen? Ich bin hundemüde.«
»Ich habe für nächsten Montag ein Zimmer in der Klinik reserviert. Deine Mutter kann Alec zu sich nehmen –«
»Nein. Ich habe dir gesagt, dass ich keine weiteren Operationen will.«
Jetzt kam die Wut heraus, die sich seit dem Dinner in ihm aufgestaut hatte. »Weißt du eigentlich, wie viele Frauen ihren rechten Arm für das geben würden, was du umsonst bekommst?«
Sie lächelte säuerlich und streckte den rechten Arm aus. »Dann schneid ihn doch ab – du hast ja auch schon von fast jedem anderen Körperteil etwas abgeschnitten.«
»Mach dich nicht lächerlich.«
»Tu ich nicht. Wenn ich dir nicht gefalle, wie ich bin, dann heirate doch eine andere.«
Er wirkte derart gekränkt, dass sie Schuldgefühle bekam, die sich rasch in Wut auf sie selbst verwandelten, weil sie zuließ, dass ihre Gefühle auf diese Weise manipuliert wurden. Ross war wie ein blendender Schauspieler, der sein Publikum mühelos im Griff hatte. Seit Jahren schon spielte er mit ihren Gedanken und Gefühlen, und sie hatte sich wieder einmal einwickeln lassen.
»Liebling, jeder Schönheitschirurg in der Welt operiert seine Frau. Wenn du mich zu Kongressen begleitest, bist du die beste Referenz, die ich vorweisen kann. Die Leute schauen dich an, und sie sehen Vollkommenheit. Sie denken: Guck dir die Frau von diesem Kerl an – der muss ja brillant auf seinem Gebiet sein!«
»Du betrachtest mich als deine Arbeitsprobe? Mehr bedeute ich dir nicht? Bin ich so etwas wie ein Muster?«
Jetzt wirkte er noch verletzter. »Liebling, du hast mir immer gesagt, du wärst nicht glücklich mit deinem Gesicht. Dein Kinn würde dir nicht gefallen, du wünschtest, du hättest ausgeprägtere Wangenknochen. Mehr habe ich nicht operiert. Und hinterher sahst du umwerfend aus, und das weißt du. Du hast es mir selbst gesagt.«
»Und meine Brüste?«
»Ich habe von deinen Brüsten nichts abgeschnitten, sondern ihnen etwas hinzugefügt.«
»Weil sie dir nicht groß genug waren.«
Er rückte näher heran, hob die Stimme: »Vergiss nie, dass du nichts warst, nur ein unscheinbares junges Ding, als wir uns kennen lernten. Ich habe dein Potenzial entdeckt und dich zu der schönen Frau gemacht, die du heute bist. Du und ich – wir haben uns gegenseitig zum Erfolg verholfen. Ich helfe dir auf operativem Wege, du hilfst mir bei meiner Karriere mit deinem Aussehen, deiner Persönlichkeit, deiner –«
»Warum hast du mich nicht so gelassen, wie ich bin, wenn du es nicht erträgst, dass andere Männer mich ansehen. Wieso hast du mich nicht ein hässliches Entlein sein lassen?«
Er blickte ihr fest in die Augen, er bebte, und obwohl er sie noch nie geschlagen hatte, hatte sie das Gefühl, dass er es jetzt am liebsten getan hätte.
»Du hast den Mann bei dem Dinner nicht nur angeschaut. Er hat dich mit Blicken gevögelt.«
Sie wandte sich ab. »Das ist lächerlich. Ich gehe ins Bett.«
Er packte sie so heftig bei den Schultern, dass sie vor Schmerzen aufschrie. Ihre Handtasche landete auf dem Boden, Lippenstift und Puderdose fielen heraus. »Ich rede mit dir.«
Sie kniete sich hin und sammelte ihre Sachen ein. »Ja, aber ich rede nicht mehr mit dir heute Abend. Ich fühle mich krank und leg mich jetzt schlafen.«
Als sie oben an der Treppe stand, rief er: »Faith, ich bin –«
Aber sie hörte ihn kaum, denn wieder überkam sie diese Übelkeit. Sie versuchte, sich am Treppengeländer festzuhalten, doch ihre Hand rutschte ab, und sie stolperte nach vorn.
Ross fing sie auf. Sie stützte sich ab, aber jetzt war sein Griff sanft, und seine Stimme klang zärtlich. »Verzeih mir, ich wollte dich nicht anschreien. Du weißt einfach nicht, wie viel du mir bedeutest. Du und Alec. Bevor ich dich kennen lernte, hatte ich kein Leben, jedenfalls kein richtiges. Bevor ich dir begegnete, wusste ich nicht, was Liebe, Wärme ist. Sicher, ich bin manchmal schwierig, aber das liegt nur daran, dass du mir so viel bedeutest. Verstehst du das denn nicht?«
Sie sah ihn müde an. Sie hatte das schon so oft gehört, und ja, sicher, er meinte es wirklich so. Aber es bedeutete ihr schon lange nichts mehr.
»Du weißt, wie sehr es mich ängstigt, wenn es dir nicht gut geht. Bitte such morgen einen Arzt auf, geh zu Jules. Ich sage Lucinda gleich morgen früh, dass sie ihn anrufen soll.«
Lucinda war Ross’ Sekretärin. Jules Ritterman war der Hausarzt, den Ross kannte, seit er während des Medizinstudiums Vorlesungen bei ihm gehört hatte. Faith mochte ihn nicht besonders, aber sie fühlte sich zu geschwächt, um mit Ross zu streiten. Sie wollte sich einfach nur hinlegen und schlafen.
Ihr war schwindlig.
»Es wird schon wieder.«
»Ich möchte dich bitten, Jules aufzusuchen.«
Etwas in seinem Tonfall fiel ihr auf. Die Beharrlichkeit.
»Das wird schon wieder. Wahrscheinlich liegt’s nur am Jetlag nach dem Rückflug aus Thailand.«
»Dir ist schon seit einer Woche übel. Vielleicht hast du dir in Thailand einen Bazillus eingefangen, und wenn ja, muss man ihm eins auf den Deckel geben. Capisce?«
Sie ging ins Schlafzimmer, setzte sich aufs Bett, nahm die Kontaktlinsen heraus, legte sie in das Behältnis und lehnte sich dankbar zurück. Ross stand über ihr, und sie war auf der Hut, aufmerksam, aber nun war er wieder der sanfte, fürsorgliche Ehemann.
»Capisce?«
Sie versuchte alles zu durchdenken. Es bedeutete, dass sie morgen nach London fahren musste. Allerdings hatte Ross in ein paar Wochen Geburtstag, und sie könnte ein Geschenk für ihn einkaufen.
»Ja«, sagte sie widerstrebend.